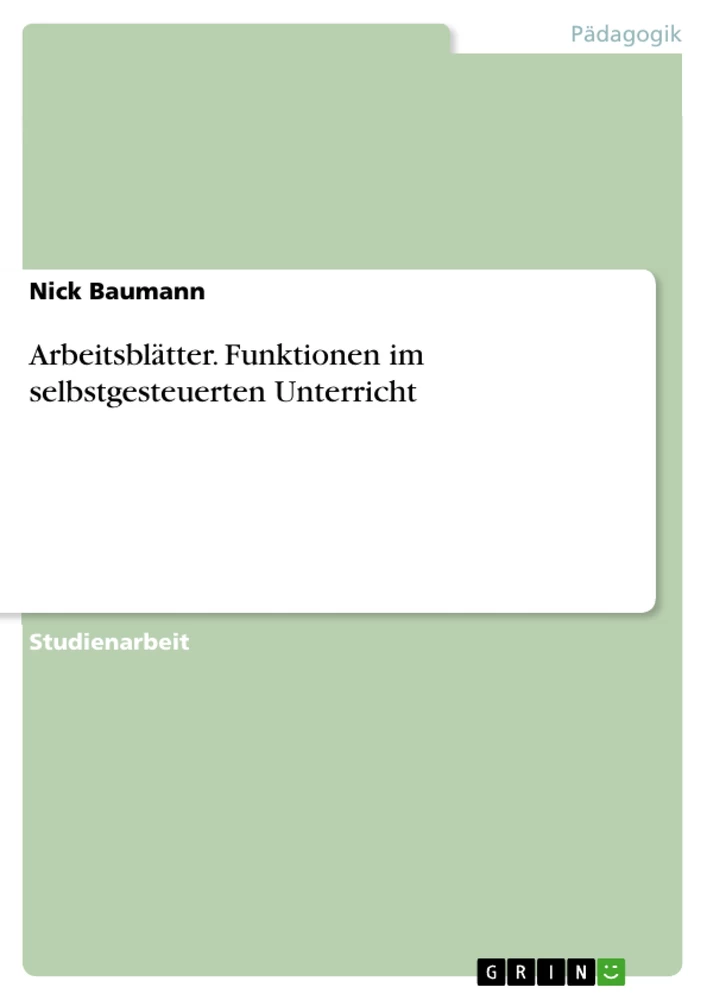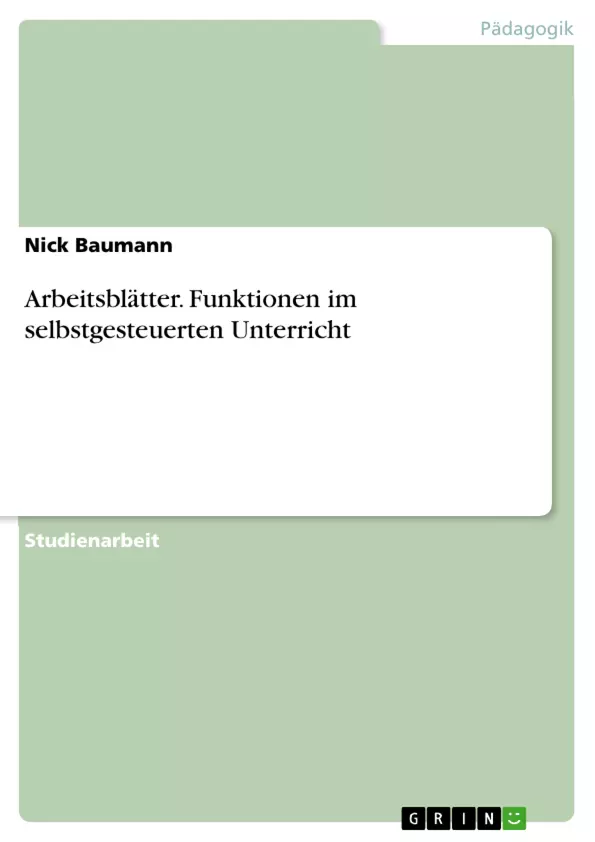Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung
2. Was ist selbst gesteuertes Lernen
2.1. Freiheitsgrade der Selbststeuerung
2.2. Anforderungen an die Lernenden
2.2.1. Kognition
2.2.2. Motivation
2.2.3. Ressourcen
2.2.3.1. Probleme im Umgang mit Neuen Medien
2.2.4. Interaktion
3. Das („Teacher-made“) Arbeitsblatt
3.1. Funktionen
3.2. Arten
3.2.1. Arbeitsblätter ohne Aufgabenstellung
3.2.2. Arbeitsblätter mit Aufgabenstellung
3.3. Kriterien für ein Arbeitsblatt
4. Welche Rolle kann das Arbeitsblatt im selbstgesteuerten Unterricht einnehmen
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Internetquellen
1. Problemstellung
Um als Arbeitnehmer oder Unternehmer seinen eigenen Wert aufrechterhalten und vergrößern zu können, verlangt der heutige Markt mehr von den Teilnehmern, als die reine Wiedergabe von konserviertem Wissen. Gesellschaftliche, technische und wissenschaftliche Veränderungen lassen beruflich relevantes Wissen schnell veraltet. Somit müssen zwangsweise auch Erwachsene auf außerschulisch anwendbare Lernformen zurückgreifen. Betrachten wir hier beispielhaft die Ausbildung zum/zur „Kaufmann/frau im Gesundheitswesen“. Dies ist ein vergleichsweise neuerer Ausbildungsberuf, der die Auszubildenden befähigen soll, Arbeiten in der Verwaltung verschiedenster Institutionen des Gesundheitswesens zu verrichten. Das Gesundheitswesen selbst wird, bedingt durch vielerlei Faktoren wie dem demografischen Wandel, gesetzlichen Vorgaben und medizinischem Fortschritt, permanent umstrukturiert und stellt kein ruhendes Geschäftsfeld dar. Es existiert somit eine breite Spanne an Schülern mit verschiedensten Eintrittsvoraussetzungen, die alle in einem Sektor Fuß fassen wollen, der sich selbst stetig verändert.
Unweigerlich benötigt ein angehender Kaufmann im Gesundheitswesen mehr, als einmalig gelerntes Fachwissen, um bei dieser Entwicklung Schritt zu halten. Es bedarf einer Fähigkeit, die altes Wissen mit neuem Wissen vereint und es zugleich anpassungsfähig gegenüber externen Änderungen macht, wobei nicht jede Änderung gleichermaßen relevant ist und im Kontext vorab eingestuft werden muss. Es bedarf einem selbstgesteuerten, konstruktiven Lernprozess, welcher gerade zur Zeit eines lerntheoretischen Paradigmenwechsels besonders an Bedeutung gewinnt.[...] Wenn nun das selbständige Lernen eine anzustrebende Fähigkeit ist und das Arbeitsblatt methodisch bevorzugt wird, bleibt zu klären, wie sich der Einsatz von Arbeitsblättern im Kontext des selbstgesteuerten Lernens verhält.
Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung
2. Was ist selbst gesteuertes Lernen
2.1. Freiheitsgrade der Selbststeuerung
2.2. Anforderungen an die Lernenden
2.2.1. Kognition
2.2.2. Motivation
2.2.3. Ressourcen
2.2.3.1. Probleme im Umgang mit Neuen Medien
2.2.4. Interaktion
3. Das („Teacher-made“) Arbeitsblatt
3.1. Funktionen
3.2. Arten
3.2.1. Arbeitsblätter ohne Aufgabenstellung
3.2.2. Arbeitsblätter mit Aufgabenstellung
3.3. Kriterien für ein Arbeitsblatt
4. Welche Rolle kann das Arbeitsblatt im selbstgesteuerten Unterricht einnehmen
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Eine Taxonomie kognitiver Lernstrategien
Abbildung 2: Beispiel eines Arbeitsblattes
Häufig gestellte Fragen
Was ist selbstgesteuertes Lernen?
Ein Lernprozess, bei dem die Lernenden ihre Ziele, Methoden und Ressourcen weitgehend eigenständig bestimmen und kontrollieren.
Welche Rolle spielt das Arbeitsblatt im Unterricht?
Das Arbeitsblatt dient als Strukturierungshilfe, Informationsträger oder Übungsinstrument, besonders in Phasen der Selbststeuerung.
Was sind Anforderungen an Lernende bei der Selbststeuerung?
Lernende benötigen kognitive Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung, Motivation und den kompetenten Umgang mit Ressourcen.
Welche Arten von Arbeitsblättern gibt es?
Man unterscheidet Arbeitsblätter mit konkreter Aufgabenstellung (z. B. Übungsblätter) und solche ohne Aufgabenstellung (z. B. Infoblätter).
Warum ist selbstgesteuertes Lernen heute so wichtig?
Wissen veraltet schnell; Arbeitnehmer müssen fähig sein, sich lebenslang neues Wissen eigenständig zu erschließen.
- Quote paper
- B.Sc. Nick Baumann (Author), 2011, Arbeitsblätter. Funktionen im selbstgesteuerten Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215312