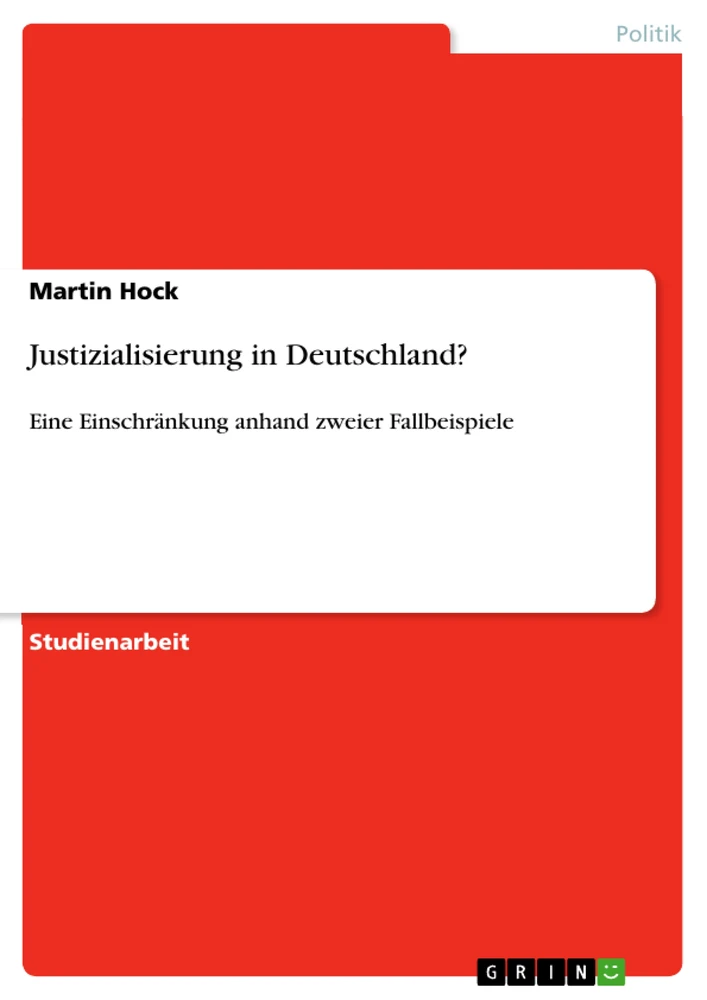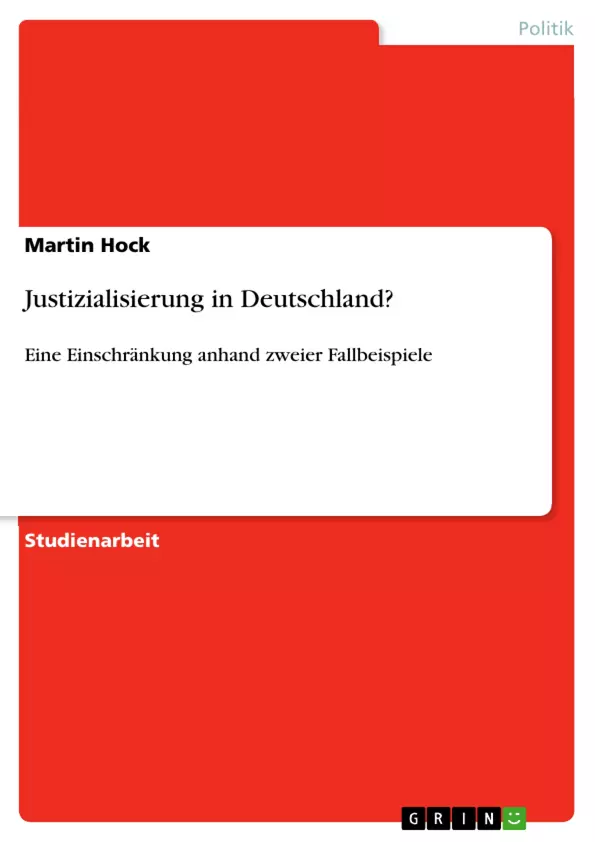In dieser Arbeit wird kritisch geprüft, inwiefern die These der Justizialisierung für die Bundesrepublik Deutschland zutrifft.
Dabei wird, anhand der Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Parteienfinanzierung und zu Kreuzen in bayerischen Klassenzimmern, die Gültigkeit der These eingeschränkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einflussmöglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts auf die Gesetzgebung
- Verfassungsbeschwerde
- Konkrete Normenkontrolle
- Abstrakte Normenkontrolle
- Die Justizialisierungsthese
- Grundlagen des Justizialisierungsprozesses
- Die Verrechtlichung des Gesetzgebungsprozesses
- Die Politisierung des Rechts
- Einschränkung der Justizialisierungsthese für die Bundesrepublik Deutschland
- Autolimitation und Klagehäufigkeit
- Umsetzungen von Gerichtsurteilen
- Fallbeispiele
- Fallbeispiel 1: Urteil zur Parteienfinanzierung
- Fallbeispiel 2: Kruzifixurteil
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Bundesverfassungsgerichts auf die Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland und analysiert, ob die These der Justizialisierung, die von Alec Stone Sweet formuliert wurde, auf das deutsche politische System anwendbar ist. Dabei werden verschiedene Kontrollmechanismen des Bundesverfassungsgerichts sowie die konkrete Umsetzung von Gerichtsurteilen in der Praxis betrachtet.
- Der Einfluss des Bundesverfassungsgerichts auf die Gesetzgebung
- Die Theorie der Justizialisierung und ihre Anwendbarkeit auf Deutschland
- Die Rolle der öffentlichen Meinung bei der Umsetzung von Gerichtsurteilen
- Die Analyse von Fallbeispielen: Parteienfinanzierung und Kruzifixurteil
- Die Grenzen der Justizialisierung im deutschen System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Einflusses des Bundesverfassungsgerichts auf die Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland ein und stellt die These der Justizialisierung vor. Sie erläutert die unterschiedlichen Kontrollmechanismen des Bundesverfassungsgerichts und die Bedeutung des Einflusses der öffentlichen Meinung auf die Umsetzung von Gerichtsurteilen.
Kapitel 2 analysiert die Einflussmöglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts auf die Gesetzgebung, indem es die verschiedenen Arten der Normenprüfung – Verfassungsbeschwerde, konkrete Normenkontrolle und abstrakte Normenkontrolle – detailliert beschreibt.
Kapitel 3 widmet sich der Justizialisierungsthese, erläutert ihre Grundlagen und die Verrechtlichung sowie Politisierung des Gesetzgebungsprozesses.
Kapitel 4 untersucht die Einschränkungen der Justizialisierungsthese im deutschen Kontext und analysiert die Rolle der Autolimitation und die Häufigkeit von Klagen sowie die Umsetzung von Gerichtsurteilen.
Kapitel 5 präsentiert zwei Fallbeispiele: das Urteil zur Parteienfinanzierung und das Kruzifixurteil. Beide Fälle werden im Hinblick auf die Umsetzung der Urteile und die Rolle der öffentlichen Meinung analysiert.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Justizialisierung, Normenkontrolle, Verfassungsbeschwerde, konkrete Normenkontrolle, abstrakte Normenkontrolle, Verrechtlichung, Politisierung, öffentliche Meinung, Fallbeispiele, Parteienfinanzierung, Kruzifixurteil, Gewaltenteilung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Justizialisierung" der Politik?
Damit ist gemeint, dass politische Entscheidungen zunehmend durch Gerichte (insbesondere das Verfassungsgericht) beeinflusst oder korrigiert werden.
Welche Kontrollmechanismen hat das Bundesverfassungsgericht?
Wichtige Instrumente sind die Verfassungsbeschwerde sowie die konkrete und abstrakte Normenkontrolle.
Was war der Kern des Kruzifix-Urteils?
Das Gericht entschied, dass das Anbringen von Kreuzen in staatlichen Schulen gegen die Religionsfreiheit und das Neutralitätsgebot des Staates verstoßen kann.
Hat das Gericht Einfluss auf die Parteienfinanzierung?
Ja, durch mehrere Urteile hat das Bundesverfassungsgericht die gesetzlichen Regelungen zur Finanzierung von Parteien maßgeblich mitgestaltet und Grenzen gesetzt.
Gibt es Grenzen der Justizialisierung in Deutschland?
Ja, durch "Autolimitation" (gerichtliche Selbstbeschränkung) und die Tatsache, dass die Politik Spielräume bei der Umsetzung von Urteilen behält.
- Citar trabajo
- Martin Hock (Autor), 2012, Justizialisierung in Deutschland?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232333