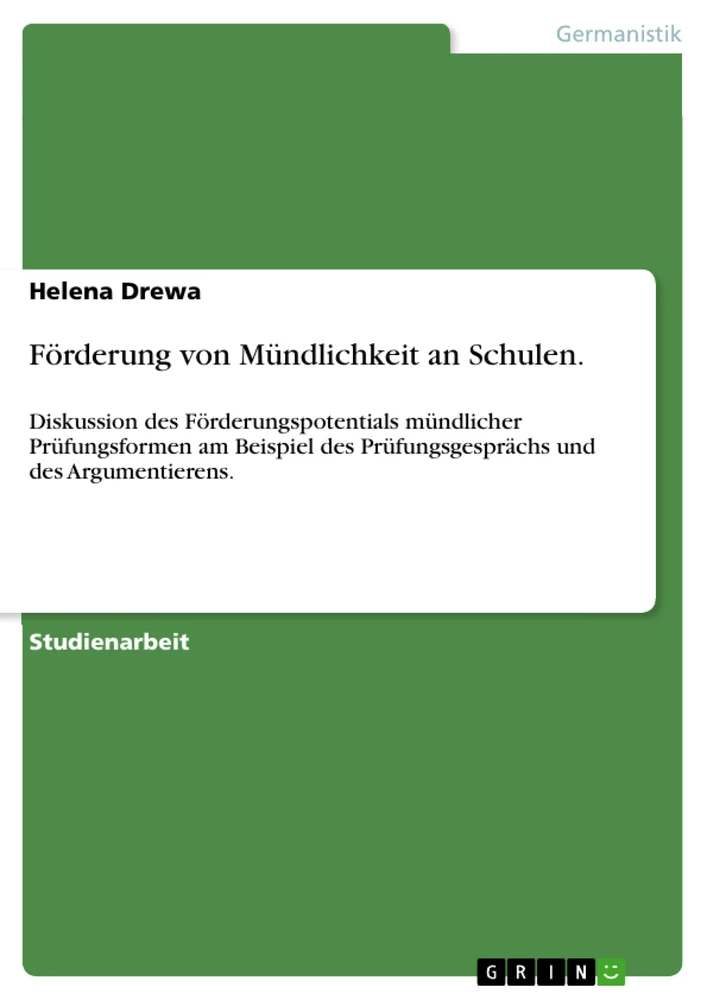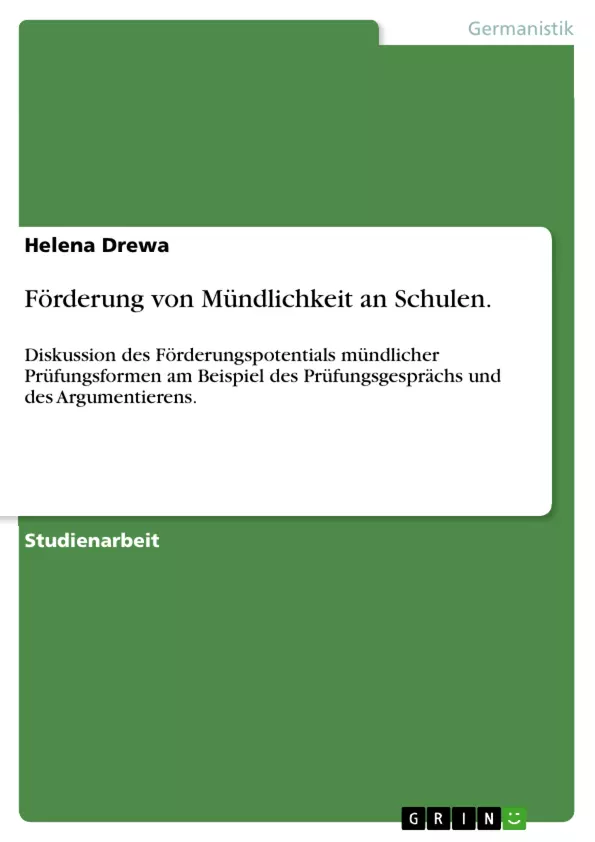Sowohl im Unterricht selbst als auch in den curricularen Vorgaben des Faches Deutsch nehmen Mündlichkeit und Schriftlichkeit eine gleichermaßen bedeutende Rolle ein, insofern durch die jeweiligen Themenfelder eine Vermittlung von Inhalten zur mündlichen wie schriftlichen Sprachrealisierung vorgeben wird und die Vermittlung selbst sowohl medial mündlich (Unterrichtsgespräch) als auch medial schriftlich (Texte) vorgenommen wird. Nichtsdestotrotz dominieren in jedem Schulfach schriftliche Leistungsüberprüfungen, während mündliche Prüfungsformen lediglich im Rahmen von Abschlussprüfungen wie dem Abitur eingesetzt werden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll letztendlich herausgestellt werden, inwieweit durch eine stärkere Integration mündlicher Prüfungsformen Mündlichkeit selbst gefördert werden kann, sodass schulische bzw. institutionelle und alltägliche Kommunikationssituationen erfolgreich bewältigt werden können. Hierzu sollen bestehende mündliche Prüfungsformen hinsichtlich ihres Förderungspotentials untersucht sowie alternative Möglichkeiten vorgestellt und ebenfalls hinsichtlich des Förderungsaspekts beurteilt werden. Insofern wird die Eignung von Prüfungsformen, fachliche Kenntnisse zu überprüfen und zu bewerten im Rahmen der Arbeit nicht ausführlich thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Mündliche Leistungsüberprüfung
- 2.1. Curriculare Vorgaben im Fach Deutsch
- 2.2. Das Prüfungsgespräch – eine gesprächsanalytische Darlegung
- 2.3. Förderung der Mündlichkeit mithilfe des Prüfungsgesprächs
- 3. Mündliches Argumentieren
- 3.1. Begriffsbestimmung
- 3.2. Mögliche Argumentationsformate
- 3.3. Förderung der Mündlichkeit mithilfe des Argumentierens
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Förderung von Mündlichkeit an Schulen. Ziel ist es, zu untersuchen, inwieweit eine stärkere Integration mündlicher Prüfungsformen die mündliche Sprachfähigkeit von Schülern verbessern kann. Dabei werden bestehende Prüfungsformen, insbesondere das Prüfungsgespräch, auf ihr Förderungspotenzial analysiert und alternative Möglichkeiten, wie das mündliche Argumentieren, vorgestellt und bewertet.
- Bedeutung von Mündlichkeit im Deutschunterricht
- Analyse von Prüfungsformen (z.B. Prüfungsgespräch, mündliches Argumentieren)
- Förderungspotenzial verschiedener Prüfungsformen für die Entwicklung mündlicher Kompetenzen
- Diskussion der Eignung von mündlichen Prüfungsformen zur Überprüfungen fachlicher Kenntnisse
- Alternativen zum Prüfungsgespräch für die Förderung der Mündlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Bedeutung von Mündlichkeit im Deutschunterricht und stellt die curricularen Vorgaben der Sekundarstufe I und II im Fach Deutsch dar. Kapitel 2 widmet sich dem Prüfungsgespräch als vorherrschender mündlicher Prüfungsform an Schulen. Es wird eine theoretische Grundlegung des Begriffs „Prüfungsgespräch“ gegeben und die Charakteristika des Prüfungsgesprächs im Spannungsfeld konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit analysiert. Kapitel 2 schließt mit einer Diskussion des Förderungspotentials des Prüfungsgesprächs ab.
In Kapitel 3 wird das mündliche Argumentieren als alternative Prüfungsform vorgestellt. Der Begriff „Argumentieren“ wird definiert und die Charakteristika des mündlichen Argumentierens werden erläutert. Nachfolgend werden verschiedene sprachliche Handlungsformate, die das mündliche Argumentieren beinhalten und als Prüfungsformen dienen können, vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion des Förderungspotentials des mündlichen Argumentierens.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte der Arbeit sind Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Sprachvariation, Prüfungsformen, Prüfungsgespräch, mündliches Argumentieren, Förderungspotenzial, curriculare Vorgaben, Sekundarstufe I und II, Deutschunterricht.
- Quote paper
- Helena Drewa (Author), 2013, Förderung von Mündlichkeit an Schulen., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262723