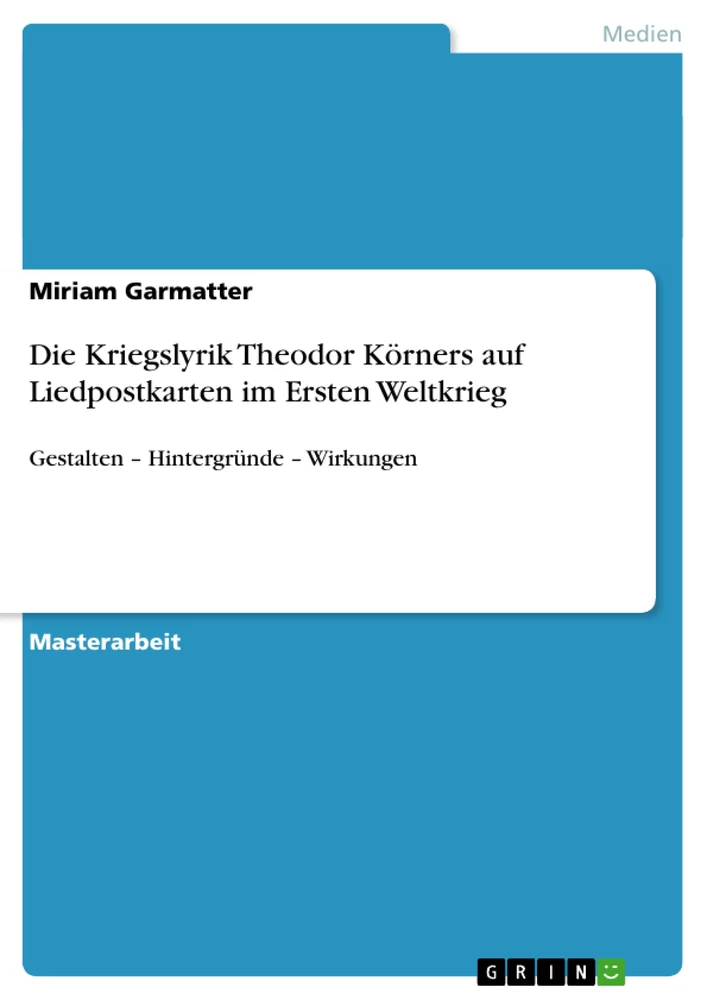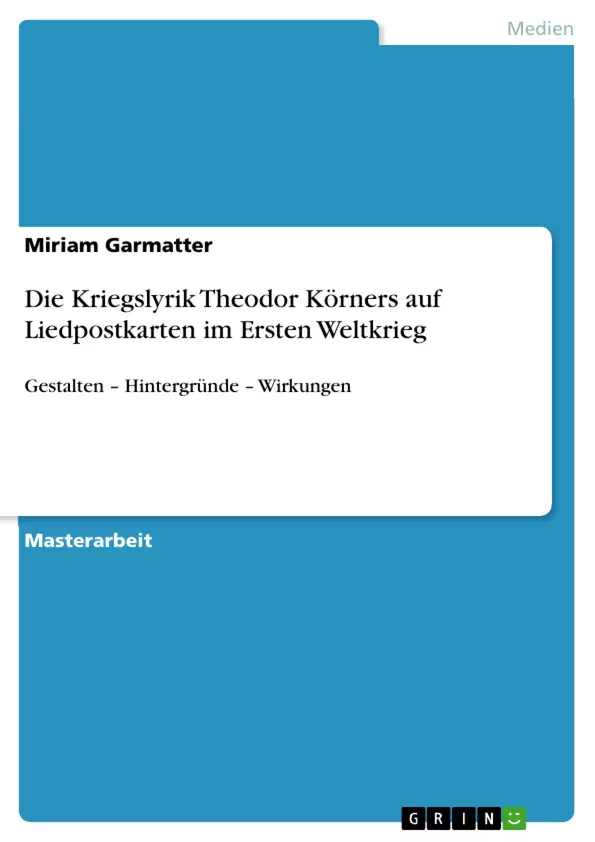1. Einleitung
"Das Volk steht auf, der Sturm bricht los:
Wer legt noch die Hände feig in den Schoß?"
Diese zwei Verse aus dem Werk Theodor Körners mögen beim Leser ganz konkrete Assoziationen wecken. Jeder, der sich mit der Zeit des Nationalsozialismus befasst hat, kennt das Zitat am Ende der Sportpalastrede des Propagandaministers Joseph Goebbels (Nun, Volk, steh‘ auf/ und, Sturm, brich los!). Diese Rede wurde zu einem Zeitpunkt gehalten, da der Krieg für die Deutschen nach der vernichtenden Niederlage bei Stalingrad im Winter 1943 bereits als verloren gelten konnte. Auch wenn nicht jeder dies als Tatsache hinzunehmen bereit war und viele lieber weiterhin an einen erfolgreichen Kriegsausgang glauben wollten, wirkte sich die katastrophale Situation an der Ostfront insgesamt sehr negativ auf die Stimmungslage und die Kriegsbegeisterung der Deutschen aus. Der damalige Reichspropagandaminister Joseph Goebbels versuchte der Kriegsmüdigkeit entgegenzuwirken und die deutsche Bevölkerung zum weiteren, aufopferungsvollen Einsatz für das Vaterland zu mobilisieren. In diesen Kontext ist seine berühmt gewordene „Sportpalastrede“ einzuordnen. Über 109 Minuten schwor der Redner die Anwesenden auf die Notwendigkeit des „totalen Krieges“ ein und rief damit frenetischen Jubel und ekstatische Zustimmung hervor. Goebbels schloss seine Rede mit folgendem Appell an das deutsche Volk:
Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen; wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf, und Sturm, brich los!
Mit dieser eingängigen, motivierenden Parole knüpfte der nationalsozialistische Propagandist an die Lyrik der Befreiungskriege von 1813-1815 an. Goebbels Losung stellte eine nur leicht variierte Version der ersten Zeile des eingangs zitierten Gedichts „Männer und Buben“ von Theodor Körner dar. Körners Gedicht von 1813, das wenig später von Weber vertont wurde, gehört zu den populärsten Texten aus der Zeit des Kampfes gegen die französischen Besatzer. Es findet sich in Körners bekanntester Gedichtsammlung „Leyer und Schwert“ zwischen weiteren Kriegsdichtungen und wurde vielfach nachgedruckt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Biographie Körners
- 2.1. Kindheit und Jugend Theodor Körners
- 2.2. Studentenzeit und Erfolg als Dichter
- 2.3. Der Soldat Körner und sein früher Tod
- 3. Wandel des Körnerbildes bis zum 1. Weltkrieg
- 3.1. Rezeptionsgeschichte der Lyrik Körners
- 3.1.1. Feiern zum Jubiläumsjahr 1913
- 3.1.2. Körner als soldatisches Vorbild und Trostgeber
- 3.2. Einordnung der Lyrik Körners
- 3.2.1. Zum Wesen der „Befreiungskriege“ 1813-1815
- 3.2.2. Die Rolle Körners Lyrik innerhalb der Befreiungskriegslyrik
- 4. Die Bedeutung von Bildpostkarten im Ersten Weltkrieg
- 4.1. Entwicklung und Verbreitung der Bildpostkarte bis 1914
- 4.2. Bedeutung der Feldpost im Ersten Weltkrieg
- 4.3. Die Bildpostkarte als Propagandamedium
- 4.4. Beeinflussung des Postkartenmarktes durch Zensur und Nachfrage
- 4.5. Die Bedeutung der Liedpostkarte für Agitations- und Schutzvereine
- 4.5.1. Der „Deutsche Schulverein“ und der „Allgemeine Deutsche Schulverein“
- 4.5.2. Bedeutende Schutzvereine
- 4.5.4. Liedpostkarten als Einnahmequelle und Propagandamittel
- 5. Körners Kriegslieder auf Bildpostkarten im Ersten Weltkrieg
- 5.1. Auswahl der Postkarten
- 5.2. Methodisches Vorgehen bei der Analyse und Interpretation der Karten
- 5.3. Typisierung und Analyse von ausgewählten Postkarten
- 5.3.1. Postkarten aus der Vorkriegszeit: Das „Schwertlied“
- 5.3.2. Postkarten aus der Vorkriegszeit: Die Postkartenserie des Vereins „Südmark“
- 5.3.2.1. Gedenken an den gefallenen Helden Theodor Körner
- 5.3.2.2. Kampf und Soldatentum
- 5.3.2.3. Opferbereitschaft und religiöser Patriotismus
- 5.3.3. Postkarten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges: „Gebet während der Schlacht“
- 5.3.3.1. Körner als Kämpfer der „heiligen“ Befreiungskriege
- 5.3.3.2. Körner und Kaiser Wilhelm II.
- 5.3.3.3. Verharmlosung des Krieges
- 5.3.3.4. Propagierung des Opfertodes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Verwendung von Theodor Körners Kriegslyrik auf Bildpostkarten des Ersten Weltkriegs. Ziel ist es, die Gestaltung, die historischen Hintergründe und die Wirkung dieser Postkarten zu analysieren und den Beitrag von Körners Werk zur Kriegszeit-Propaganda zu beleuchten.
- Die Rezeption von Körners Lyrik vom 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg.
- Die Rolle der Bildpostkarte als Propagandamittel im Ersten Weltkrieg.
- Die Analyse ausgewählter Bildpostkarten mit Körners Kriegsliedern.
- Die instrumentalisierung von Körners Werk für nationalistische Zwecke.
- Der Vergleich zwischen der Verwendung von Körners Lyrik im Ersten Weltkrieg und zu anderen Zeitpunkten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gestaltung, den Hintergründen und der Wirkung der Verwendung von Theodor Körners Kriegslyrik auf Bildpostkarten des Ersten Weltkriegs vor. Sie verortet die Arbeit im Kontext der Rezeption von Körners Werk und seiner instrumentalisierung für propagandistische Zwecke, beginnend mit einem Zitat aus Körners Werk und dessen späterer Verwendung durch Joseph Goebbels.
2. Biographie Körners: Dieses Kapitel skizziert das Leben Theodor Körners, von seiner Kindheit und Jugend über seine Studentenzeit und seinen Erfolg als Dichter bis hin zu seinem Tod als Soldat in den Befreiungskriegen. Es legt den Grundstein für das Verständnis seiner Lyrik und deren späterer Rezeption.
3. Wandel des Körnerbildes bis zum 1. Weltkrieg: Dieses Kapitel beleuchtet die Rezeptionsgeschichte von Körners Lyrik, beginnend mit den Feierlichkeiten zum Körner-Jubiläum 1913 und dem Wandel seines Bildes als soldatisches Vorbild und Trostgeber. Es analysiert die Einordnung seiner Lyrik im Kontext der Befreiungskriege und deren Wirkung auf die spätere Rezeption.
4. Die Bedeutung von Bildpostkarten im Ersten Weltkrieg: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Verbreitung von Bildpostkarten bis 1914, die Rolle der Feldpost im Ersten Weltkrieg, die Bildpostkarte als Propagandamittel und den Einfluss von Zensur und Nachfrage auf den Markt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung der Liedpostkarte für Agitations- und Schutzvereine.
5. Körners Kriegslieder auf Bildpostkarten im Ersten Weltkrieg: Das zentrale Kapitel analysiert die Auswahl und das methodische Vorgehen bei der Interpretation der Bildpostkarten mit Körners Kriegsliedern. Es typisiert und analysiert ausgewählte Postkarten aus der Vorkriegszeit und dem Ersten Weltkrieg, beleuchtend die unterschiedlichen Aspekte der Darstellung Körners und seiner Lyrik.
Schlüsselwörter
Theodor Körner, Kriegslyrik, Bildpostkarten, Erster Weltkrieg, Propaganda, Befreiungskriege, Rezeptionsgeschichte, Patriotismus, Nationalismus, Agitation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Theodor Körners Kriegslyrik auf Bildpostkarten des Ersten Weltkriegs
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Verwendung von Theodor Körners Kriegslyrik auf Bildpostkarten des Ersten Weltkriegs. Sie analysiert die Gestaltung, die historischen Hintergründe und die Wirkung dieser Postkarten und beleuchtet den Beitrag von Körners Werk zur Kriegszeit-Propaganda.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Rezeption von Körners Lyrik vom 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, die Rolle der Bildpostkarte als Propagandamittel im Ersten Weltkrieg, die Analyse ausgewählter Bildpostkarten mit Körners Kriegsliedern, die Instrumentalisierung von Körners Werk für nationalistische Zwecke und der Vergleich zwischen der Verwendung von Körners Lyrik im Ersten Weltkrieg und zu anderen Zeitpunkten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Biographie Körners, 3. Wandel des Körnerbildes bis zum 1. Weltkrieg, 4. Die Bedeutung von Bildpostkarten im Ersten Weltkrieg und 5. Körners Kriegslieder auf Bildpostkarten im Ersten Weltkrieg. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage vor und verortet die Arbeit im Kontext der Rezeption von Körners Werk und seiner Instrumentalisierung für propagandistische Zwecke. Sie beginnt mit einem Zitat aus Körners Werk und dessen späterer Verwendung durch Joseph Goebbels.
Was ist der Inhalt des Kapitels zur Biographie Körners?
Dieses Kapitel skizziert das Leben Theodor Körners, von seiner Kindheit und Jugend über seine Studentenzeit und seinen Erfolg als Dichter bis hin zu seinem Tod als Soldat in den Befreiungskriegen. Es legt den Grundstein für das Verständnis seiner Lyrik und deren späterer Rezeption.
Was wird im Kapitel zum Wandel des Körnerbildes behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Rezeptionsgeschichte von Körners Lyrik, beginnend mit den Feierlichkeiten zum Körner-Jubiläum 1913 und dem Wandel seines Bildes als soldatisches Vorbild und Trostgeber. Es analysiert die Einordnung seiner Lyrik im Kontext der Befreiungskriege und deren Wirkung auf die spätere Rezeption.
Worüber handelt das Kapitel zur Bedeutung von Bildpostkarten im Ersten Weltkrieg?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Verbreitung von Bildpostkarten bis 1914, die Rolle der Feldpost im Ersten Weltkrieg, die Bildpostkarte als Propagandamittel und den Einfluss von Zensur und Nachfrage auf den Markt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung der Liedpostkarte für Agitations- und Schutzvereine.
Was ist der Inhalt des zentralen Kapitels zur Analyse der Postkarten?
Das zentrale Kapitel analysiert die Auswahl und das methodische Vorgehen bei der Interpretation der Bildpostkarten mit Körners Kriegsliedern. Es typisiert und analysiert ausgewählte Postkarten aus der Vorkriegszeit und dem Ersten Weltkrieg und beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der Darstellung Körners und seiner Lyrik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theodor Körner, Kriegslyrik, Bildpostkarten, Erster Weltkrieg, Propaganda, Befreiungskriege, Rezeptionsgeschichte, Patriotismus, Nationalismus, Agitation.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist detailliert und strukturiert und gibt einen umfassenden Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit. Es zeigt die logische Struktur und den Umfang der Untersuchung.
- Citar trabajo
- Miriam Garmatter (Autor), 2013, Die Kriegslyrik Theodor Körners auf Liedpostkarten im Ersten Weltkrieg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268056