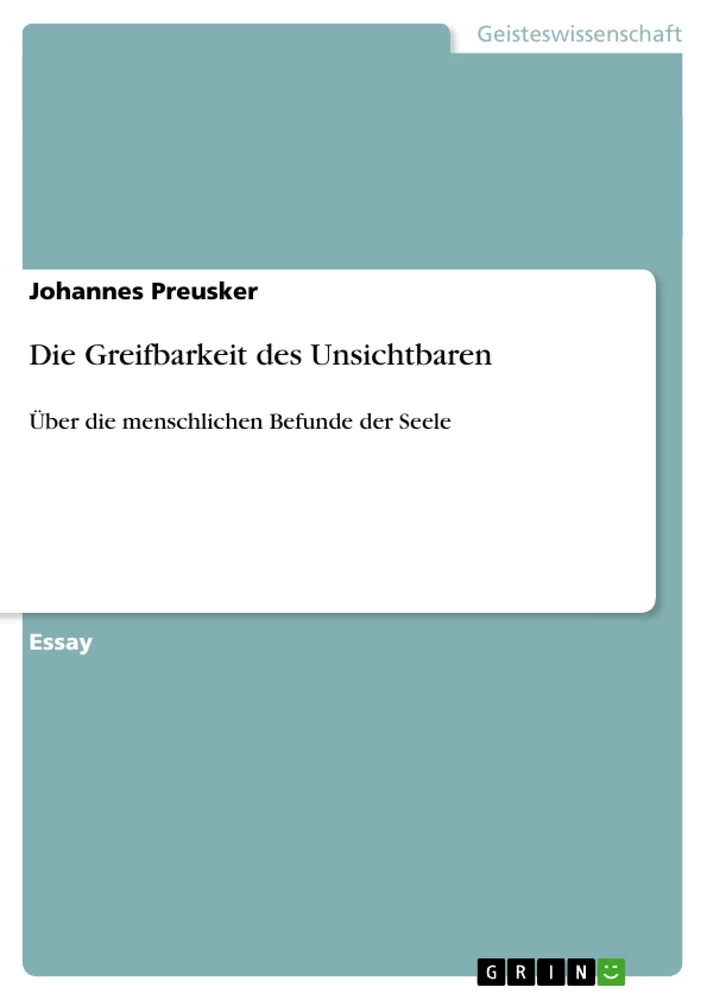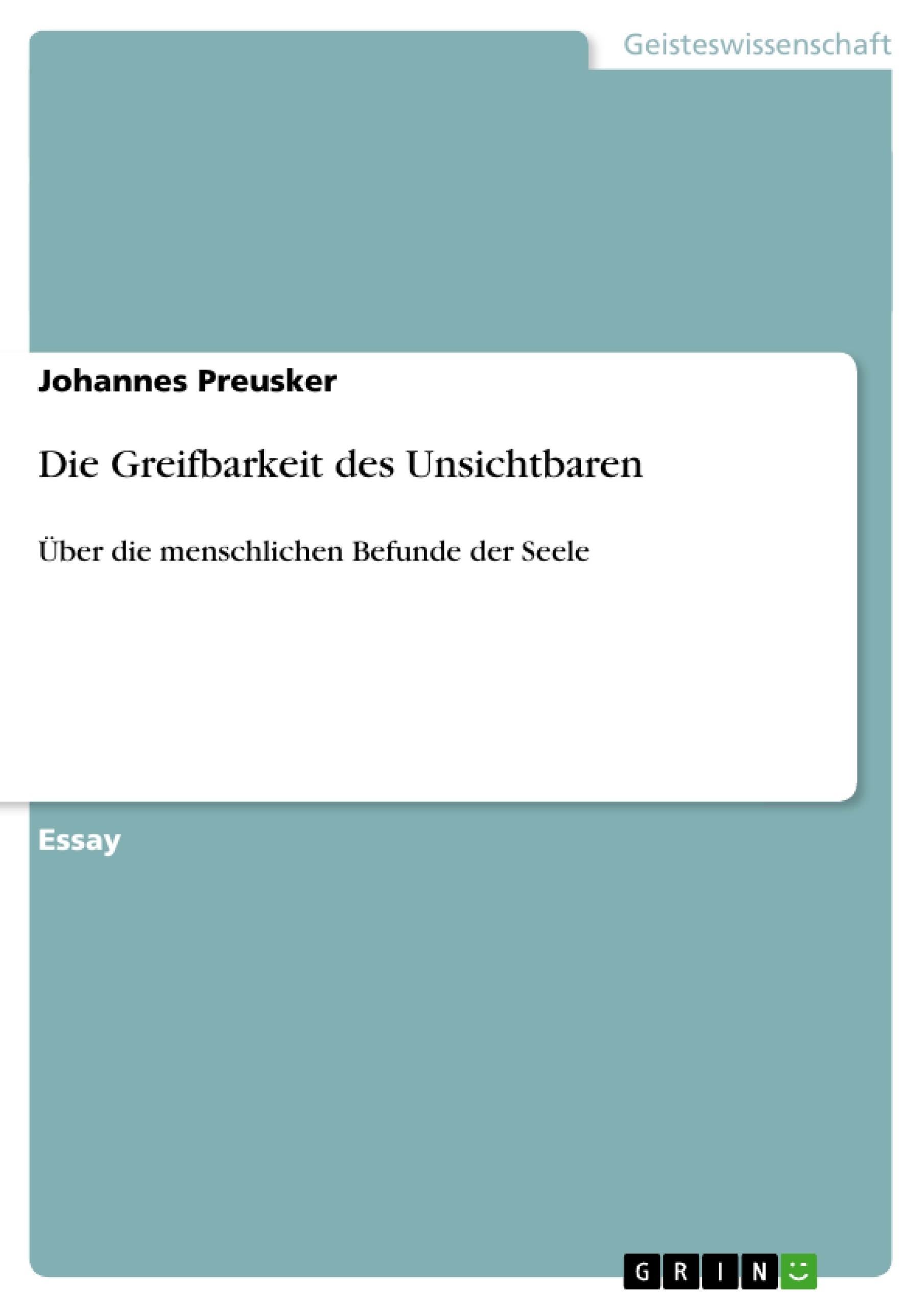Der Essay behandelt die Frage nach der Seele diesseits metaphysischer Überhöhung und esoterischer Unterbestimmung. Am Leitfaden ganzheitlich-menschlichen Erlebens werden der Begriffsgeschichte drei Seelenbefunde entnommen: Der Atemstillstand im Tod, das Vergessen von Träumen im Leben und das Unterlaufen von Raum und Zeit im Umschlagen von Extremen. Schließlich erfolgt ein Ausblick auf die genetische Phänomenologie, welche das Körper-Seele-Problem unter der Vorbedingung bestimmter Leibpraxen betrachtet.
Titel: Die Greifbarkeit des Unsichtbaren. Über die menschlichen Befunde der Seele
Abstract: Der folgende Essay behandelt die Frage nach der Seele diesseits metaphysischer Überhöhung und esoterischer Unterbestimmung. Am Leitfaden ganzheitlich-menschlichen Erlebens werden der Begriffsgeschichte drei Seelenbefunde entnommen: Der Atemstillstand im Tod, das Vergessen von Träumen im Leben und das Unterlaufen von Raum und Zeit im Umschlagen von Extremen. Schließlich erfolgt ein Ausblick auf die genetische Phänomenologie, welche das Körper-Seele-Problem unter der Vorbedingung bestimmter Leibpraxen betrachtet.
Text: Die Seele ist einer der ältesten Begriffe der Philosophiegeschichte. Begriffe scheinen manchmal ein Eigenleben zu führen, besonders dann, wenn sie kurz vor ihrem Absterben beobachtet werden. Die Bedeutsamkeit der letzten Worte eines Menschen verweist auf die Latenz seines Todes, die Farbenpracht des Herbstwaldes auf die Nähe des Winters. So füllte der Seelenbegriff als Weltseele, ja als unkörperliche Materie, den gesamten pneumatischen Horizont der Renaissancephilosophie aus, bevor der neuzeitliche Empirismus mit diesem brach. Schon in der Schule erfuhr ich den angelsächsischen Einfluss auf die Wissenschaftsgeschichte. In den Klassenräumen der Biologie und Chemie zu Beginn des 21. Jahrhunderts geisterte die Renaissance nur noch als „Lernstoff“, mit dem es sich zu „befassen“ galt, über das mit empirischen Messungen beschriebene Papier. Die Physik zumindest lehrt zuerst: Kräfte sind für uns unsichtbar. Man kann sie nur an ihren Wirkungen erkennen.
Mit diesem Essay liegt gleichsam ein Plädoyer für den weitestgehend abgedrängten Seelenbegriff vor. Es soll gezeigt werden, dass ihm weder der Verweis auf die metaphysisch-theologische Spekulation noch esoterisch-vage Zuschreibungen gerecht werden, sondern nur ein Abgleich mit spezifisch menschlichen Erfahrungen. Denn es sind letztlich immer Menschen, welche ihrer Verwunderung in Form von Beobachtungen und Beschreibungen Ausdruck verleihen. Hinsichtlich des besagten Bruchs kann das Folgende also auch als Wiederannäherung zwischen Seele und Wissenschaft gelesen werden.
Zunächst fällt auf, dass sowohl die griechischen Wörter „pneuma“ (πνεῦμα) und „psyche“ (ψσυχή) als auch das hebräische Wort „ruach“ (ﬣךּﬧ) ihre Bedeutung primär im Lebensatem und Lebenswind haben. Der begriffsgeschichtliche Zusammenhang rührt von dem hellenistischen Einfluss auf das aus dem Babylonischen Exil heimgekehrte Judentum her, woraus schließlich das Christentum entstand. Der Wind, wie er an den Küsten des östlichen Mittelmeers weht, umgibt den Leib zur Gänze mit einem beständigen und doch flüchtigen Flirren. Während das hörende Verstehen im semitischen Kulturkreis der Akustik des Windes immer schon einen bedeutsamen Platz einräumen konnte, musste die griechische Antike in ihrer optischen Weltorientierung[1] zunächst das Unsichtbare des Windes überwinden. Dies gelang ihr durch die Verbindung des Wehens mit dem Atem, der sich am Heben und Senken des Brustkorbs oder an gewissen Lippen- und Nasenbewegungen zeigt. Was den Griechen angesichts des Todes bezeichnenderweise zuerst auffiel, waren „die brechenden Augen“[2]. Darüber hinaus musste dem Toten jenes unsichtbar wehende Etwas entwichen sein, das die Atembewegungen mit sich gebracht hatte. Dieser Lebensatem oder Lebenswind aber ist die Seele. Der Stillstand des Atems im Tod ist ein erster menschlicher Befund des Seelenbegriffs.
Hades (Ἅιδης), der Gott des Totenreichs, ist seinem Literalsinn nach der unsichtbar machende Unsichtbare.[3] Obwohl Zeus und Poseidon seine Brüder waren, galt seine Anwesenheit auf dem Olymp als unerwünscht. Hieran lässt sich noch einmal ablesen, dass der Weltzugang der griechischen Antike tendenziell ein optischer war. Hades als Unterwelt barg außerdem die chthonischen Götter Thanatos (Θάνατος) und Hypnos (Ὕπνος), die Brüder Tod und Schlaf. Der Schlaf, besser: der Traum weist den Weg zu einem zweiten Seelenbefund. Die vormoderne Unterscheidung zwischen Träumen und Wachen war bei Weitem nicht stringent, sondern vielmehr in sich durchlässig. Es mag schwarz und weiß erscheinen, wenn Friedrich Nietzsche das Verhältnis zwischen Antike und Neuzeit in Analogie zu dem zwischen Traum- und Wachwelt setzt.[4] Jedoch ist immerhin bei Homer von Proteus zu lesen, ein Meeresgott, an dem die Dynamik der offenen Begriffsgrenzen abzulesen ist. Nachdem sich Menelaos mit drei Gefährten auf ihn gestürzt hat, um aus ihm das Wissen über den Heimweg herauszubekommen, verwandelt sich Proteus in einen Löwen, Leoparden, Drachen und Eber. Bevor er aufgibt und Menelaos selbst anredet, nimmt er noch die Gestalt des Wassers und eines Baumes an.[5] Es ist anzunehmen, dass die Antike zumindest im direkten Vergleich mit der neuzeitlichen Rationalisierung des Wachens ein ungeheuer metamorphes Treiben gewahrte, wie es uns nur noch aus Träumen bekannt ist. Die Einheit von Alltag und Mythos ergibt keinerlei qualitative Differenzen zwischen den Verwandlungen im Traum und denen im Wachen. Die Zeit der größten Mittagshitze galt als die Stunde des Pan, in welcher die Bauern aus Furcht vor dem zentaurischen Wald- und Wiesengott ihre Felder nicht zu betreten wagten. Was damals Realität war, mutet uns heute wie ein übler Tagtraum unter der Mittelmeersonne an.
[...]
[1] Das altgriechische Verb „horaein“ (ὁράειν) bedeutet „sehen“, seine Vergangenheitsform „eidenai“ (εἰδέναι) „wissen“. Wissen ist hier noch schlicht und ergreifend die Habe des Gesehenen.
[2] Homer: Ilias und Odyssee, übers. von Johann Heinrich Voß, Frankfurt am Main 2008, S. 1359, Z. 88.
[3] Die Ethymologie ist nicht klar. Allerdings passt das Alpha privativum zum Verb „horaein“ (ὁράειν): Der Tod selbst bleibt unsichtbar hinter den Toten, die er gleichsam unsichtbar macht, das heißt in der Erde auflöst.
[4] Nietzsche, Friedrich: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (= Schlechta, Karl (Hrsg.): Friedrich Nietzsche. Werke in drei Bänden, Bd.3), München 1994, S. 319-320.
[5] Homer: Ilias und Odyssee, S. 903, Z. 456-458.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei „Seelenbefunde“ in diesem Essay?
Der Atemstillstand im Tod, das Vergessen von Träumen im Leben und das Unterlaufen von Raum und Zeit in Extremmomenten.
Wie hängen Atem und Seele begriffsgeschichtlich zusammen?
Begriffe wie „Pneuma“, „Psyche“ und „Ruach“ bedeuten ursprünglich Lebensatem oder Wind, was die Seele als unsichtbares, belebendes Prinzip markiert.
Was ist der Unterschied zwischen antiker und neuzeitlicher Wahrnehmung?
Die Antike war stark optisch orientiert, während die Neuzeit durch empirische Messungen und Rationalisierung geprägt ist, was den Seelenbegriff verdrängte.
Welche Rolle spielt der Traum für den Seelenbegriff?
Der Traum gilt als Zustand metamorpher Freiheit, der die Grenzen der rationalen Wachwelt durchbricht und einen Zugang zum „Unsichtbaren“ bietet.
Was bedeutet „genetische Phänomenologie“ in diesem Kontext?
Sie betrachtet das Körper-Seele-Problem unter der Vorbedingung konkreter Leibpraxen und menschlichen Erlebens statt rein theoretischer Spekulation.
- Citar trabajo
- Johannes Preusker (Autor), 2013, Die Greifbarkeit des Unsichtbaren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271393