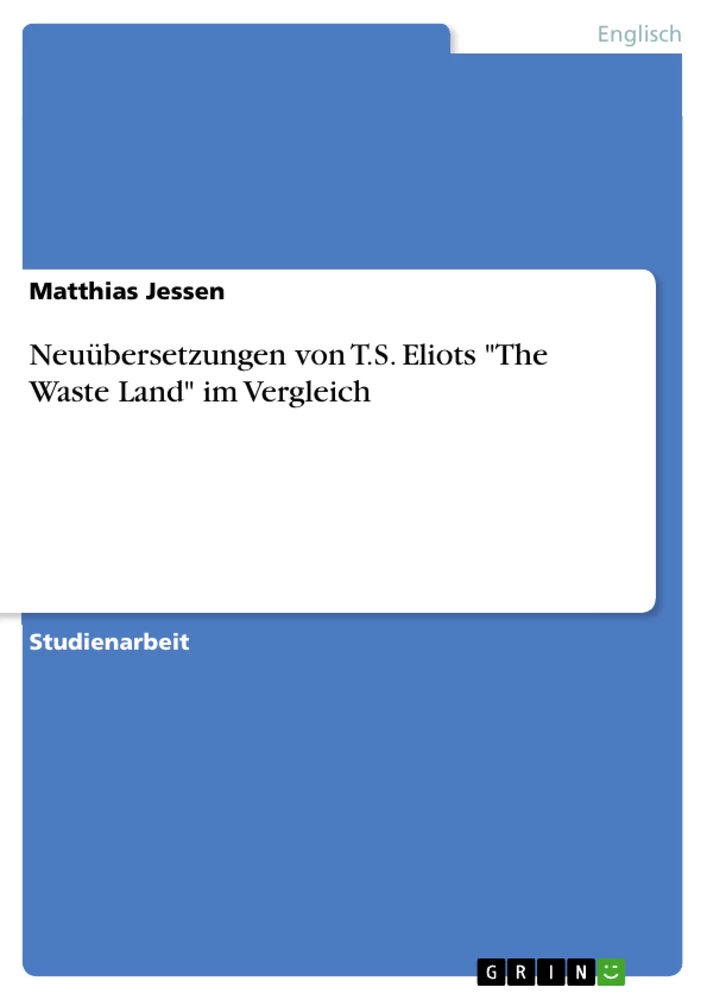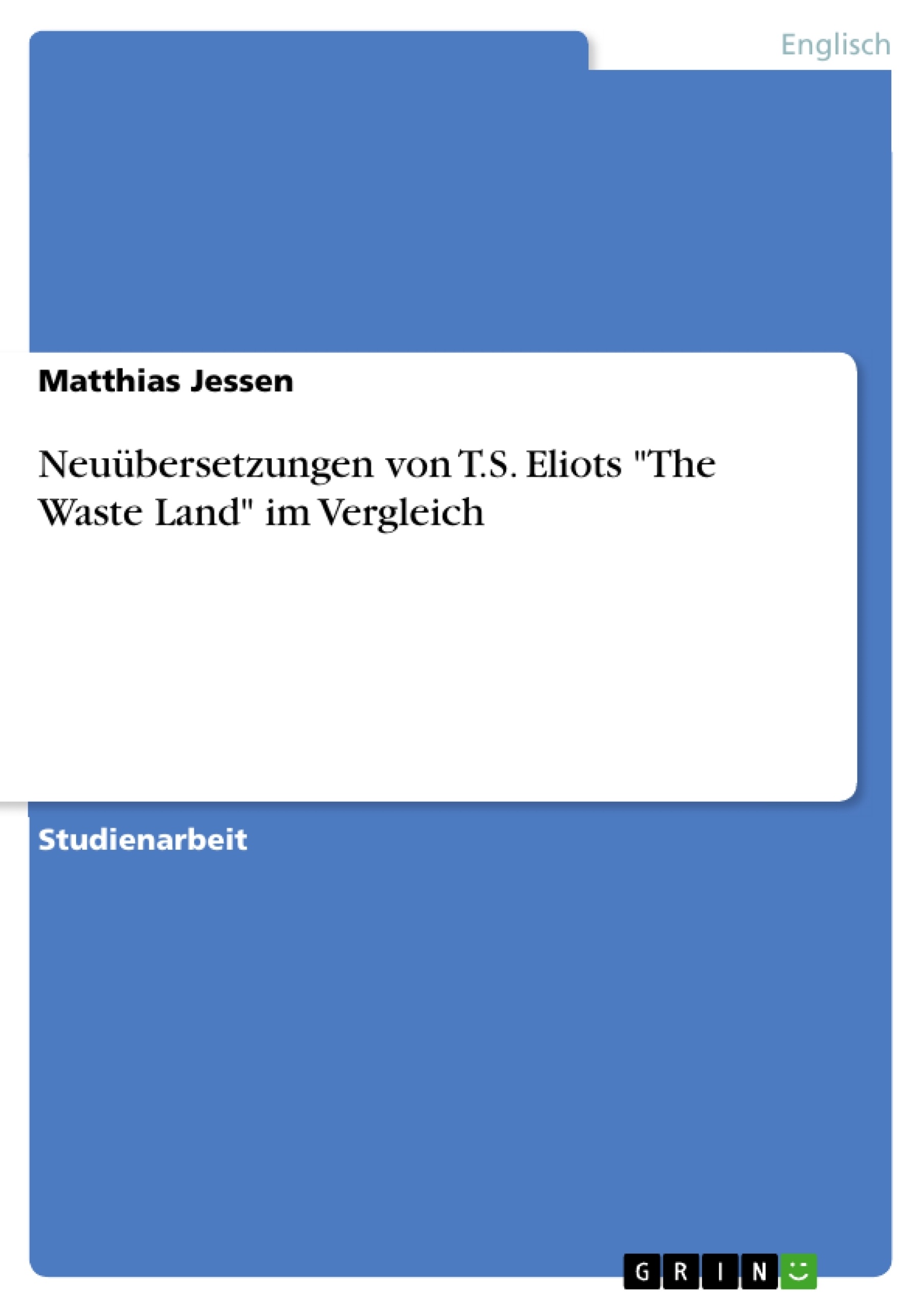Die Hausarbeit untersucht zwei deutsche Übersetzungen des epischen Langgedichts von T. S. Eliot und stellt diese in den Vergleich mit dem Original. Untersucht werden unterschiedliche Ansätze der Übersetzungswissenschaften und des Modernitätsanspruchs.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - The Waste Land (1922)
- Einleitende Worte
- T.S. Eliot als Verfasser
- Widmung, Hintergrund und Entstehungsgeschichte
- These der Hausarbeit
- Deutsche Übersetzungen
- Ernst Robert Curtius als Übersetzer (Das wüste Land, 1927)
- Zur Person
- Bezug zu T. S. Eliot und The Waste Land
- Norbert Hummelt als Übersetzer (Das öde Land, 2008)
- Zur Person
- Werk und bisherige Übersetzungen
- Vergleichende Analyse der Neuübersetzung durch Norbert Hummelt
- Entstehung der Übersetzung
- Interpretationsansatz des Übersetzers
- Titel
- Analyse der Unterschiede und Auffälligkeiten anhand theoretischer Modelle
- Equivalence
- Skopos
- Abschließende Beurteilung und persönliche Stellungnahme
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Neuübersetzung von T.S. Eliots „The Waste Land" durch Norbert Hummelt im Kontext der Übersetzungswissenschaft. Ziel ist es, die Herangehensweise des Übersetzers zu untersuchen und zu bewerten, indem die Übersetzung mit der ersten deutschen Übersetzung durch Ernst Robert Curtius verglichen wird.
- Die Herausforderungen der Übersetzung von „The Waste Land" im Kontext der Übersetzungswissenschaft
- Die Bedeutung der Intertextualität und der Verwendung von Zitaten in Eliots Werk
- Der Einfluss von kulturellen und historischen Kontexten auf die Übersetzung
- Die Rolle der Ästhetik und der sprachlichen Gestaltung in der Übersetzung
- Die Frage nach der Modernisierung und Aktualisierung von literarischen Werken in Übersetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Neuübersetzung von Norbert Hummelt vor und erläutert die Problematik der Übersetzung von „The Waste Land". Die beiden Übersetzer, Ernst Robert Curtius und Norbert Hummelt, werden vorgestellt und ihre jeweiligen Hintergründe beleuchtet. Die These der Hausarbeit wird formuliert, die besagt, dass Hummelt eine adäquate Übersetzung des Gedichts geschaffen hat.
Im zweiten Kapitel werden die beiden Übersetzungen von Curtius und Hummelt im Detail analysiert. Curtius' Übersetzung wird als eine „vergnügliche Pflicht" dargestellt, die er aus einer geistigen Verpflichtung heraus vollzog. Hummelt hingegen wird als ein Übersetzer präsentiert, der sich mit der Übersetzung von „The Waste Land" intensiv auseinandersetzte und ein Onlineprojekt zur Übersetzung des Gedichts initiierte.
Im dritten Kapitel werden die beiden Übersetzungen anhand von theoretischen Modellen der Übersetzungswissenschaft untersucht. Das Paradigma der „Equivalence" wird anhand von Beispielen aus den Übersetzungen analysiert, wobei der Fokus auf die kulturelle Bedeutung der Zeichen und Symbole liegt. Das Paradigma des „Skopos" wird ebenfalls anhand von Beispielen untersucht, wobei der Fokus auf den Zweck und die Funktion der Übersetzung liegt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Übersetzung von „The Waste Land", die Übersetzungswissenschaft, die literarische Übersetzung, die Intertextualität, die kulturelle Bedeutung, die historische Kontextualisierung, die ästhetische Gestaltung, die Modernisierung, die Aktualisierung und die beiden Übersetzer Ernst Robert Curtius und Norbert Hummelt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in T.S. Eliots „The Waste Land“?
Es ist ein bahnbrechendes episches Langgedicht der Moderne (1922), das für seine komplexe Struktur, Intertextualität und Vielzahl an Zitaten bekannt ist.
Welche deutschen Übersetzungen werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die klassische Übersetzung von Ernst Robert Curtius (1927, „Das wüste Land“) mit der Neuübersetzung von Norbert Hummelt (2008, „Das öde Land“).
Was zeichnet Norbert Hummelts Neuübersetzung aus?
Hummelt verfolgt einen modernen Interpretationsansatz und setzte sich intensiv mit der Ästhetik und den kulturellen Zeichen des Originals auseinander, unter anderem in einem Onlineprojekt.
Welche übersetzungswissenschaftlichen Modelle werden angewendet?
Die Analyse nutzt das Paradigma der „Equivalence“ (Äquivalenz von Zeichen und Symbolen) sowie den „Skopos“ (Zweck und Funktion der Übersetzung).
Wie geht Hummelt mit der Intertextualität bei Eliot um?
Die Arbeit untersucht, wie der Übersetzer die zahlreichen Zitate und Anspielungen Eliots in den deutschen Kontext überträgt, ohne die Modernität des Werks zu verlieren.
- Quote paper
- Matthias Jessen (Author), 2012, Neuübersetzungen von T.S. Eliots "The Waste Land" im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273748