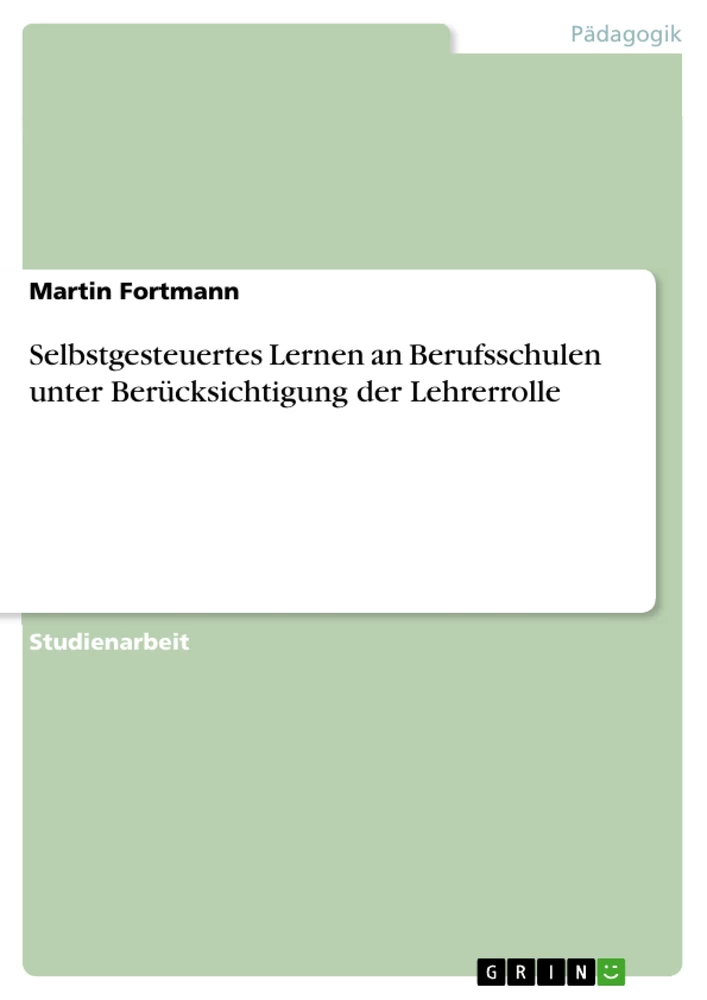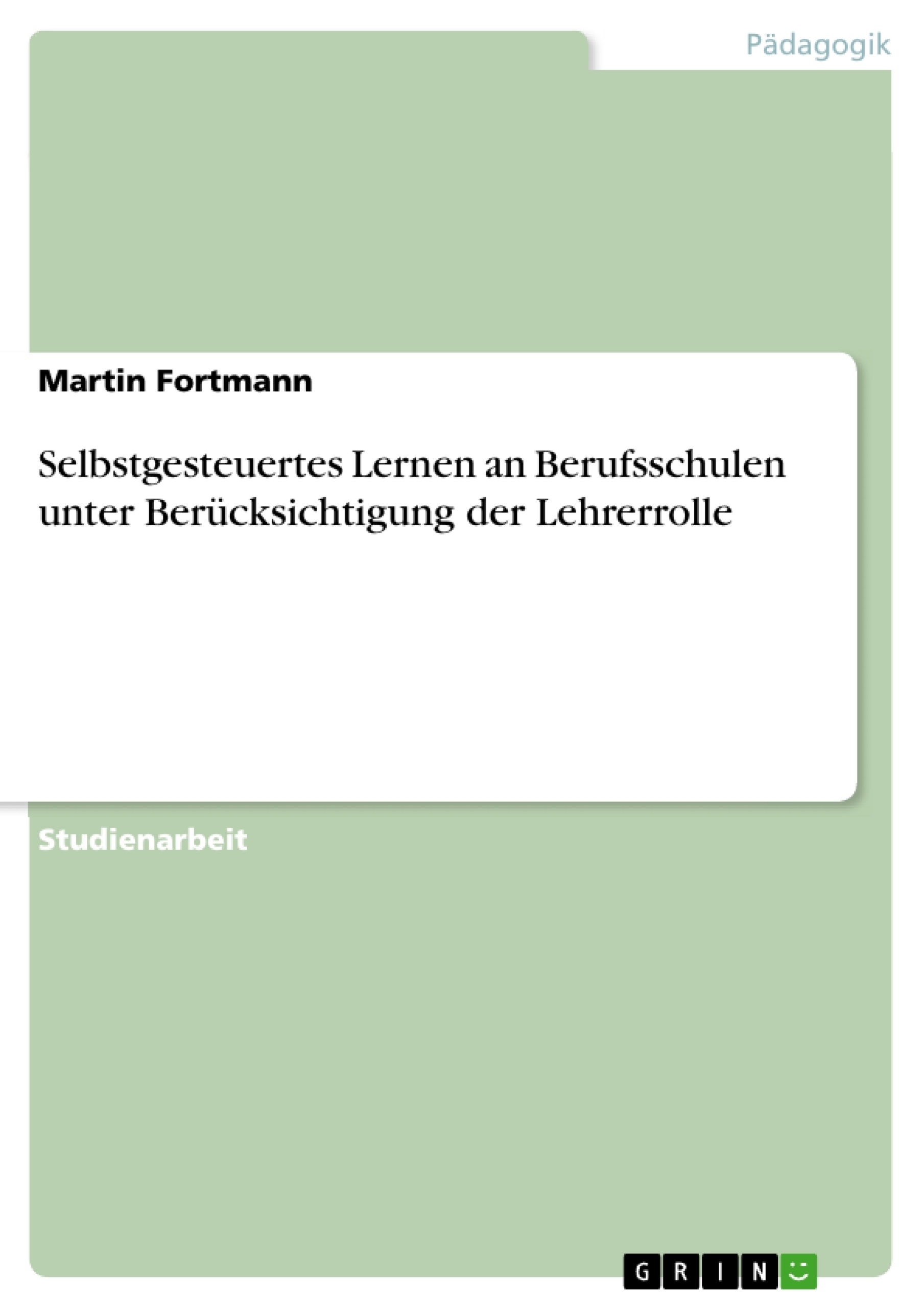Das Thema „selbstgesteuertes Lernen“ ist seit langer Zeit Diskussionsgegenstand in der beruflichen Bildung. Zunehmende wirtschaftspolitische, arbeitsorganisatorische und gesellschaftliche Veränderungen führen zu weitreichenden Auswirkungen, die auch die berufliche Bildung beeinflussen. Das System ist immer mehr geprägt durch Individualisierung, Emanzipation, ständige Veränderungen und neue Technologien. Forderungen nach hoher Flexibilität, sowie der Bereitschaft zur ständigen Wissenserweiterung und Neuerung werden gestellt. Zudem sind flacher werdende Hierarchien einhergehend mit höherer Eigenverantwortung und Eigeninitiative für die einzelnen Mitarbeiter. Die Fähigkeit zur Selbststeuerung wird immer bedeutsamer. Was aber bedeutet Selbststeuerung genau? Wie kann diese grundlegend in der Berufsbildung gefordert und gefördert werden?
Im klassischen Sinne finden in der Schule Lehr-Lern-Arrangements statt. Lehren beinhaltet, dass in bestimmter Weise, so wie es der Lehrer vorgibt, gelernt wird. mDiese klassische Rolle des Lehrers muss aufgebrochen werden, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Wie aber gestaltet sich dann die „neue“ Rolle des Lehrers? Wie ist diese definiert und welche Anforderungen werden an diese gestellt, um selbst-gesteuertes Lernen der Schüler zu ermöglichen und zu fördern, unter Berücksichtigung der Erfüllung curricularer Vorgaben, z. B. der Rahmenlehrpläne.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Was ist selbstgesteuertes Lernen?
- Komponenten des Begriffs „Selbstgesteuertes Lernen"
- Selbst I Fremdsteuerung
- Definitionsversuch zum Begriff „selbstgesteuertes Lernen"
- Anforderungen an den Lernenden
- Die Rolle des Lehrers
- Einführung in die Rolle des Lehrers
- Die „neue" Rolle des Lehrers
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Förderung von selbstgesteuertem Lernen an Berufsschulen und analysiert dabei die Rolle des Lehrers. Die Arbeit soll herausfinden, wie sich die Rolle des Lehrers gestalten muss, um selbstgesteuertes Lernen der Schüler zu ermöglichen und zu fördern, unter Berücksichtigung der Erfüllung curricularer Vorgaben.
- Definition des Begriffs „selbstgesteuertes Lernen"
- Abgrenzung zu „fremdgesteuertem Lernen"
- Anforderungen an den Lernenden
- Die „neue" Rolle des Lehrers
- Direkte und indirekte Förderung von selbstgesteuertem Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, dass selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung immer wichtiger wird, aber die klassische Lehrerrolle dieses Lernmodell behindert. Die Arbeit soll die Rolle des Lehrers in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen definieren und Empfehlungen für die Gestaltung dieser Rolle geben.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „selbstgesteuertes Lernen". Zunächst werden die Komponenten des Begriffs „Selbst" und „Steuerung" analysiert. Anschließend wird eine Abgrenzung zur Fremdsteuerung vorgenommen und ein Definitionsversuch für selbstgesteuertes Lernen unternommen. Abschließend werden die Anforderungen an den Lernenden im Kontext von selbstgesteuertem Lernen erläutert.
Kapitel 3 befasst sich mit der Rolle des Lehrers im Kontext von selbstgesteuertem Lernen. Zuerst wird die traditionelle Rolle des Lehrers im Vergleich zur „neuen" Rolle, die durch die Förderung von selbstgesteuertem Lernen gefordert wird, dargestellt. Anschließend werden die Anforderungen an die „neue" Rolle des Lehrers beleuchtet und es werden Empfehlungen für die Gestaltung dieser Rolle gegeben. Die Arbeit geht dabei auch auf die Bedeutung von Lehrerfortbildungen, die Ausstattung der Schule und die Planung von Lernumgebungen ein.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen selbstgesteuertes Lernen, Lehrerrolle, Berufsbildung, Fremdsteuerung, Lernstrategien, Lernumgebung, direkte Förderung, indirekte Förderung, metakognitive Strategien, Lehrerfortbildung, Unterrichtsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet selbstgesteuertes Lernen genau?
Selbstgesteuertes Lernen ist ein Prozess, bei dem der Lernende die Initiative ergreift, seine Lernbedürfnisse feststellt, Ziele formuliert und Lernstrategien selbstständig auswählt und umsetzt.
Wie ändert sich die Rolle des Lehrers beim selbstgesteuerten Lernen?
Der Lehrer wandelt sich vom reinen Wissensvermittler zum Lernbegleiter, Coach und Moderator. Er gestaltet Lernumgebungen, die Eigeninitiative fördern, statt nur Wissen vorzugeben.
Was ist der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdsteuerung?
Bei der Fremdsteuerung bestimmt der Lehrer Inhalt, Weg und Tempo. Bei der Selbststeuerung übernimmt der Schüler Verantwortung für diese Komponenten, was eine höhere Flexibilität und Eigeninitiative erfordert.
Welche Anforderungen werden an die Lernenden gestellt?
Lernende benötigen metakognitive Strategien, die Fähigkeit zur Selbstmotivation und die Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Lernerfolg zu übernehmen.
Wie können curriculare Vorgaben (Rahmenlehrpläne) eingehalten werden?
Durch eine geschickte Planung von Lernarrangements können Lehrer sicherstellen, dass trotz der Selbststeuerung der Schüler die notwendigen fachlichen Inhalte des Lehrplans erarbeitet werden.
- Citar trabajo
- Martin Fortmann (Autor), 2012, Selbstgesteuertes Lernen an Berufsschulen unter Berücksichtigung der Lehrerrolle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274316