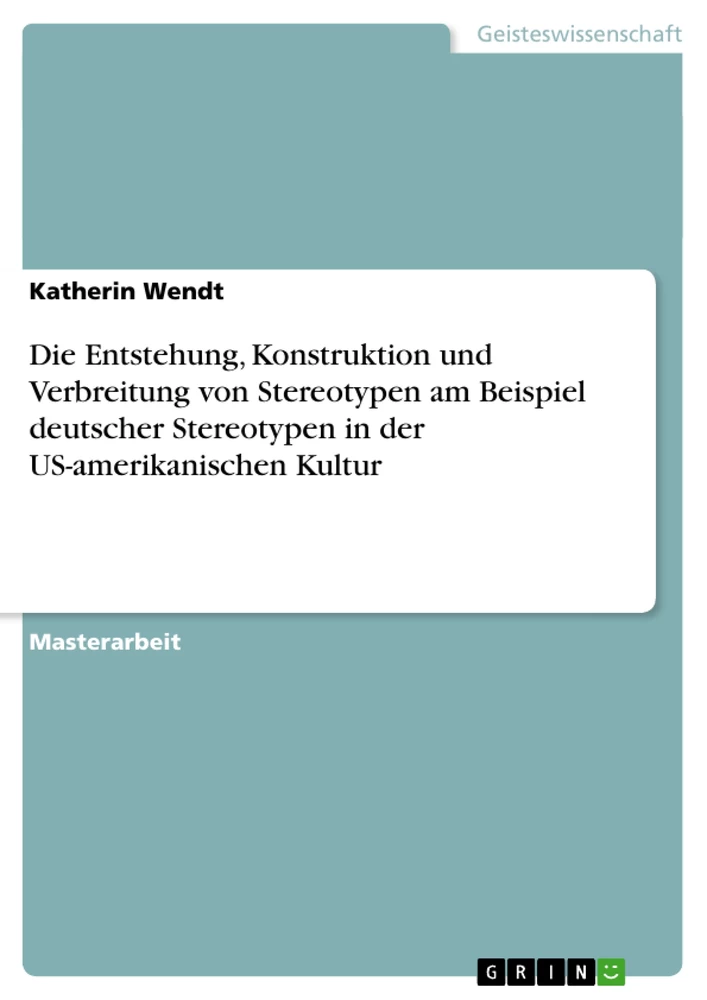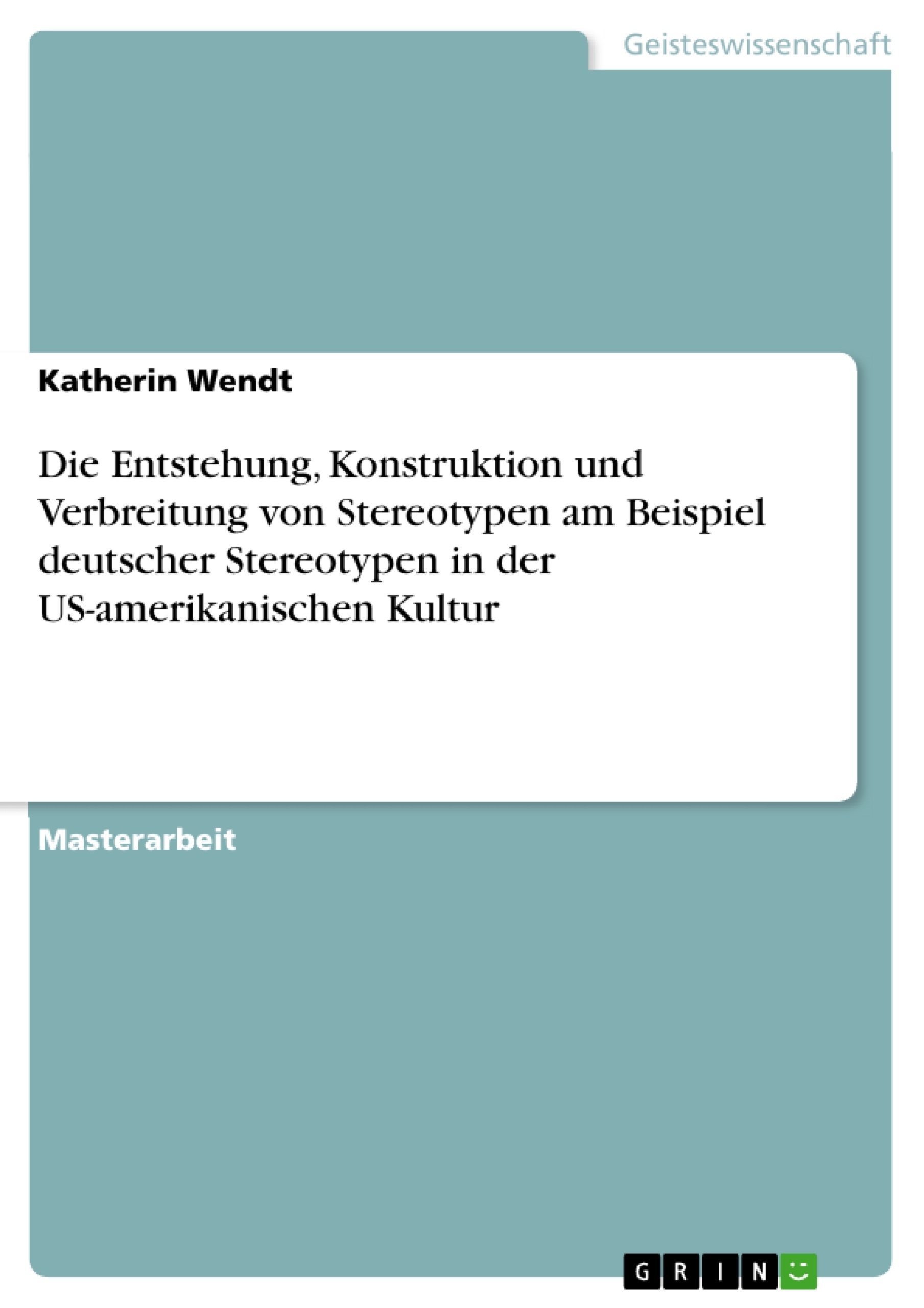Jeder Mensch kennt sie und jeder Mensch (ge)braucht sie: Stereotype. Doch inwiefern beeinflussen diese generalisierten Bilder unser eigenes Denken und Handeln? Wann fängt das stereotypische Denken an und ist es überhaupt möglich, nicht stereotypisch zu denken?
Wenn wir bewusst über Stereotype nachdenken, kommen uns die auffälligsten Karikaturen beispielsweise vom Franzosen mit Baskenmütze, von dem rothaarigen Engländer oder dem Wodka trinkenden Russen in den Sinn. In diesem Moment wissen wir, oder sollten wir wissen, dass es sich hierbei um selektive und überspitzte Darstellungen handelt, die nicht der Realität entsprechen. Doch was ist mit dezenteren, scheinbar belanglosen Vorstellungen, die so selbstverständlich scheinen, dass sie kaum als Stereotype wahrgenommen werden? Jenen Weltbildern, die uns von klein auf beigebracht und so kaum infrage gestellt werden? Wie gehen wir mit Assoziationen um, die historisch begründet sind und der Wahrheit zu entsprechen scheinen? Inwiefern haben Massenmedien Einfluss auf unser Denken und kann man überhaupt vom eigenen Denken sprechen? In dieser Arbeit werde ich unter anderem diesen Fragen auf den Grund gehen und deutlich machen, dass letztlich fast jedes Denken ein Denken in Stereotypen ist, das innerhalb einer Gruppe konstruiert, entwickelt und weitergegeben wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Zur Konstruktion von Stereotypen
- 1.1 Definitionen
- 1.2 Bedingungen und Faktoren für die Bildung von Stereotypen
- 1.3 Methodische Konstruktion von Stereotypen
- 1.4 Zur Soziologie des Fremden
- 1.4.1 Alfred Schütz über den Fremden
- 1.4.2 Alois Hahn über die soziale Konstruktion des Fremden
- 1.4.3 Rudolf Stichweh zur Soziologie der Indifferenz des Fremden
- 2 Die Funktion von Stereotypen
- 2.1 Vier wissenschaftliche Ansätze zur Funktion vom Stereotyp
- 2.2 Die kognitive Funktion von Stereotypen
- 2.2.1 Die Notwendigkeit der Kategorisierung
- 2.2.2 Der Prozess der Kategorisierung
- 2.2.3 Das Stereotyp als Rollenerwartung
- 2.2.4 Der Umgang mit unerwarteten Informationen
- 2.2.5 Die Kontext-, Kultur- und subjektive Relevanzgebundenheit von Stereotypen
- 2.2.6 Die kognitive Funktion als Mittel zur Identitätsbestimmung und Machtgewinnung
- 2.3 Die soziokulturelle Funktion von Stereotypen
- 2.3.1 Die soziale Repräsentation — der Ursprung unserer Weltbilder
- 2.3.2 Die Ingroup-Favorisierung
- 2.3.3 Verschiedene soziale Identitäten/Cross-Categories
- 2.4 Selbstkonzept oder soziale Identität — wie definieren wir uns?
- Kognitionstheorie versus Sozialwissenschaft
- 3 Kulturhistorische Gründe für deutsche Stereotype in den USA
- 3.1 Die ersten deutschen Immigranten in den USA
- 3.2 Der deutsche Einfluss in den USA
- 3.3 Imagewandel im Zuge des Bürgerkriegs
- 3.4 Der Bruch nach dem 1. Weltkrieg
- 3.4.1 Die Abschaffung des Deutschen in den USA
- 3.4.2 Der deutsche Kriegsverbrecher in der US-Presse
- 3.5 Reaktionen der US-Amerikaner auf den Zweiten Weltkrieg
- 3.6 Der Kalte Krieg
- 3.6.1 Wandlung des deutschen Images während des Ost-West-Konflikts
- 3.6.2 Erneute Zweiteilung des Deutschen
- 3.7 Die deutsch-US-amerikanische Beziehung heute
- 4 Typische Stereotype der US-Amerikaner über den Deutschen und Deutschland
- 5 Stereotype in den Massenmedien
- 5.1 Stereotype in der US-amerikanischen Zeitung und Auslandsberichterstattung
- 5.2 Stereotype im US-amerikanischen Fernsehen und Film
- 6 Deutsche Stereotype in Romanen, Briefen und Notizen US-amerikanischer Schriftsteller
- 6.1 Schönes und schreckliches Deutschland
- 6.1.1 Göttingen und Heidelberg
- 6.1.2 Das Rheinland, München und der Schwarzwald
- 6.2 Der hässliche Deutsche mit seiner Trunk- und Esssucht
- 6.3 Deutscher Fleiß und Tapferkeit
- 6.4 Ordnung und Sauberkeit
- 6.5 Der Nazi und der böse Wissenschaftler
- 6.6 Widersprüche: Das Stereotyp hängt vom Befinden des Autors ab
- 6.1 Schönes und schreckliches Deutschland
- 7 Fazit
- 7.1 Sind Stereotype falsch?
- 7.2 Können sich Stereotype verändern oder sogar abgeschafft werden?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Entstehung, Konstruktion und Verbreitung von Stereotypen am Beispiel deutscher Stereotype in der US-amerikanischen Kultur. Die Arbeit analysiert die historischen und kulturellen Faktoren, die zur Bildung dieser Stereotype beigetragen haben, sowie die Rolle der Massenmedien in ihrer Verbreitung. Ziel ist es, die komplexen Mechanismen der Stereotypisierung aufzuzeigen und zu verstehen, wie diese unser Denken und Handeln beeinflussen.
- Die Konstruktion von Stereotypen: Die Arbeit beleuchtet die Bedingungen, Faktoren und Methoden, die zur Bildung von Stereotypen führen.
- Die Funktion von Stereotypen: Die Arbeit analysiert die kognitiven und soziokulturellen Funktionen von Stereotypen, insbesondere in Bezug auf soziale Identität und Machtverhältnisse.
- Kulturhistorische Gründe für deutsche Stereotype in den USA: Die Arbeit untersucht die Entwicklung des deutschen Images in den USA von der Einwanderung der ersten deutschen Siedler bis zur Gegenwart.
- Typische Stereotype der US-Amerikaner über den Deutschen und Deutschland: Die Arbeit identifiziert und analysiert die häufigsten und aktuellsten Stereotype, die mit Deutschen und Deutschland assoziiert werden.
- Stereotype in den Massenmedien: Die Arbeit untersucht die Rolle der Massenmedien, insbesondere der Zeitung und des Films, in der Verbreitung und Perpetuierung von Stereotypen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Stereotype ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Allgegenwärtigkeit von Stereotypen und ihre prägende Rolle in unserem Denken und Handeln.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit der Konstruktion von Stereotypen. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs Stereotyp vorgestellt und die wesentlichen Merkmale des Stereotyps herausgestellt. Die Arbeit erläutert die Bedingungen und Faktoren, die zur Bildung von Stereotypen beitragen, sowie die methodischen Prozesse der Stereotypisierung. Abschließend geht das Kapitel auf die Soziologie des Fremden ein und analysiert die Theorien von Alfred Schütz, Alois Hahn und Rudolf Stichweh zur Definition des Fremden und zur Entstehung von Stereotypen.
Kapitel 2 widmet sich der Funktion von Stereotypen. Es werden vier wissenschaftliche Ansätze vorgestellt, die die Funktion von Stereotypen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten: den kognitionstheoretischen, den individualpsychologischen, den soziokulturellen und den utilitaristischen Ansatz. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die kognitiven Funktionen von Stereotypen, insbesondere auf die Notwendigkeit der Kategorisierung und die Rolle von Stereotypen als Rollenerwartungen.
Kapitel 3 untersucht die kulturhistorischen Gründe für deutsche Stereotype in den USA. Es wird die Geschichte der deutschen Einwanderung in die USA von den ersten Siedlern bis zur Gegenwart nachgezeichnet und der Einfluss der Deutschen auf die US-amerikanische Kultur beleuchtet. Die Arbeit analysiert den Imagewandel des Deutschen in den USA im Laufe der Zeit und die prägenden Ereignisse, die zu einer Veränderung des deutschen Images führten.
Kapitel 4 stellt typische Stereotype der US-Amerikaner über den Deutschen und Deutschland vor. Es werden die häufigsten und aktuellsten Stereotype analysiert, die mit Deutschen und Deutschland assoziiert werden, wie zum Beispiel der fleißige, disziplinierte und ordnungsliebende Arbeiter, der lustige Bayrische Biertrinker oder der unmenschliche Nazi.
Kapitel 5 untersucht die Rolle der Massenmedien in der Verbreitung und Perpetuierung von Stereotypen. Es werden die Funktionen der Zeitung und des Films in der Konstruktion und Übermittlung von Stereotypen analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der medialen Manipulation und die Bedeutung einer kritischen Auseinandersetzung mit den in den Medien vermittelten Bildern und Urteilen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stereotype, Konstruktion von Stereotypen, Funktion von Stereotypen, deutsche Stereotype, US-amerikanische Kultur, Geschichte der deutschen Einwanderung in die USA, Massenmedien, Auslandsberichterstattung, Film, Literatur, Kulturgeschichte, Soziologie des Fremden, soziale Identität, Ingroup-Favorisierung, Kognitionstheorie, Sozialwissenschaft.
- Quote paper
- Katherin Wendt (Author), 2012, Die Entstehung, Konstruktion und Verbreitung von Stereotypen am Beispiel deutscher Stereotypen in der US-amerikanischen Kultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274756