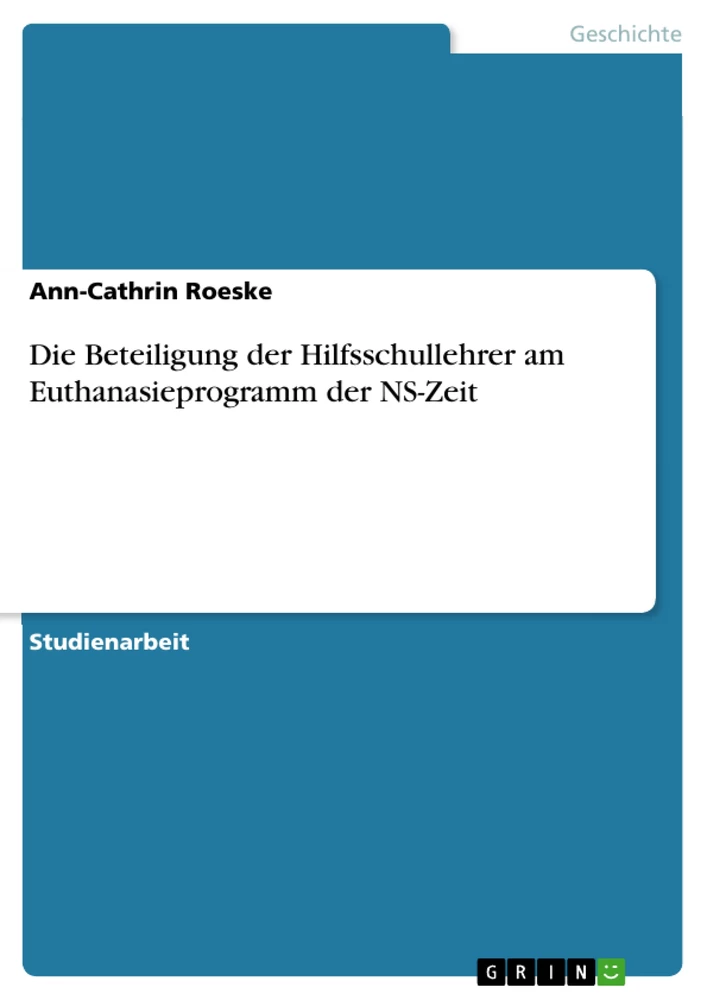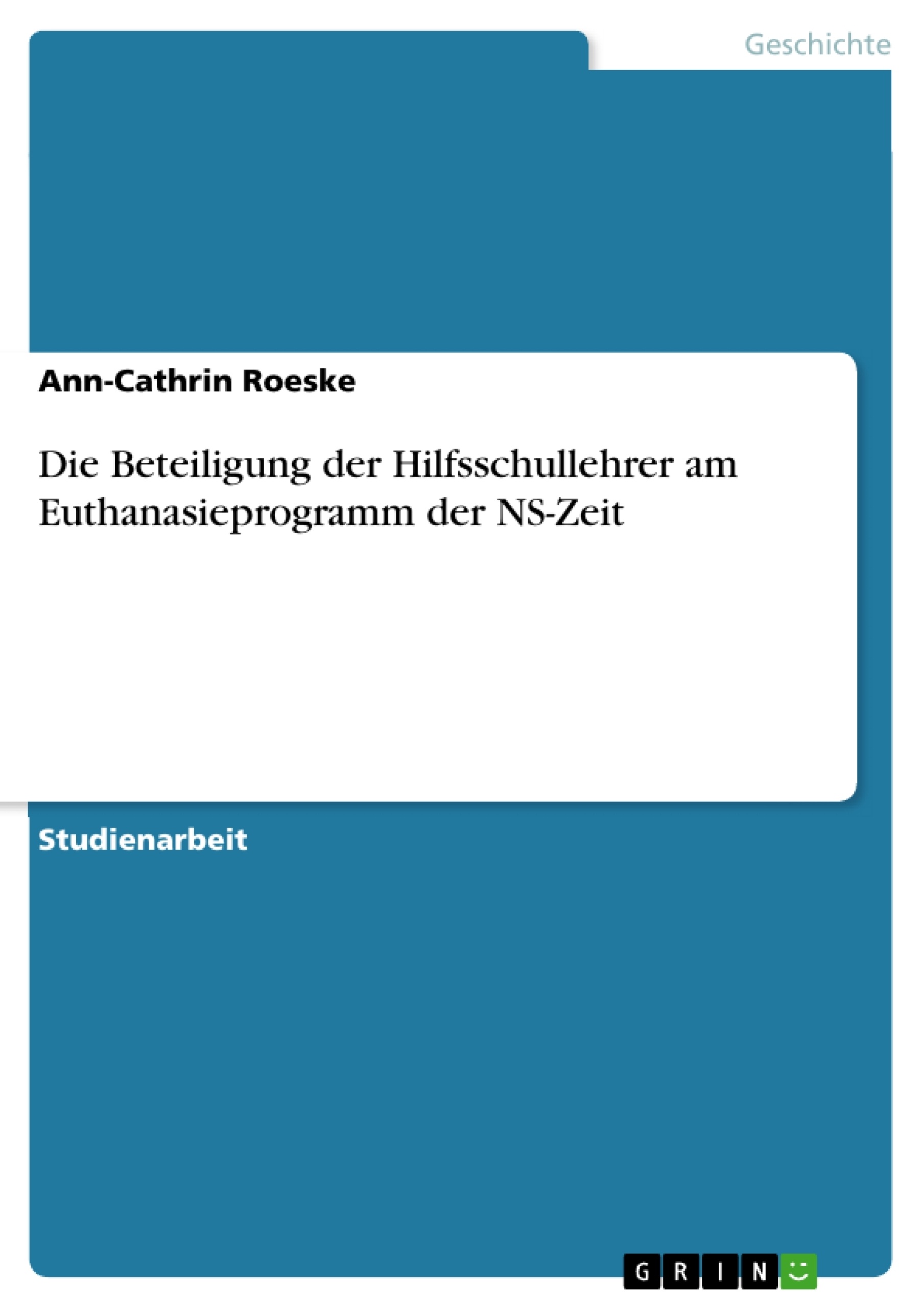Das Ziel der Arbeit ist, die Frage nach der indirekten Beteiligung der Hilfsschullehrer am Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten zu untersuchen.
Ein besonderer Fokus wird hierbei auf die Probleme in der Etablierung und Anerkennung der Hilfsschule gelegt.
Dabei wird sowohl die Entstehung der Institution Hilfsschule als auch die Situation der Hilfsschullehrer und die des Hilfsschulkindes betrachtet.
Neben der Entstehung der Hilfsschule wird die Rolle der Hilfsschule während der NS-Zeit anhand der stattgefundenen fachlichen Diskurse untersucht .
Welche Auswirkungen hatte die NS-Zeit auf die Weiterentwicklung der Hilfsschule, wie stellt sich neben der Institution Hilfsschule das Bild der Lehrerschaft und die Rolle des Hilfsschulkindes dar?
Und hat der „Anerkennungskampf“ um die Hilfsschule und den Berufsstand der Hilfsschullehrer letztendlich neben den positiven Aspekten der „Hilfe“ für Kinder mit besonderem „Förderbedarf“, also der Erfüllung des pädagogischen Auftrages, auch die politische Durchsetzung der Eugenik und der Zwangssterilisation der Hilfsschüler begünstigt und begleitet?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung der Hilfsschulen
- Die Hilfsschule in der NS-Zeit
- Erziehungs- und Bildungsideal in der NS-Zeit
- Sozialdarwinismus und eugenisches Gedankengut
- Eugenisches Gedankengut bei den Hilfsschullehrern
- Das „Schicksal“ des Hilfsschulkindes
- Die (indirekte) Beteiligung der Hilfsschullehrer am Euthanasieprogramm
- „Gewinn“ für die Hilfsschule
- Zusammenfassung und kritische Würdigung der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die indirekte Beteiligung von Hilfsschullehrern am Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten. Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderungen bei der Etablierung und Anerkennung der Hilfsschule. Die Entstehung der Hilfsschule, die Situation der Lehrer und Schüler sowie die Rolle der Hilfsschule während des Nationalsozialismus werden anhand fachlicher Diskurse analysiert. Die Arbeit beleuchtet den „Anerkennungskampf“ der Hilfsschule und die Frage, ob dieser neben positiven Aspekten auch die Durchsetzung von Eugenik und Zwangssterilisation begünstigte.
- Entstehung und Entwicklung der Hilfsschule
- Die Hilfsschule im Kontext des Nationalsozialismus
- Eugenische Ideologien und ihre Auswirkung auf die Hilfsschule
- Rolle der Hilfsschullehrer im NS-Regime
- Der „Anerkennungskampf“ der Hilfsschule und seine Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die indirekte Beteiligung von Hilfsschullehrern am NS-Euthanasieprogramm, insbesondere die Herausforderungen bei der Etablierung und Anerkennung der Hilfsschule. Sie analysiert die Entstehung der Hilfsschule, die Situation von Lehrern und Schülern im NS-Regime und den „Anerkennungskampf“, der neben positiven Aspekten möglicherweise auch eugenische Praktiken begünstigte. Die Arbeit betont die Bedeutung historischer Kenntnisse für das Verständnis gegenwärtiger pädagogischer Ansätze.
Die Entstehung der Hilfsschulen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Hilfsschule im 19. Jahrhundert. Die zunehmende Heterogenität im Schulwesen und der Leistungsdruck führten zur Herausbildung von Hilfsschulen für „leistungsschwache“ Schüler. Die Arbeit beschreibt die schwierigen Bedingungen für Volksschullehrer, die Überfüllung der Schulen und den Versuch, „schwachbegabte“ Kinder in separaten Klassen zu fördern, um die Volksschule zu entlasten. Die Hilfsschullehrer strebten nach einer eigenständigen Schulform mit besserer Bezahlung und Ansehen. Die Kritik aus dem Anstaltswesen und die hohen Kosten pro Hilfsschüler führten dazu, dass die Hilfsschullehrer das Bild des „schwachsinnigen, aber noch bildbaren“ Kindes konstruierten, um die Legitimität der Hilfsschule zu unterstreichen und die Möglichkeit der Arbeitsfähigkeit durch Hilfsschulbildung hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Hilfsschule, Nationalsozialismus, Euthanasie, Eugenik, Sozialdarwinismus, Zwangssterilisation, Inklusion, Exklusion, Behinderung, Pädagogik, Geschichte der Pädagogik, Hilfsschullehrer, „Anerkennungskampf“, Leistungsheterogenität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Hilfsschule im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die indirekte Beteiligung von Hilfsschullehrern am nationalsozialistischen Euthanasieprogramm. Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderungen bei der Etablierung und Anerkennung der Hilfsschule und deren Rolle während des Nationalsozialismus. Analysiert werden die Entstehung der Hilfsschule, die Situation von Lehrern und Schülern sowie der „Anerkennungskampf“ der Hilfsschule und dessen mögliche Auswirkungen auf die Durchsetzung von Eugenik und Zwangssterilisation.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der Hilfsschule, ihre Situation im Kontext des Nationalsozialismus, den Einfluss eugenischer Ideologien, die Rolle der Hilfsschullehrer im NS-Regime und den „Anerkennungskampf“ der Hilfsschule mit seinen Folgen. Die Arbeit beleuchtet auch die Herausforderungen bei der Etablierung und Anerkennung der Hilfsschule im 19. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung der Hilfsschulen, ein Kapitel zur Hilfsschule in der NS-Zeit (inkl. Unterkapiteln zu Erziehungs- und Bildungsidealen, Sozialdarwinismus und Eugenik, Beteiligung am Euthanasieprogramm und den „Gewinn“ für die Hilfsschule) und eine Zusammenfassung mit kritischer Würdigung.
Wie wird die Entstehung der Hilfsschule dargestellt?
Das Kapitel zur Entstehung der Hilfsschule beschreibt die Herausforderungen des 19. Jahrhunderts, die zunehmende Heterogenität im Schulwesen und den Leistungsdruck. Es beleuchtet die schwierigen Bedingungen für Volksschullehrer, die Überfüllung der Schulen und die Bemühungen, „leistungsschwache“ Kinder in separaten Klassen zu fördern. Die Arbeit erklärt auch den „Anerkennungskampf“ der Hilfsschullehrer um eine eigenständige Schulform mit besserer Bezahlung und Ansehen.
Welche Rolle spielten eugenische Ideologien?
Die Arbeit analysiert den Einfluss eugenischer Ideologien und des Sozialdarwinismus auf die Hilfsschule im Nationalsozialismus. Sie untersucht, inwiefern der „Anerkennungskampf“ der Hilfsschule möglicherweise die Durchsetzung von Eugenik und Zwangssterilisation begünstigte.
Welche Rolle spielten die Hilfsschullehrer im NS-Regime?
Die Arbeit untersucht die indirekte Beteiligung von Hilfsschullehrern am Euthanasieprogramm. Sie beleuchtet die komplexe Situation der Hilfsschullehrer und analysiert deren Handeln im Kontext der damaligen Zeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hilfsschule, Nationalsozialismus, Euthanasie, Eugenik, Sozialdarwinismus, Zwangssterilisation, Inklusion, Exklusion, Behinderung, Pädagogik, Geschichte der Pädagogik, Hilfsschullehrer, „Anerkennungskampf“, Leistungsheterogenität.
Welche Bedeutung hat diese Arbeit?
Die Arbeit betont die Bedeutung historischer Kenntnisse für das Verständnis gegenwärtiger pädagogischer Ansätze. Sie liefert wichtige Einblicke in die Geschichte der Sonderpädagogik und die Auswirkungen ideologischer Strömungen auf das Bildungssystem.
- Quote paper
- Ann-Cathrin Roeske (Author), 2014, Die Beteiligung der Hilfsschullehrer am Euthanasieprogramm der NS-Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275486