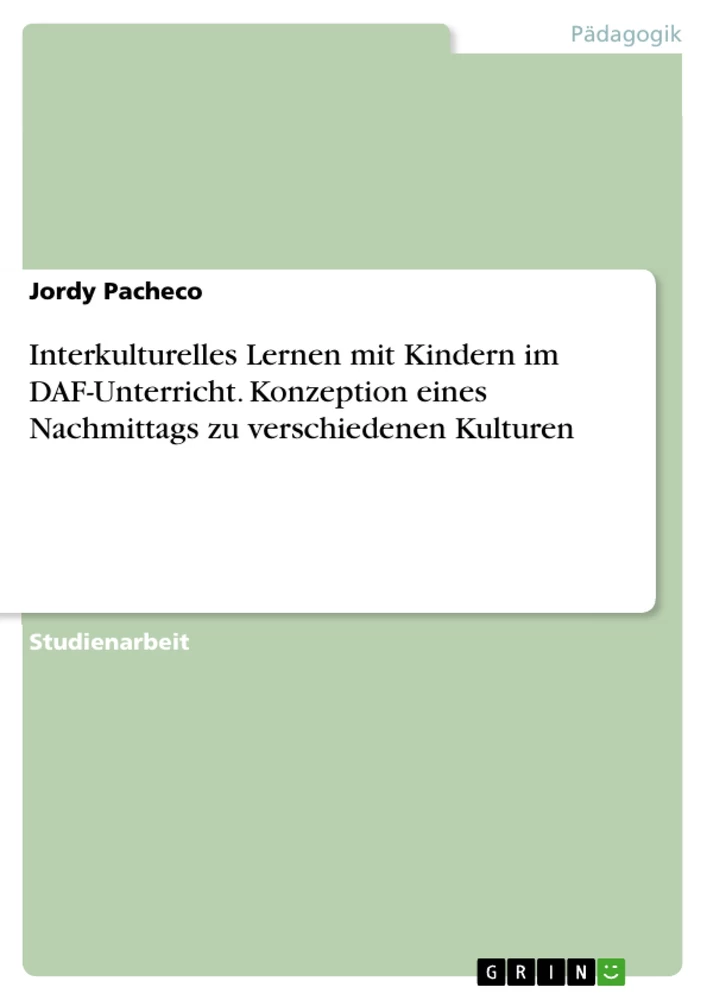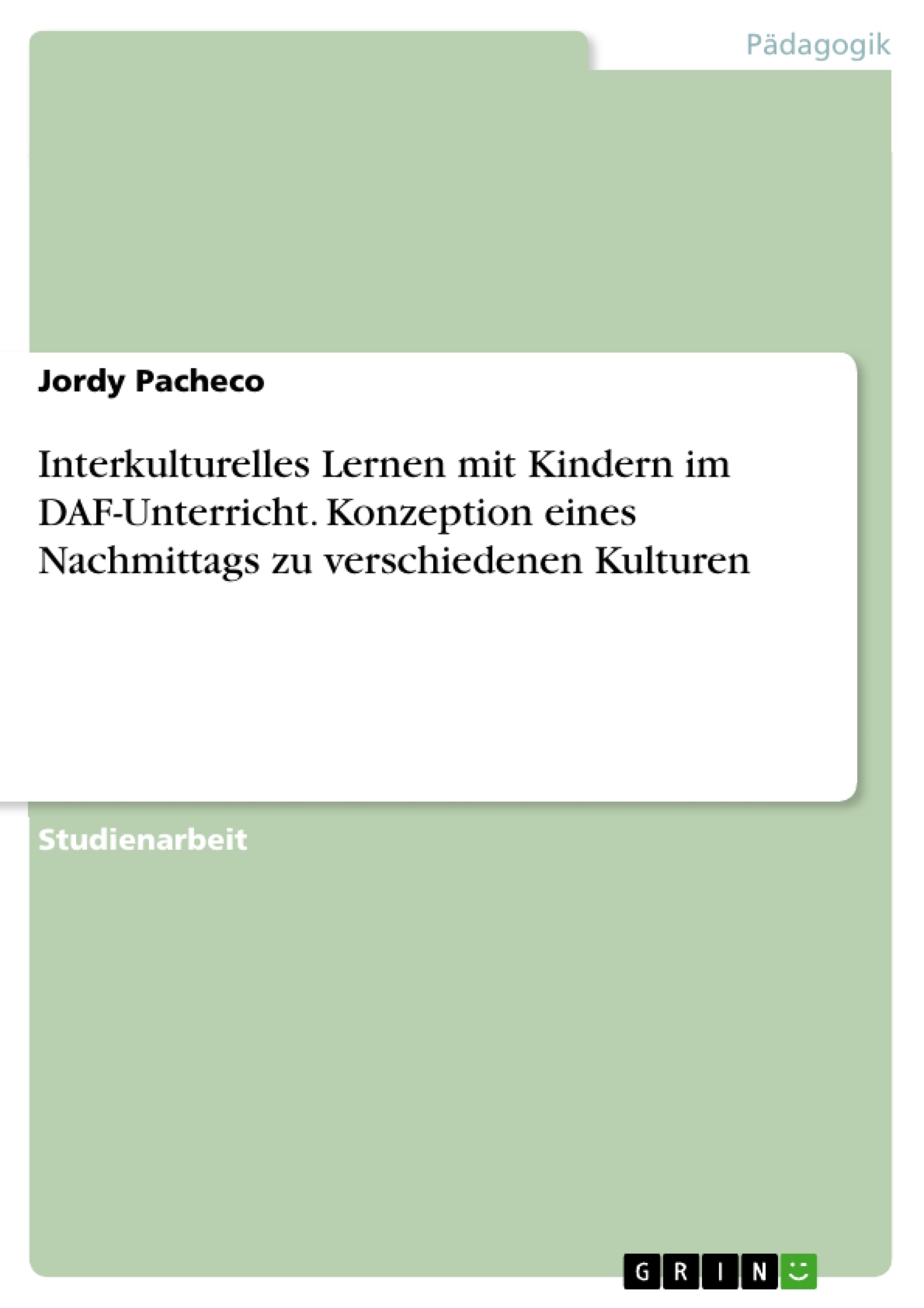Im Folgenden soll geklärt werden, was wir heute unter interkulturellem Lernen verstehen, welche Relevanz dieses für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb hat, und wie man die theoretischen Erkenntnisse praktisch in den Unterricht Deutsch als Fremdsprache mit Kindern umsetzen kann.
Die Kommunikation zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen ist nicht immer einfach, Missverständnisse sind keine Seltenheit. Häufig jedoch sind nicht fehlende Sprachkenntnisse der Auslöser dafür, sondern vielmehr zu wenig Wissen über die andere Kultur. Weil schon kleinste alltägliche Sprechhandlungen kulturell differieren können, muss beim Erlernen einer Fremdsprache wortwörtliches Übersetzen schnellstmöglich aus den Köpfen verbannt werden.
Der traditionelle Fremdsprachenunterricht jedoch stellte genau diese Methode in den Vordergrund und ließ der Wissensvermittlung über Sitten, Traditionen, Gebräuche und Lebens- bzw. Werteinstellungen der jeweiligen Zielsprache zu wenig Raum.
Der interkulturelle Ansatz nach List wandte sich schließlich gegen die Wort-für-Wort-Übersetzung und verlangt, aus der Perspektive der eigenen Kultur die fremde zu betrachten. Interkulturelles Lernen beschreibt demnach den Lern- und Lehrprozess, der den Mangel an Vermittlung kulturellen Verständnisses ausgleichen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interkulturelles Lernen: Ein Definitionsversuch
- Zum interkulturellen Lernen im DaF-Unterricht mit Kindern
- Praktische Umsetzung interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht
- Begrüßungsformeln als Beispiel interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht
- Interkulturelles Lernen anhand des Projekts: Globales Lernen mit Kindern
- Schlussfolgerung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem interkulturellen Lernen im DaF-Unterricht mit Kindern. Sie analysiert verschiedene Definitionen und Ansätze des interkulturellen Lernens und untersucht dessen Relevanz für den Fremdsprachenunterricht, insbesondere für Kinder.
- Definition und Ausprägungen des interkulturellen Lernens
- Relevanz des interkulturellen Lernens für den DaF-Unterricht
- Praktische Umsetzung im DaF-Unterricht mit Kindern
- Bedeutung der Fehlertoleranz und des Perspektivwechsels
- Förderung der interkulturellen Kompetenz durch authentische Begegnungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Kommunikation zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen dar und führt in das Thema des interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht ein. Das zweite Kapitel analysiert verschiedene Definitionen des interkulturellen Lernens, wobei die landeskundliche Ausprägung im Fokus steht. Die Relevanz des interkulturellen Lernens für den DaF-Unterricht mit Kindern wird im dritten Kapitel untersucht. Hierbei werden die Bedeutung der Lebensnähe und die Notwendigkeit der Integration des interkulturellen Lernens in den Spracherwerbsprozess betont. Das vierte Kapitel präsentiert zwei praxisnahe Beispiele für die Umsetzung des interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht: die Verwendung von Begrüßungsformeln in einem Lehrwerk und die Durchführung eines Projekts zum globalen Lernen mit Kindern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das interkulturelle Lernen, den DaF-Unterricht mit Kindern, die Vermittlung von Kultur im Fremdsprachenunterricht, die Bedeutung von Fehlertoleranz, authentische Begegnungen mit anderen Kulturen, die Förderung der interkulturellen Kompetenz, die Integration des interkulturellen Lernens in den Spracherwerbsprozess, die Verwendung von Lehrwerken und die Durchführung von Projekten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist interkulturelles Lernen im DaF-Unterricht?
Es ist ein Lehrprozess, der über das reine Vokabellernen hinausgeht und kulturelles Verständnis, Empathie sowie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel vermittelt.
Warum ist wortwörtliches Übersetzen problematisch?
Weil viele Sprechhandlungen kulturell geprägt sind; eine direkte Übersetzung kann zu Missverständnissen führen, da der kulturelle Kontext fehlt.
Wie können Begrüßungsformeln interkulturell genutzt werden?
Begrüßungen zeigen, wie unterschiedlich Höflichkeit und Distanz in verschiedenen Kulturen gehandhabt werden, und sind ein idealer Einstieg für Kinder in das Thema.
Was bedeutet Fehlertoleranz in diesem Zusammenhang?
Fehlertoleranz bedeutet, dass kulturelle Missgeschicke als Lernchance begriffen werden, um Angst vor der fremden Sprache und Kultur abzubauen.
Was ist das Ziel des "Globalen Lernens" mit Kindern?
Ziel ist es, Kindern die Vernetzung der Welt aufzuzeigen und sie für Vielfalt und globale Gerechtigkeit zu sensibilisieren.
- Quote paper
- Jordy Pacheco (Author), 2011, Interkulturelles Lernen mit Kindern im DAF-Unterricht. Konzeption eines Nachmittags zu verschiedenen Kulturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275526