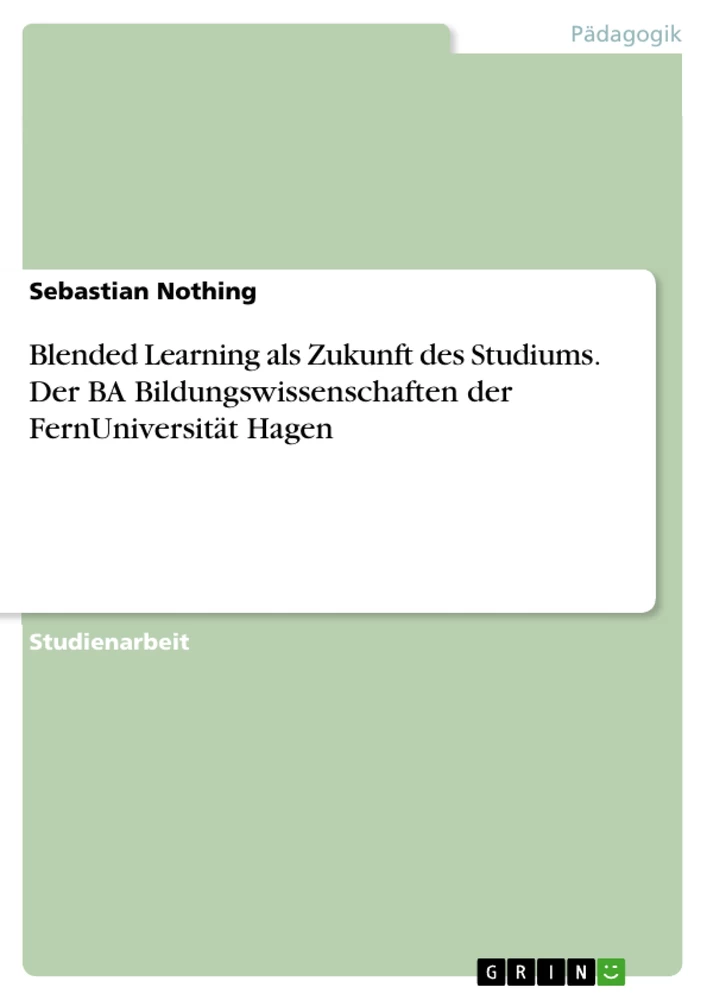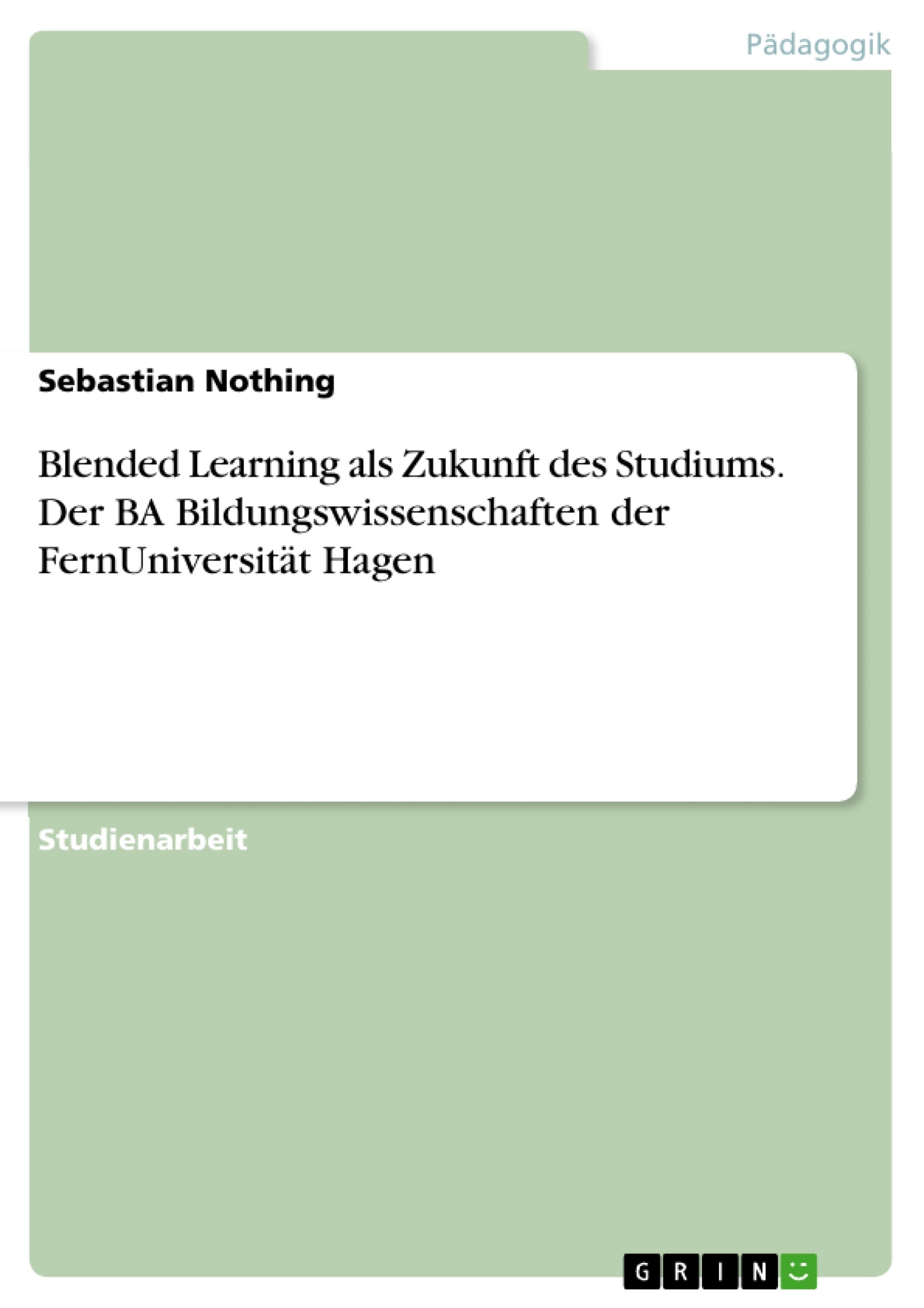Die vorliegende Hausarbeit ist thematisch in das Seminar „Neue Formate beruflicher Weiterbildung“ eingebettet. Motiviert durch verschiedene Berührungspunkte mit Studierenden der FernUniversität in Hagen wird in dieser Arbeit das Thema Blended Learning bearbeitet.
Unter der Fragestellung „Blended Learning als Zukunft des Studiums?“ wird zunächst ein Überblick über das Themenfeld e‐Learning gegeben. Eingeführt wird mit Systematisierungsansätzen zum e‐learning, um danach die e‐Learning‐Formen Computer Based Training, Web Based Training und Blended Learning sowie das Learning Content Management System vorzustellen.
Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit Blended Learning am Beispiel eines Moduls der FernUniversität in Hagen. Dazu werden die Funktionsweise und der Stellenwert von Studienbriefen, der Lernplattform Moodle und von Lern‐Apps skizziert.
Auf Grundlage dieser Darstellung werden Vor‐ und Nachteile des Blended Learning aufgezeigt.
Im Fazit soll dann die eingangs gestellte Frage, ob Blended Learning als Zukunft des Studiums angesehen werden kann, beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- E-Learning: Ein Überblick
- Systematisierungsansätze
- CBT und WBT
- Blended Learning
- Learning Content Management Systeme
- Blended Learning am Beispiel eines Moduls der Fern Universität in Hagen
- Studienbriefe
- Moodle
- Lern-Apps
- Vor- und Nachteile des Blended Learning
- Fazit
- Literatur und Quellen
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Blended Learning im Kontext des Studiums an der FernUniversität in Hagen. Sie untersucht die Frage, ob Blended Learning als zukunftsweisende Lernform im Hochschulbereich angesehen werden kann. Die Arbeit analysiert zunächst das Themenfeld E-Learning und stellt verschiedene Systematisierungsansätze, E-Learning-Formen (CBT, WBT, Blended Learning) sowie das Learning Content Management System vor. Anschließend wird Blended Learning anhand eines konkreten Moduls der FernUniversität in Hagen beleuchtet, wobei die Funktionsweise und Bedeutung von Studienbriefen, der Lernplattform Moodle und Lern-Apps im Fokus stehen. Abschließend werden die Vor- und Nachteile des Blended Learning diskutiert und die eingangs gestellte Frage nach der Zukunftsfähigkeit dieser Lernform beantwortet.
- E-Learning und seine verschiedenen Formen
- Blended Learning als hybride Lernform
- Einsatz von Blended Learning in der FernUniversität in Hagen
- Vor- und Nachteile des Blended Learning
- Zukunftsfähigkeit des Blended Learning im Hochschulbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Blended Learning ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Sie erläutert den Kontext der Hausarbeit, die im Seminar „Neue Formate beruflicher Weiterbildung" entstanden ist, und die Motivation, sich mit dem Thema Blended Learning auseinanderzusetzen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über das Themenfeld E-Learning. Es werden verschiedene Systematisierungsansätze vorgestellt, die helfen, das breite Spektrum des E-Learnings zu ordnen. Anschließend werden die E-Learning-Formen Computer Based Training (CBT), Web Based Training (WBT) und Blended Learning sowie das Learning Content Management System (LCMS) näher beleuchtet. Die Darstellung dieser E-Learning-Formen liefert den notwendigen Hintergrund, um das Blended Learning im weiteren Verlauf der Arbeit zu verstehen.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Blended Learning am Beispiel eines Moduls der FernUniversität in Hagen. Es werden die Funktionsweise und der Stellenwert von Studienbriefen, der Lernplattform Moodle und von Lern-Apps im Kontext des Blended Learning an der FernUniversität in Hagen beschrieben. Die Darstellung dieser Elemente zeigt, wie Blended Learning in der Praxis umgesetzt wird und welche Rolle die verschiedenen Komponenten spielen.
Das vierte Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile des Blended Learning. Es werden die Vorteile dieser Lernform, wie beispielsweise die Flexibilität, die Individualisierung und die Möglichkeit zur Selbststeuerung, sowie die Nachteile, wie beispielsweise die fehlende Interaktion und die technische Ausstattung, diskutiert. Die Darstellung der Vor- und Nachteile soll ein umfassendes Bild des Blended Learning zeichnen und die Diskussion über die Zukunftsfähigkeit dieser Lernform vorbereiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Blended Learning, E-Learning, Fernstudium, FernUniversität in Hagen, Studienbriefe, Moodle, Lern-Apps, Vorteile, Nachteile, Zukunftsfähigkeit, Hochschulbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Blended Learning?
Blended Learning ist eine hybride Lernform, die klassische Präsenzveranstaltungen oder gedruckte Studienmaterialien mit digitalen E-Learning-Angeboten kombiniert.
Wie setzt die FernUniversität Hagen Blended Learning um?
Die Universität nutzt eine Kombination aus gedruckten Studienbriefen, der Online-Lernplattform Moodle und ergänzenden Lern-Apps.
Was sind die Vorteile von Blended Learning im Studium?
Zu den Vorteilen zählen eine höhere zeitliche und örtliche Flexibilität, die Möglichkeit zur individuellen Lerngeschwindigkeit und die Förderung der Selbststeuerung.
Welche Nachteile gibt es beim Blended Learning?
Mögliche Nachteile sind eine reduzierte soziale Interaktion („Einsamkeit des Fernstudenten“) sowie die Abhängigkeit von einer stabilen technischen Ausstattung.
Was unterscheidet CBT von WBT?
Computer Based Training (CBT) erfolgt meist offline über Datenträger, während Web Based Training (WBT) über das Internet oder ein Intranet bereitgestellt wird.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Nothing (Autor:in), 2012, Blended Learning als Zukunft des Studiums. Der BA Bildungswissenschaften der FernUniversität Hagen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276274