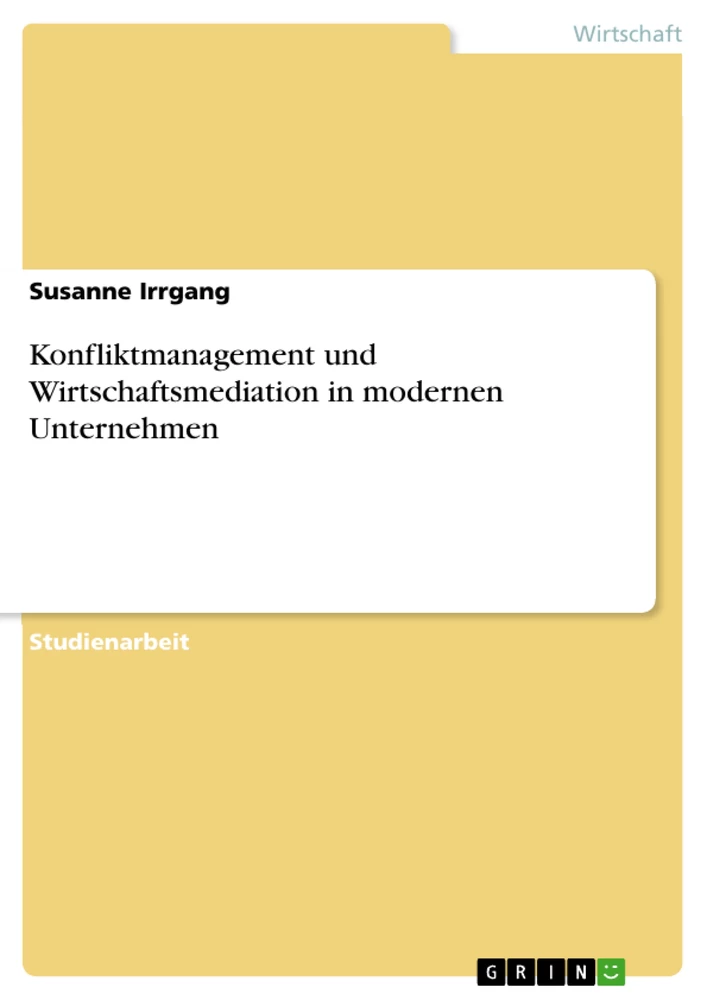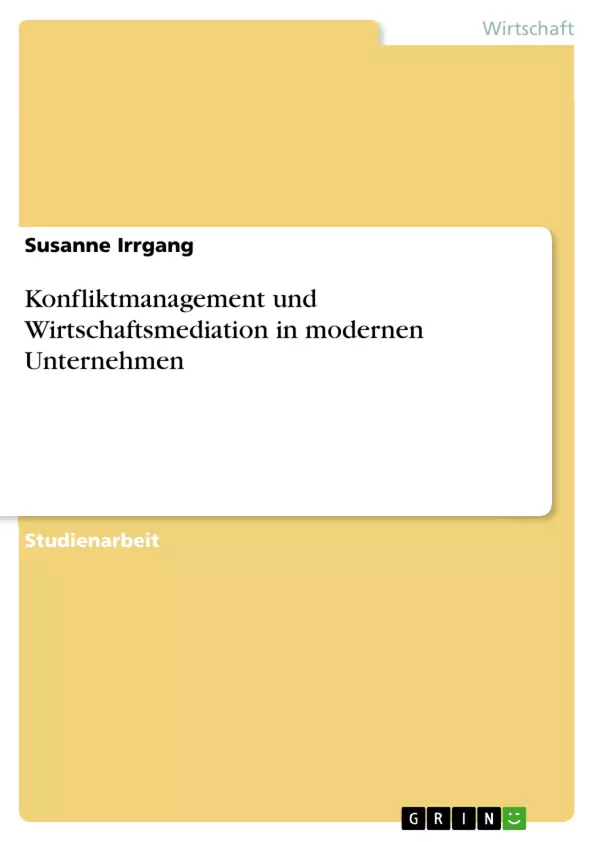Konflikte sind Element allen Lebens und besitzen eine „hervorragende schöpferische Kraft“, sind sie doch ein natürliches und zutiefst notwendiges Phänomen im zwischenmenschlichen Miteinander. Wo sie fehlen, unterdrückt oder nur scheinbar gelöst werden, halten sie den Wandel auf bzw. reduzieren ihn. Werden sie stattdessen akzeptiert und konstruktiv verarbeitet, bleibt der Prozess stetigen Wandels sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung erhalten. Gerade weil es ihnen gelingt über den Status quo hinauszuweisen, sind Konflikte ein essentielles Lebenselement der Gesellschaft: Konflikt ist Leben.
Mediation ist ein Verfahren des modernen Konfliktmanagements, wenngleich der Mediationsgedanke an sich, eine sehr alte Methode der Konfliktlösung – insbesondere in China und Japan - darstellt. Speziell in China wird es als Schande angesehen, Gerichte zur Klärung persönlicher Belange in Anspruch nehmen zu müssen. In der chinesischen Volksrepublik leben derzeit fünfmal so viele Menschen wie in den Vereinigten Staaten, dennoch genügen 5% der Rechtsanwälte, die in den USA erforderlich sind.
im ersten Abschnitt dieser Arbeit werden grundlegende Aspekte, auf denen die Arbeit aufbaut, vorab abgehandelt und erläutert. Dazu zählt zunächst die Definition des Begriffs „Mediation“. Ferner soll die Rolle des Mediators aufgegriffen & die dafür erforderlichen Kompetenzen aufgezeigt werden. Da die Mediation ein Instrument zur Konfliktlösung ist, komplettiert die Darstellung dieser Konfliktproblematik den ersten Abschnitt. Im zweiten Gliederungskomplex stehen Fragen der Implementierung von Mediationsverfahren in modernen Unternehmen im Fokus. Es wird geschildert in welchen Anwendungsfeldern ein solches Verfahren empfehlenswert ist und welche Gestaltungsprinzipien das Unternehmen berücksichtigen sollte. Darüber hinaus sollen die Vorteile die der Unternehmung durch die Implementierung von Mediation erwachsen, aber auch die Nachteile und Grenzen, auf welche ein Unternehmen stoßen kann, aufgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlegung
- Einleitung
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Charakteristika der Mediation
- Konfliktdimensionen
- Konfliktmanagement im modernen Unternehmen
- Bedeutung der Wirtschaftsmediation
- Prinzipien und deren Grenzen in der wirtschaftlichen Mediation
- Anwendungsfelder der Wirtschaftsmediation
- Gestaltungsprinzipien für Konfliktmanagementsysteme
- Mediation als Komponente des betrieblichen Konfliktmanagements
- Vorteile und Nachteile von Wirtschaftsmediation
- Fazit und Ausblick
- Selbstreflexion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Wirtschaftsmediation und Selbstreflexion. Ziel ist es, die Bedeutung der Mediation im modernen Unternehmenskontext zu beleuchten und die Rolle der Selbstreflexion im Umgang mit Konflikten zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Charakteristika der Mediation, ihre Prinzipien und Grenzen sowie ihre Anwendungsfelder in der Wirtschaft. Darüber hinaus werden die Vorteile und Nachteile der Wirtschaftsmediation sowie die Gestaltungsprinzipien für Konfliktmanagementsysteme betrachtet.
- Bedeutung der Mediation im modernen Unternehmenskontext
- Anwendungsfelder der Wirtschaftsmediation
- Gestaltungsprinzipien für Konfliktmanagementsysteme
- Vorteile und Nachteile der Wirtschaftsmediation
- Rolle der Selbstreflexion im Umgang mit Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Mediation ein und erläutert die Bedeutung von Konflikten als Motor des Wandels. Sie stellt die Mediation als ein Verfahren des modernen Konfliktmanagements vor und beleuchtet die historische Entwicklung des Mediationsgedankens.
Das Kapitel „Ziel und Aufbau der Arbeit" beschreibt die Struktur der Seminararbeit und die einzelnen Gliederungspunkte. Es werden die Schwerpunkte der Arbeit und die Forschungsfragen vorgestellt.
Das Kapitel „Charakteristika der Mediation" definiert den Begriff der Mediation und erläutert die Rolle des Mediators. Es werden die Kompetenzen eines Mediators sowie die verschiedenen Konfliktdimensionen dargestellt.
Das Kapitel „Konfliktmanagement im modernen Unternehmen" befasst sich mit der Bedeutung der Wirtschaftsmediation im Unternehmenskontext. Es werden die Prinzipien und Grenzen der Mediation in der Wirtschaft sowie die Anwendungsfelder der Wirtschaftsmediation erläutert. Darüber hinaus werden die Gestaltungsprinzipien für Konfliktmanagementsysteme und die Vorteile und Nachteile der Wirtschaftsmediation für Unternehmen betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wirtschaftsmediation, Selbstreflexion, Konfliktmanagement, Konfliktlösung, Unternehmen, Mediationsprinzipien, Anwendungsfelder, Vorteile, Nachteile, Gestaltungsprinzipien, Konfliktdimensionen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Wirtschaftsmediation?
Wirtschaftsmediation ist ein strukturiertes Verfahren zur außergerichtlichen Konfliktlösung in Unternehmen, bei dem ein neutraler Dritter (Mediator) die Parteien bei der Lösungsfindung unterstützt.
Warum gelten Konflikte als "essentielles Lebenselement" in Unternehmen?
Konflikte weisen über den Status quo hinaus und können bei konstruktiver Verarbeitung als Motor für Innovation, Wandel und Weiterentwicklung dienen.
Welche Rolle hat ein Mediator im Konfliktmanagement?
Der Mediator ist kein Richter, sondern ein neutraler Vermittler. Er strukturiert das Gespräch, fördert das gegenseitige Verständnis und hilft, interessengerechte Lösungen zu finden.
Was sind die Vorteile von Mediation gegenüber Gerichtsverfahren?
Vorteile sind unter anderem Zeit- und Kostenersparnis, die Vertraulichkeit des Verfahrens sowie die Erhaltung der Geschäftsbeziehung durch einvernehmliche Lösungen.
Was sind die Grenzen der Wirtschaftsmediation?
Grenzen bestehen dort, wo eine Partei nicht freiwillig teilnimmt, strafrechtliche Tatbestände vorliegen oder ein Machtungleichgewicht eine faire Verhandlung unmöglich macht.
- Quote paper
- Susanne Irrgang (Author), 2004, Konfliktmanagement und Wirtschaftsmediation in modernen Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280980