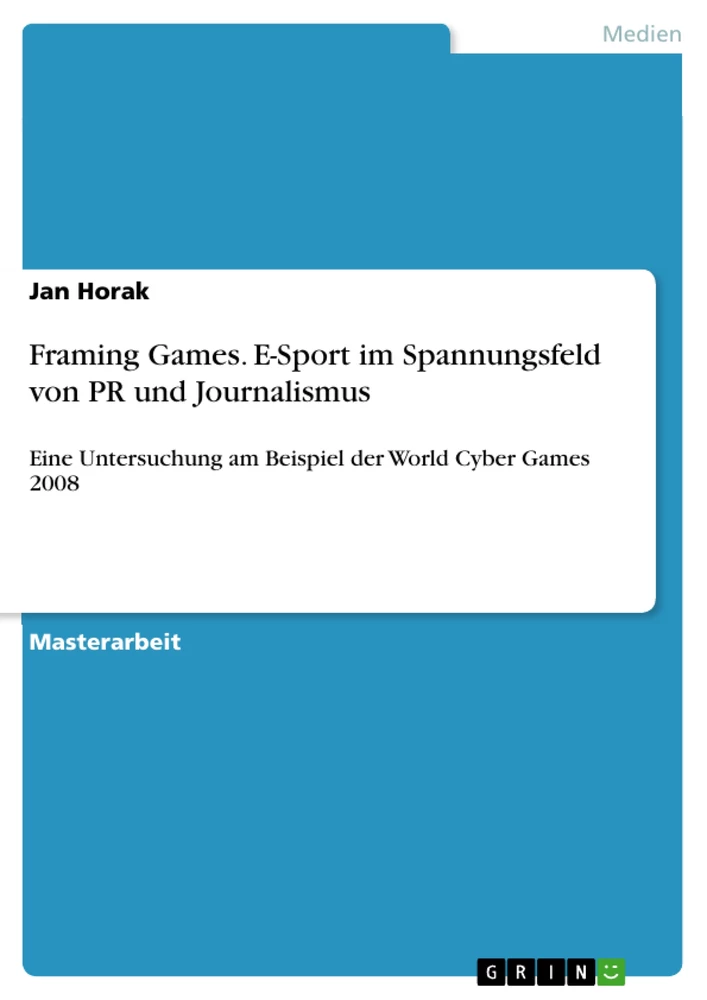Im Rahmen dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie erfolgreiche PR-Kommunikation in Bezug auf E-Sport-Themen gelingen kann und welche Herausforderungen dabei zu meistern sind. Den konkreten Untersuchungsgegenstand bilden die kommunikativen Rahmenprozesse der World Cyber Games 2008 in Köln. Es handelt sich bei den World Cyber Games um ein jährlich an wechselnden Austragungsorten rund um den Globus stattfindendes, öffentlichkeitswirksames E-Sport-Großereignis, welches als solches entsprechende Würdigung in den Massenmedien erfährt. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Berichterstattung über digitale Spiele und ihre Nutzer in den vergangenen Jahren primär durch Schadenswirkungsdebatten geprägt war, ist hier die Frage, wie und mit welchem Ergebnis die veranstalterseitig beauftragten PR-Kommunikatoren in diesem schwierigen kommunikativen Umfeld agierten, von besonderem Interesse. Dies wird im Rahmen dieser Arbeit anhand eines Leitfadeninterviews mit den verantwortlichen PR-Akteuren sowie einer Vergleichsanalyse des schriftlichen PR-Materials und der Printberichterstattung systematisch herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung.
- 2. Forschungsziele und Methodik.
- 3. Forschungsstand.
- 3.1 Digitale Spiele
- 3.1.1 Begriffsklärung und Medialität.
- 3.1.2 Die unterhaltungsindustrielle Bedeutung digitaler Spiele.
- 3.1.3 Befunde der Nutzungsforschung..
- 3.1.4 Digitale Spiele im Fokus öffentlicher Diskurse.
- 3.1.5 Befunde der Wirkungsforschung.
- 3.2 E-Sport
- 3.2.1 Digitales Spielen als Sport.
- 3.2.2 Strukturen und Charakteristika
- 3.2.3 Die World Cyber Games.
- 3.3 Zwischenfazit ........
- 3.1 Digitale Spiele
- 4. Theoretischer Rahmen........
- 4.1 Public Relations als strategische Kommunikationshandlung
- 4.1.1 Public Relations: Definition und Verortung.
- 4.1.2 Zentrale Begriffsklärungen
- 4.1.3 Public Relations und Journalismus..
- 4.1.4 Evaluation strategischer Kommunikation
- 4.2 Framing als kommunikationstheoretisches Konzept..
- 4.2.1 Framing: Definition und Verortung.......
- 4.2.2 Framing als Strategie der Public Relations
- 4.2.3 Framing im Journalismus...
- 4.2.4 Messmethodik..
- 4.3 Zwischenfazit
- 4.1 Public Relations als strategische Kommunikationshandlung
- 5. Strategisches Framing in der PR-Praxis...........
- 5.1 Untersuchungsdesign
- 5.1.1 Untersuchungsanlage.
- 5.1.2 Gesprächspartner.
- 5.1.3 Forschungsfragen und Hypothesen
- 5.1.4 Operationalisierung....
- 5.1.5 Durchführung.
- 5.2 Ergebnisse..........
- 5.2.1 Rolle und Selbstbild des Kommunikators.
- 5.2.2 Kommunikationsziele.
- 5.2.3 Kernbotschaften......
- 5.2.4 Kommunikationsstrategien
- 5.2.5 Kommunikative Praxis
- 5.2.6 Kampagnen-Evaluation
- 5.3 Zwischenfazit....
- 5.1 Untersuchungsdesign
- 6. Die textuelle Manifestation strategischer Frames..
- 6.1 Untersuchungsdesign
- 6.1.1 Untersuchungsanlage....
- 6.1.2 Grundgesamtheit und Stichprobenverfahren
- 6.1.3 Forschungsfragen und Hypothesen
- 6.1.4 Operationalisierung
- 6.1.5 Pretest
- 6.2 Ergebnisse.......
- 6.2.1 Fallzusammensetzung und formale Charakteristika
- 6.2.2 Veröffentlichungen im Zeitverlauf.
- 6.2.3 Themenspezifische Darstellung
- 6.2.4 Akteure
- 6.2.5 Framing..
- 6.3 Zwischenfazit.
- 6.1 Untersuchungsdesign
- 7. Diskussion.........
- Quellenverzeichnis.......
- Anhang......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der strategischen Kommunikation im Bereich des E-Sports, genauer gesagt mit der Frage, wie erfolgreiche PR-Kommunikation in Bezug auf E-Sport-Themen gelingen kann. Die Arbeit analysiert die kommunikativen Rahmenprozesse der World Cyber Games 2008 in Köln, einem jährlich stattfindenden, öffentlichkeitswirksamen E-Sport-Großereignis.
- Die Arbeit untersucht die Rolle und das Selbstbild der PR-Kommunikatoren im Kontext der World Cyber Games 2008.
- Sie analysiert die Kommunikationsziele und Kernbotschaften der PR-Kampagne.
- Die Arbeit beleuchtet die Kommunikationsstrategien und die kommunikative Praxis der PR-Akteure.
- Sie untersucht die textuelle Manifestation strategischer Frames in der PR-Kommunikation und der Medienberichterstattung.
- Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen der PR-Kommunikation im Spannungsfeld von E-Sport und Journalismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema E-Sport und beleuchtet die zunehmende Bedeutung digitaler Spiele in der Unterhaltungsindustrie. Sie stellt die World Cyber Games als ein wichtiges E-Sport-Großereignis vor und erläutert die Forschungsfrage, wie PR-Kommunikation in Bezug auf E-Sport-Themen gelingen kann.
Kapitel 3 bietet einen umfassenden Forschungsstand zu digitalen Spielen und E-Sport. Es werden die Begrifflichkeiten geklärt, die wirtschaftliche Bedeutung der Spieleindustrie beleuchtet und die Ergebnisse der Nutzungs- und Wirkungsforschung dargestellt.
Kapitel 4 stellt den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Es werden die Konzepte der Public Relations und des Framings erläutert und deren Bedeutung für die strategische Kommunikation im Kontext von E-Sport-Themen hervorgehoben.
Kapitel 5 analysiert die strategischen Frames, die von den PR-Akteuren der World Cyber Games 2008 eingesetzt wurden. Es werden die Kommunikationsziele, Kernbotschaften und Strategien der PR-Kampagne untersucht.
Kapitel 6 untersucht die textuelle Manifestation strategischer Frames in der PR-Kommunikation und der Medienberichterstattung. Es werden die formalen Charakteristika der Veröffentlichungen, die themenspezifische Darstellung und die Akteure analysiert.
Kapitel 7 diskutiert die Ergebnisse der Arbeit und zieht Schlussfolgerungen für die PR-Kommunikation im Bereich des E-Sports.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen E-Sport, Public Relations, Framing, World Cyber Games, Medienberichterstattung, strategische Kommunikation, digitale Spiele, Unterhaltungsindustrie, Kommunikationsziele, Kernbotschaften, Kommunikationsstrategien, kommunikative Praxis, textuelle Manifestation, Herausforderungen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist „Framing“ in der PR-Kommunikation?
Framing bezeichnet das gezielte Einbetten von Informationen in einen Deutungsrahmen, um die Wahrnehmung eines Themas (z.B. E-Sport als Sport statt als Suchtfaktor) zu beeinflussen.
Welche Herausforderungen gibt es bei der PR für E-Sport?
Die Berichterstattung ist oft durch Schadenswirkungsdebatten („Killerspiele“) geprägt. PR-Akteure müssen aktiv gegen diese negativen Frames arbeiten.
Was waren die World Cyber Games 2008?
Ein internationales E-Sport-Großereignis in Köln, das als Fallstudie für erfolgreiche strategische Kommunikation und Medienresonanz in dieser Arbeit dient.
Wie hängen PR und Journalismus im E-Sport zusammen?
PR-Akteure versuchen, Journalisten mit positiven Kernbotschaften zu versorgen, während der Journalismus zwischen kritischer Distanz und der Übernahme dieser Frames schwankt.
Was ist das Ziel der Kampagnen-Evaluation im E-Sport?
Es wird gemessen, inwieweit die gesetzten PR-Frames (z.B. E-Sport als Hochleistungssport) tatsächlich in der Medienberichterstattung übernommen wurden.
- Quote paper
- Master of Arts Jan Horak (Author), 2013, Framing Games. E-Sport im Spannungsfeld von PR und Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282356