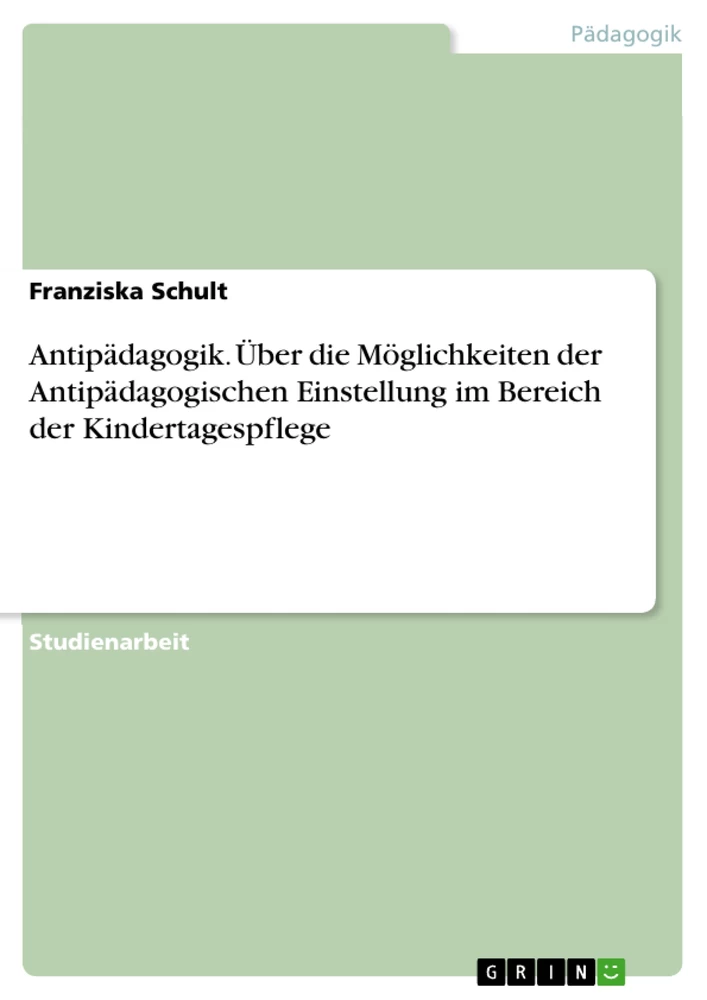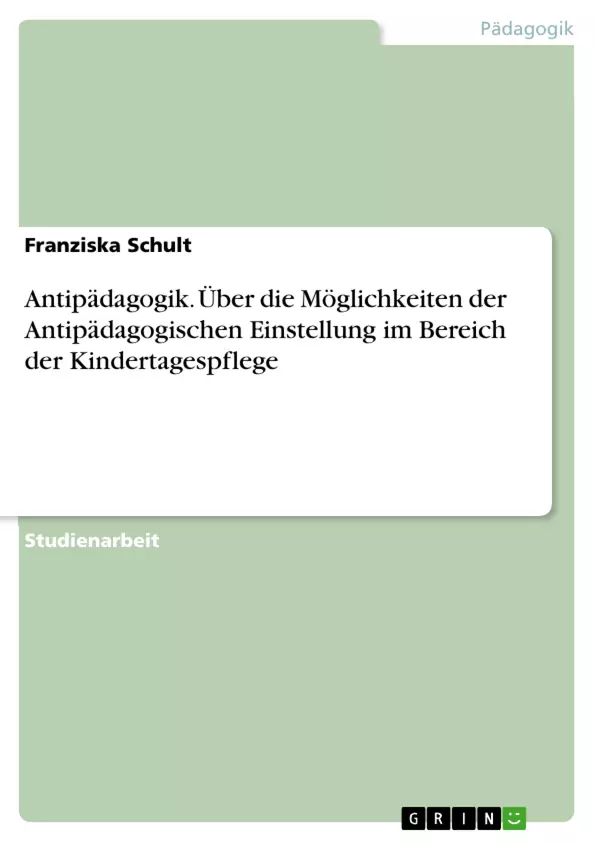Schaut man sich den sächsischen Bildungsplan an, dann kann man immer wieder lesen, dass neben der Bildung auch die Erziehung eine große Rolle in der fachlichen Qualitätserhebung in der Arbeit einer Tagespflegeperson spielt. Hat man sich mit dem Begriff „Erziehung“ noch nie kritisch auseinandergesetzt, dann fühlt sich diese Forderung nach beispielsweise der frühkindlichen Erziehung ganz alltäglich und normal an.
Als ich jedoch in einem Buch von Alice Miller las, jede Form von Erziehung sei Bevormundung, habe ich große Zweifel bekommen, wie ein richtiger Umgang mit Kindern aussehen muss und welche Rolle die Erziehung dann noch spielen sollte. In diesem Zusammenhang beschäftigte ich mich auch mit dem Phänomen des Wiederholungszwanges. Demzufolge ist der Umgang mit Kindern sehr stark geprägt, von den eigenen frühkindlichen Erfahrungen, die unbewusst übernommen werden, auch dann wenn sie dem eigenen Selbstbefinden geschadet haben. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung steht in Deutschland per Grundgesetz Artikel § 1631 Abs. 2 BGB jedem
Kind zu. Im Wortlaut heißt es: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind
unzulässig.“ Aber was ist darunter zu verstehen? Auch wenn Kinder nicht (mehr) geschlagen werden, so können sie einem Erwachsenen doch nichtsdestotrotz schutzlos ausgeliefert sein, in dem der Erwachsene das Kind gar zu sehr nach seinem Bilde zu formen versucht. Auch durch geschickte Manipulationsversuche wird ein Kind gewaltvoll erzogen. In dem Buch von Ekkehard von Braunmühl mit dem Titel „Zeit für Kinder“ habe ich viele Situationen aus meinen eigenen Erfahrungen der Kindheit wiedererkannt, aber leider auch sehr aktuelles aus meinem direkten Umfeld als Tagespflegeperson, worüber ich zunächst ratlos, teilweise auch schockiert war.
Es gibt viele Bücher, die über die Schädlichkeit der Erziehung berichten und ich fragte mich, genau wie Alice Miller einst: „Warum mag dieses Wissen so wenig in der Öffentlichkeit zu verändern?“ Aus meinem anfänglichen Bauchgefühl, dass etwas im Umgang mit Kindern in unserer Gesellschaft noch nicht stimmig ist, wurde Gewissheit. Der Schlüssel zur Veränderung der Einstellung zu Kindern, findet sich in einer neuen bzw. anderen Denkrichtung: Der Antipädagogik.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begriffsbestimmung: Was ist eigentlich Erziehung?
- Prämissen der Erziehung
- Methoden der Erziehung im geschichtlichen Kontext
- Erziehung ist kinderfeindlich
- Kindertagespflege: Bildung ohne Erziehung
- Zeitliche Perspektiven im Umgang mit Problemsituationen
- Zukunft ohne Zukunftspläne
- Der Pädagogische Gegenteileffekt
- Antipädagogische Grundsätze als Ausweg aus dem Dilemma Erziehung
- Das Notwehrprinzip
- Die Rechte der Kinder
- Wertevermittlung durch Vorbildverhalten
- Ergebnisse antipädagogischer Grundsätze
- Antipädagogische Forderungen im sächsischen Bildungsplan
- Quellennachweis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Kritik an der traditionellen Erziehung und stellt die Antipädagogik als alternative Denkrichtung vor. Ziel ist es, die negativen Folgen von erzieherischen Maßnahmen aufzuzeigen und die Bedeutung eines respektvollen Umgangs mit Kindern zu betonen.
- Kritik an der traditionellen Erziehung
- Die Antipädagogik als alternative Denkrichtung
- Die Bedeutung von Respekt und Selbstbestimmung für Kinder
- Die Rolle der Tagespflegeperson im Kontext der Antipädagogik
- Die Auswirkungen von erzieherischen Maßnahmen auf die Entwicklung von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die Problematik der traditionellen Erziehung in Frage und führt den Leser in die Thematik der Antipädagogik ein. Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff der Erziehung aus verschiedenen Perspektiven und analysiert die Prämissen und Methoden der Erziehung im historischen Kontext. Das dritte Kapitel widmet sich der Kindertagespflege und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der traditionellen Erziehungsperspektive ergeben. Das vierte Kapitel stellt die Antipädagogik als alternative Denkrichtung vor und erläutert die wichtigsten antipädagogischen Grundsätze. Das fünfte Kapitel diskutiert die Implikationen der Antipädagogik für den sächsischen Bildungsplan.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Antipädagogik, die traditionelle Erziehung, Kinderrechte, Selbstbestimmung, Respekt, Kindertagespflege, Bildung, Entwicklung, und die Folgen von erzieherischen Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Antipädagogik“?
Antipädagogik ist eine Denkrichtung, die traditionelle Erziehung als Bevormundung oder Manipulation ablehnt und stattdessen auf Respekt und Selbstbestimmung des Kindes setzt.
Warum kritisiert die Autorin den Begriff „Erziehung“?
Inspiriert durch Alice Miller und Ekkehard von Braunmühl wird Erziehung als kinderfeindlich und oft gewaltvoll (auch psychisch) angesehen, da sie das Kind nach dem Bilde des Erwachsenen formen will.
Was ist das „Notwehrprinzip“ in der Antipädagogik?
Es ist ein Grundsatz, der Handlungen gegenüber Kindern nur dann rechtfertigt, wenn sie zur Abwehr von unmittelbarer Gefahr notwendig sind, statt zur „Erziehung“.
Wie lässt sich Antipädagogik in der Kindertagespflege umsetzen?
Die Arbeit diskutiert Möglichkeiten für Bildung ohne Erziehung, wobei die Tagespflegeperson als Vorbild fungiert, statt durch Manipulation Werte vermitteln zu wollen.
Welchen Bezug nimmt die Arbeit zum sächsischen Bildungsplan?
Sie untersucht, wie antipädagogische Forderungen und Grundsätze mit den Vorgaben des sächsischen Bildungsplans in Einklang gebracht werden können.
- Quote paper
- Franziska Schult (Author), 2014, Antipädagogik. Über die Möglichkeiten der Antipädagogischen Einstellung im Bereich der Kindertagespflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284620