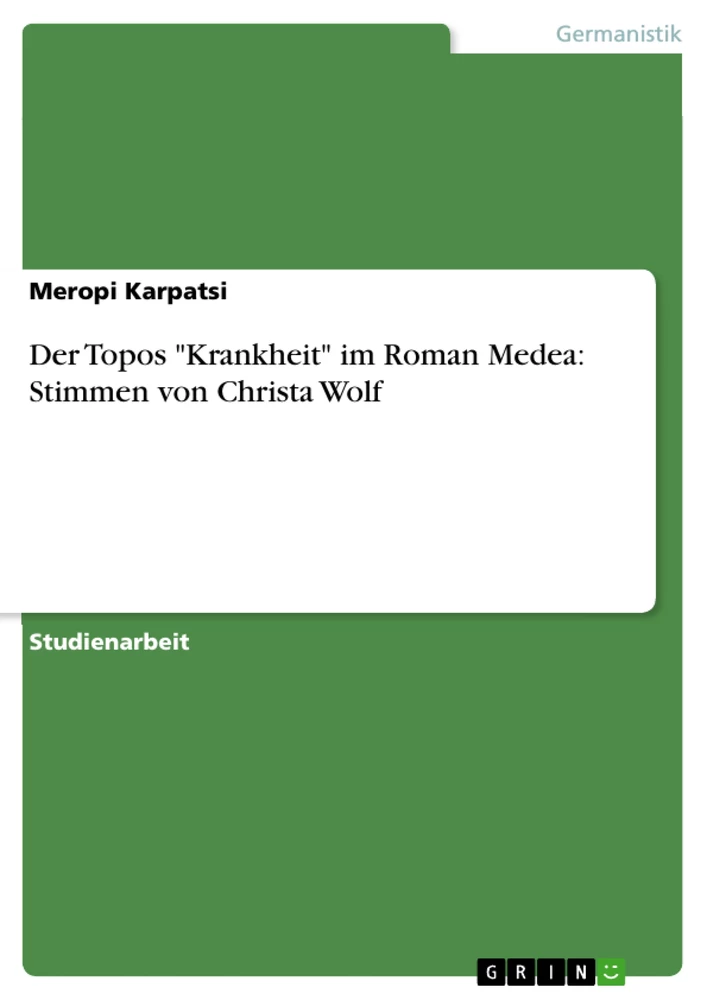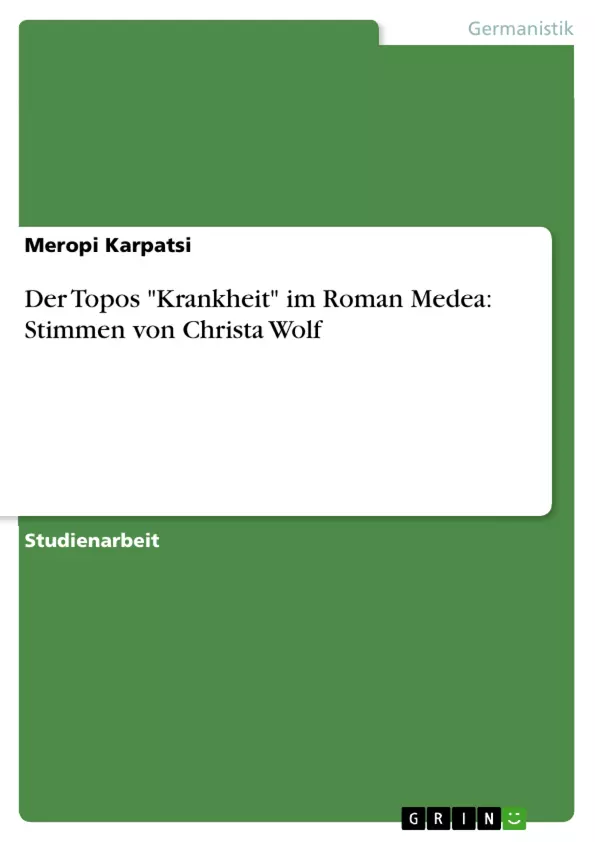Christa Wolf schreibt in ihrem Roman „Medea.Stimmen“ nicht über die Figur der Medea als eine Kindsmörderin, sondern als eine selbstbewusste und emanzipierte Frau, die auf der Suche zur (Selbst-)Erkenntnis mit Leiden konfrontiert wird.
Im Text wird deutlich, dass Medea als „Heilerin“ unter den Kolchern gilt und ihre Heilkünste werden auch von den Korinthern zu Anfang geschätzt und bevorzugt. Ihre Hochmut und ihr Stolz machen sie aber unbeliebt und sie zieht das Missfallen der Korinther auf sich. Als sie das Skelett der toten Iphinoe, der älteren Tochter des Königs Kreon und der Königin Merope, in einem geheimen Gang im Palast entdeckt, macht sie sich Akamas, den ersten Astronomen des Königs, zum Feind.
Mithilfe Medeas hat sich zwar Glaukes Zustand, der jüngeren Tochter des Königs, die krank ist, verbessert, doch ihr Einfluss auf Glauke wird zu gefährlich für Akamas. Obwohl Medea dieses Geheimnis für sich behalten will und ihre Nachforschungen dazu für ihre eigene Erkenntnis dienen, wurde sie vom Königshaus als Gefahr angesehen und ein Plan wurde erstellt um sie zu vernichten. Nach den Gerüchten, sie habe ihren Bruder ermordet, und einem Erdbeben, welches viele Tote und die Pest mit sich gebracht hat, wird die als „Hexe“ und „Zauberin“ beschuldigt. Diese und viele andere Beschuldigungen werden ihr zugeworfen und nach einer Gerichtsverhandlung wird sie schließlich aus Korinth verbannt.
An dieser Stelle bleiben jedoch wesentliche Fragen offen:
- Welche Erkenntnis hat Medea für sich erhofft?;
- Wie hat Medea Glaukes Krankheit geheilt?;
- Warum wurde sie als Zauberin beschuldigt nachdem die Pest ausgebrochen war?;
Diese Hausarbeit spricht einige der zahlreichen Aspekte an, die in „Medea.Stimmen“ von Christa Wolf zum Thema Krankheit aufkommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Krankheit“ und „Heilung“ im Roman
- 2.1. Medeas Krankheit
- 2.2. Medea als „Heilerin“
- 2.3. Glaukes Krankheit
- 2.4. Die Krankheit der Bürger - die Pest
- 3. Der medizinphilosophische Kontext
- 3.1. Die Philosophie der Krankheit
- 3.2. Der pragmatische und der initiatische Sinn des „Heilens“
- 3.3. Erinnern und Verdrängen
- 4. Schluss
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Topos „Krankheit“ in Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte von Krankheit und Heilung im Kontext des Romans zu analysieren und ihre Bedeutung für Medeas Entwicklung und das Geschehen in Korinth zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die literarische Darstellung und vermeidet eine medizinisch-fachliche Interpretation.
- Medeas Krankheit als Ausdruck von Schock und dem Prozess der Selbsterkenntnis
- Medeas Rolle als Heilerin und ihre ambivalenten Beziehungen zu den Korinthern
- Glaukes Krankheit und Medeas Einmischung
- Die Pest als kollektive Krankheit und ihre Symbolik
- Der medizinphilosophische Kontext und die verschiedenen Perspektiven auf Heilung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Romans „Medea. Stimmen“ ein und stellt die zentrale Frage nach der Darstellung von Krankheit und Heilung in Verbindung mit Medeas Suche nach Selbsterkenntnis. Sie skizziert die wichtigsten Handlungsstränge und benennt offene Fragen, die im Laufe der Arbeit behandelt werden sollen. Der Fokus liegt auf Medeas ambivalenter Rolle als sowohl Kranke als auch Heilerin und der gesellschaftlichen Wahrnehmung ihrer Handlungen.
2. „Krankheit“ und „Heilung“ im Roman: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte von Krankheit und Heilung im Roman. Es untersucht Medeas Krankheit, die sowohl physisch als auch psychisch bedingt ist und mit Fieberausbrüchen und Halluzinationen einhergeht. Diese Krankheit wird als Folge des Schocks über die Entdeckung der Leiche Iphinoes dargestellt und ist gleichzeitig ein Weg zur Selbsterkenntnis für Medea. Der Abschnitt über Medea als Heilerin zeigt ihre ambivalente Beziehung zur korinthischen Gesellschaft: zunächst geschätzt für ihre Fähigkeiten, wird sie später als Gefahr und Zauberin wahrgenommen. Die Krankheit Glaukes wird im Zusammenhang mit Medeas Bemühungen um Wahrheitssuche betrachtet, und die Pest wird als kollektive Krankheit und als Metapher für die gesellschaftliche Krise interpretiert.
3. Der medizinphilosophische Kontext: Dieses Kapitel untersucht den Kontext der medizinphilosophischen Denkweisen im Roman. Es analysiert verschiedene Auffassungen von Krankheit und Heilung, betrachtet die pragmatischen und initiatischen Aspekte des Heilens und beleuchtet den Prozess des Erinnerns und Verdrängens im Zusammenhang mit Krankheit und Trauma. Die verschiedenen philosophischen Ansätze beeinflussen die Interpretation der Ereignisse im Roman und liefern einen breiteren Kontext für das Verständnis der dargestellten Krankheiten.
Schlüsselwörter
Medea, Christa Wolf, Krankheit, Heilung, Selbsterkenntnis, Kolchis, Korinth, Pest, Zauberin, Heilerin, Glauke, Iphinoe, medizinphilosophischer Kontext, Schock, Trauma, Erinnerung, Verdrängung.
Häufig gestellte Fragen zu Christa Wolfs "Medea. Stimmen" - Analyse von Krankheit und Heilung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von „Krankheit“ und „Heilung“ in Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“. Der Fokus liegt auf der literarischen Interpretation und vermeidet medizinisch-fachliche Aspekte. Die Analyse untersucht verschiedene Krankheitsbilder und deren Bedeutung für Medeas Entwicklung und das Geschehen in Korinth.
Welche Aspekte von Krankheit und Heilung werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet Medeas Krankheit als Ausdruck von Schock und Selbsterkenntnis, ihre ambivalente Rolle als Heilerin, Glaukes Krankheit und Medeas Einmischung, die Pest als kollektive Krankheit und deren Symbolik, sowie den medizinphilosophischen Kontext und verschiedene Perspektiven auf Heilung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von „Krankheit“ und „Heilung“ im Roman (inkl. Unterkapitel zu Medeas und Glaukes Krankheit sowie der Pest), ein Kapitel zum medizinphilosophischen Kontext, ein Schluss und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in die Thematik ein, das Hauptkapitel analysiert die verschiedenen Krankheitsaspekte im Roman, das Kapitel zum Kontext beleuchtet die medizinphilosophischen Denkweisen, und der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt Medea im Roman?
Medea wird als ambivalente Figur dargestellt: Sie ist sowohl „Kranke“ (im Sinne von Schock und Trauma) als auch „Heilerin“. Ihre Krankheit ist Ausdruck ihres psychischen Zustands und ein Prozess der Selbsterkenntnis. Gleichzeitig wird ihre Fähigkeit zu heilen gezeigt, wobei ihre Beziehung zur korinthischen Gesellschaft ambivalent ist – von anfänglicher Wertschätzung bis hin zur Wahrnehmung als Gefahr.
Welche Bedeutung hat die Pest im Roman?
Die Pest wird als kollektive Krankheit interpretiert und als Metapher für die gesellschaftliche Krise in Korinth gesehen. Sie steht im Zusammenhang mit den anderen Krankheitsdarstellungen und trägt zur Gesamtinterpretation des Romans bei.
Welchen medizinphilosophischen Kontext untersucht die Arbeit?
Die Arbeit analysiert verschiedene medizinphilosophische Denkweisen, die im Roman implizit oder explizit vorhanden sind. Sie betrachtet die pragmatischen und initiatischen Aspekte des Heilens und beleuchtet den Prozess des Erinnerns und Verdrängens in Verbindung mit Krankheit und Trauma. Diese philosophischen Ansätze liefern einen breiteren Kontext für das Verständnis der dargestellten Krankheiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Medea, Christa Wolf, Krankheit, Heilung, Selbsterkenntnis, Kolchis, Korinth, Pest, Zauberin, Heilerin, Glauke, Iphinoe, medizinphilosophischer Kontext, Schock, Trauma, Erinnerung und Verdrängung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen im Roman "Medea. Stimmen". Sie richtet sich an Leser*innen, die sich mit der Literaturwissenschaft und der Interpretation von Christa Wolfs Werk auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Meropi Karpatsi (Autor), 2009, Der Topos "Krankheit" im Roman Medea: Stimmen von Christa Wolf, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285603