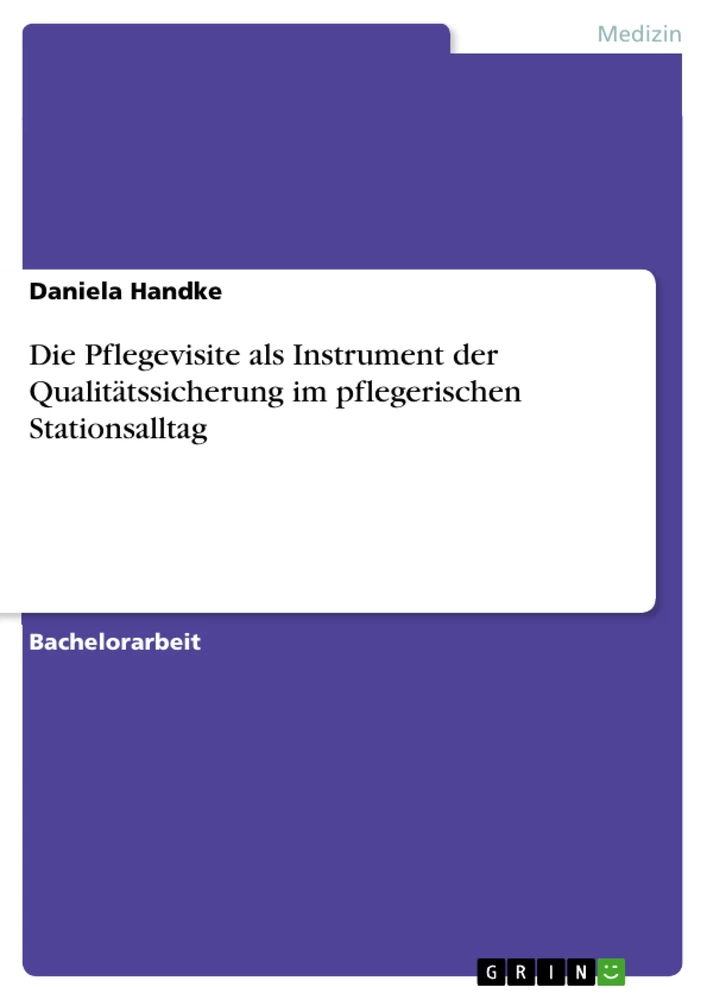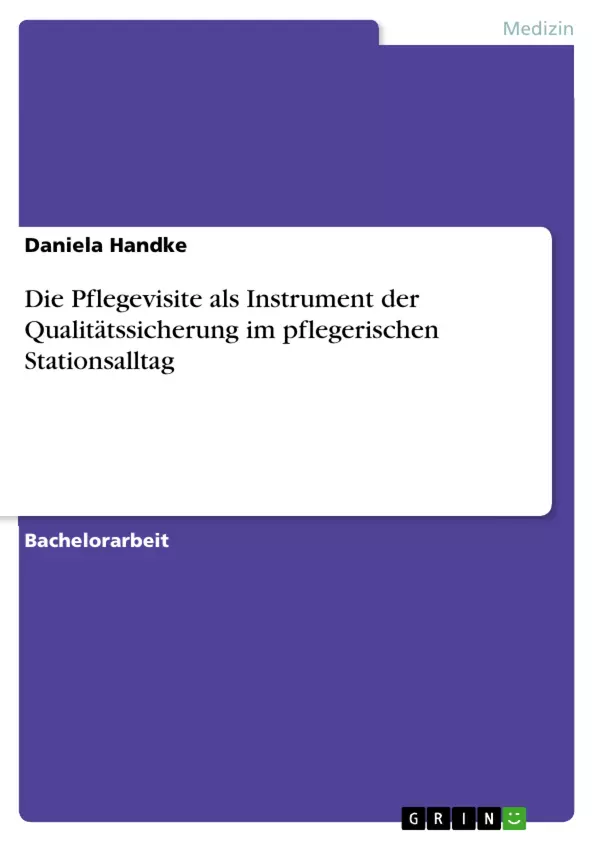Die Thematik der Qualität im Gesundheitswesen nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Die Pflege steht vor der Herausforderung, Qualität trotz steigendem Arbeitsaufwand zu gewährleisten und gleichzeitig Kundenanforderungen gerecht zu werden. Hinzu kommt die Professionalisierung und Akademisierung der Pflege. Damit sich die Qualität unter diesen Umständen nicht verschlechtert, sind Maßnahmen zur Qualitätssicherung für alle Krankenhäuser gesetzlich verpflichtend.
Das Thema dieser Bachelorarbeit lautet Die Pflegevisite als Instrument der Qualitätssicherung im pflegerischen Stationsalltag. Durch die Anwendung hermeneutischer Prinzipien, soll die Forschungsfrage Welche Kriterien muss eine Pflegevisite als Qualitätssicherungsinstrument im stationären Pflegealltag aufweisen? beantwortet werden. Des Weiteren werden Kriterien erarbeitet, welche gegeben sein müssen, um Qualität im Pflegeprozess zu sichern. Zudem dient die vorliegende Bachelorarbeit der Definition des Qualitätsbegriffes in der Pflege und zeigt das erforderlich hohe Qualitätsniveau auf. Dazu bedarf es der Auseinandersetzung mit den Qualitätskriterien des Pflegeprozesses. Durch die systematische Pflegearbeit mit dem Pflegeprozess ist ein gezieltes und geplantes Vorgehen sowie individuelles, ganzheitliches und patientenorientiertes Pflegen möglich. Mit dem Qualitätssicherungsinstrument Pflegevisite soll nicht nur die Qualität des Pflegeprozesses im Allgemeinen, sondern auch der Wissensstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemessen werden.
Diese Bachelorarbeit beschreibt den Pflegeprozess als eine der wichtigsten Aufgaben der Pflege. Um auf der Prozessebene (Pflegeprozess) das gewünschte Ergebnis erreichen zu können, müssen auf der Strukturebene (Rahmenbedingungen der Einrichtung) die Voraussetzungen gegeben sein. Durch die im Rahmen der Pflegevisite stattfindenden regelmäßigen Prozessevaluierungen wird der Pflegeprozess genauer beleuchtet und die Ergebnisqualität beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract Deutsch
- Abstract English
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Fragestellung
- Methodisches Vorgehen
- Aufbau der Arbeit
- Die Qualität
- Begriff Qualität
- International Organization for Standardization
- ÖNORM
- Das Kategorienmodell nach Avedis Donabedian
- Donabedian Modell versus ISO 9001 v2008
- Begriff Pflegequalität
- Zusammenfassung
- Qualitätsmanagement
- Qualitätsmanagementsysteme
- Begriff Qualitätssicherung
- Qualitätssicherung in der Pflege
- Externe Qualitätssicherung
- Interne Qualitätssicherung
- Gesetzgebung
- Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten
- Bundesgesetz zur Qualität von Gesundheitsleistungen
- Zusammenfassung
- Pflegevisite
- Begriff Pflegevisite
- Kriterien und Voraussetzungen der Pflegevisite
- Strukturkriterien
- Prozesskriterien
- Ergebniskriterien
- Formen der Pflegevisite
- Pflegevisite als Dienstübergabe mit der Patientin bzw. dem Patienten
- Pflegevisite als Instrument zur Miteinbeziehung der Patienten
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Pflegevisite als Instrument der Qualitätssicherung im pflegerischen Stationsalltag. Ziel der Arbeit ist es, die Kriterien zu erarbeiten, die eine Pflegevisite als Qualitätssicherungsinstrument im stationären Pflegealltag erfüllen muss. Dabei wird die Forschungsfrage beantwortet, welche Kriterien eine Pflegevisite aufweisen muss, um als Instrument der Qualitätssicherung im stationären Pflegealltag zu dienen. Die Arbeit befasst sich mit dem Qualitätsbegriff in der Pflege und zeigt das erforderliche hohe Qualitätsniveau auf.
- Qualitätssicherung in der Pflege
- Kriterien der Pflegevisite als Qualitätssicherungsinstrument
- Der Pflegeprozess als Grundlage der Qualitätssicherung
- Die Rolle der Pflegevisite in der Patientenzufriedenheit
- Die Bedeutung der Pflegevisite für die Mitarbeitermotivation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und erläutert die Zielsetzung, die Fragestellung und den methodischen Ansatz. Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff der Qualität und beleuchtet verschiedene Modelle und Definitionen, insbesondere im Kontext der Pflege. Kapitel 3 widmet sich dem Qualitätsmanagement und der Qualitätssicherung in der Pflege. Es werden verschiedene Ansätze und Modelle vorgestellt, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet. Kapitel 4 analysiert die Pflegevisite als Instrument der Qualitätssicherung. Es werden die Kriterien und Voraussetzungen der Pflegevisite sowie verschiedene Formen und Anwendungsbereiche vorgestellt. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Pflegevisite, die Qualitätssicherung in der Pflege, die Kriterien der Pflegevisite, den Pflegeprozess, die Patientenzufriedenheit und die Mitarbeitermotivation. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Pflegevisite als Instrument der Qualitätssicherung im pflegerischen Stationsalltag und analysiert die verschiedenen Aspekte, die für eine erfolgreiche Implementierung und Anwendung der Pflegevisite relevant sind.
- Quote paper
- Daniela Handke (Author), 2015, Die Pflegevisite als Instrument der Qualitätssicherung im pflegerischen Stationsalltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294994