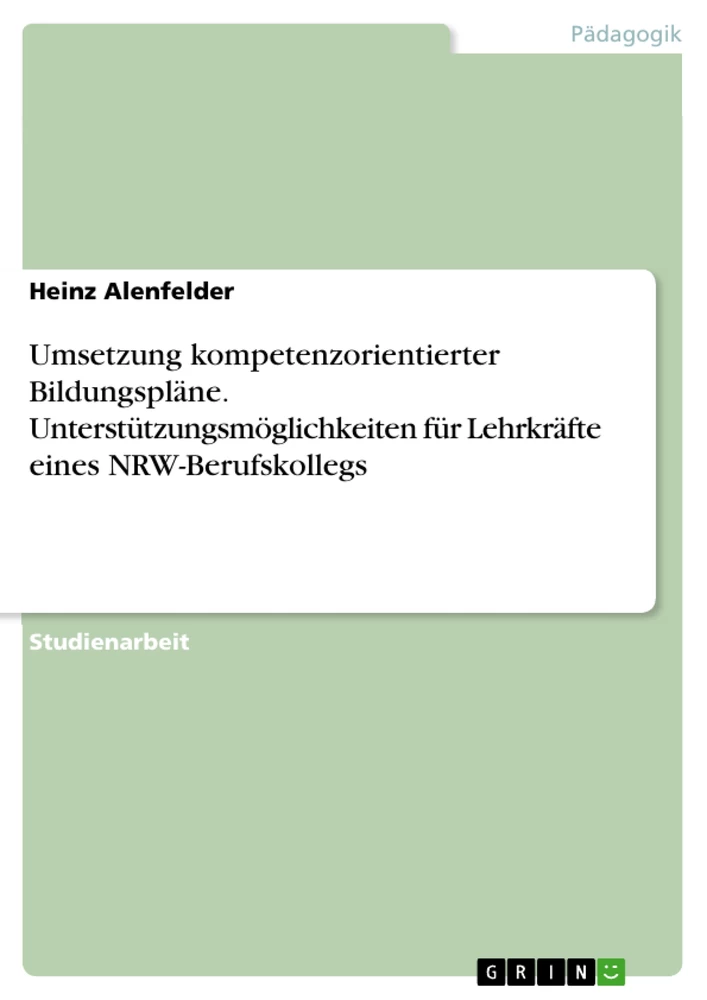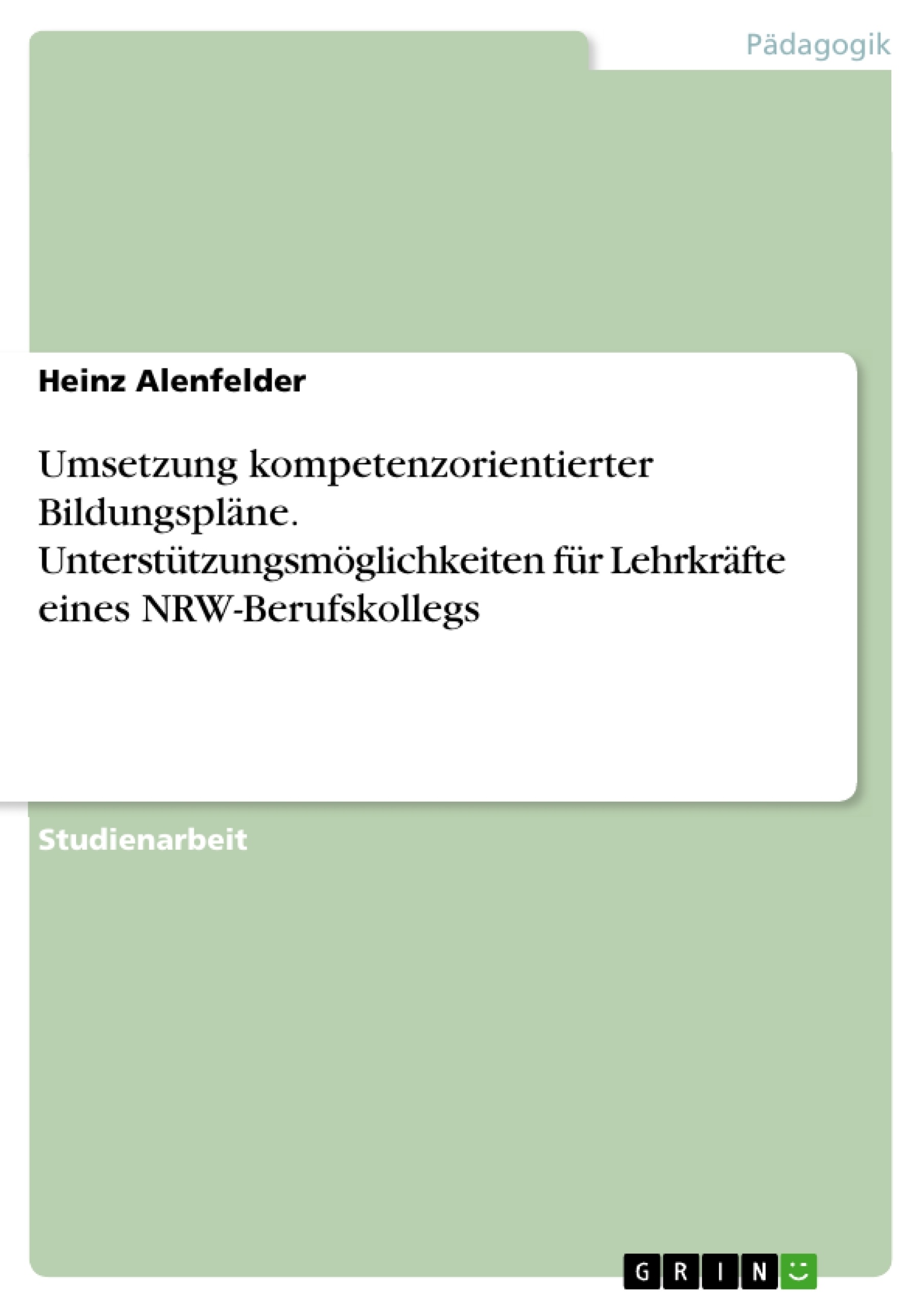Neben der 1997 neu strukturierten dualen Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie hat sich in verschiedenen Bundesländern ein System gleichwertiger, vollzeitschulischer Ausbildungen an beruflichen Schulen etabliert.
Eine solche Ausbildung wird in Nordrhein-Westfalen in Höheren Berufsfachschulen/Berufskollegs angeboten: Informationstechnische Assistenten. Landesweit wird an einer Überarbeitung der Bildungspläne gearbeitet, um sie an das System des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) anzupassen und eine deutliche Kompetenzorientierung herbeizuführen.
Diese neuen Bildungspläne bedeuten für die Lehrkräfte zunächst Mehraufwand. Zu erwarten sind allerdings, dass das Land Unterstützungsmöglichkeiten und Verfahrensvorschläge zur kooperativen Zusammenarbeit von Lehrkräften anbietet. Allerdings liegen gegenwärtig für das Berufsfeld Technik/Naturwissenschaft noch keine Entwürfe vor, und erste derart erarbeitete Lehrpläne treten im Bereich der Höheren Berufsfachschule voraussichtlich erst 2015/2016 in Kraft.
Diese Verzögerung kann von Berufskollegs als Chance genutzt werden, die Lehrkräfte schon im Vorfeld auf die Umsetzung der neuen kompetenzorientierten Bildungspläne vorzubereiten. Die Arbeit untersucht folgende Forschungsfrage: Welche Unterstützungsmöglichkeiten zur Umsetzung neuer kompetenzorientierter Bildungspläne existieren für Lehrkräfte, die in vollzeitschulischen IT-Assistenten-Ausbildungen an einem Berufskolleg in NRW unterrichten? Welche förderlichen und hinderlichen Faktoren lassen sich diesbezüglich identifizieren?
Um diese Fragen zu klären, werden zunächst theoretische Hintergründe dargestellt. Dann wird eine Übersicht über die aktuelle Situation gegeben. Daran schließt sich ein Überblick der Unterstützungsmöglichkeiten an. In einer kritischen Reflexion werden die förderlichen und hinderlichen Faktoren erörtert, um abschließend im Fazit mögliche Entwicklungen aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Vollzeitschulische Ausbildung im beruflichen Bildungssystem
- 2.2 Lehrpläne auf Makro-, Meso- und Mikroebene
- 2.3 Der Kompetenzbegriff
- 2.4 Kompetenzen der Lehrkräfte
- 3. Die aktuelle Situation
- 3.1 Ausbildung Informationstechnischer Assistentinnen
- 3.2 Aufgaben der Schulen beim Umsetzen von Bildungsplänen
- 3.3 Ausbildung berufsbildender Lehrkräfte
- 4. Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte
- 4.1 Parallele: lernfeldstrukturierte Curricula des dualen Systems
- 4.2 Fortbildungen für berufsbildende Lehrkräfte
- 4.3 Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb des Kollegiums
- 5. Kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte an einem NRW-Berufskolleg zur Umsetzung neuer kompetenzorientierter Bildungspläne für Informationstechnische Assistenten existieren. Dabei werden die aktuellen Herausforderungen im Kontext des Paradigmenwechsels von der Fach- zur Output-Steuerung im Bildungssystem betrachtet. Die Arbeit analysiert die Rolle von Lehrplänen, den Kompetenzbegriff sowie die spezifischen Bedürfnisse der Lehrkräfte im Hinblick auf die Umsetzung neuer Bildungspläne.
- Die Bedeutung von Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung
- Die Rolle von Lehrplänen und deren Umsetzung in der Praxis
- Die Herausforderungen und Chancen der neuen Bildungspläne für Lehrkräfte
- Die Identifizierung von Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte
- Die Analyse von förderlichen und hinderlichen Faktoren bei der Umsetzung neuer Bildungspläne
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der vollzeitschulischen Assistentinnen-Ausbildung und beschreibt die Rolle von Lehrplänen sowie den Kompetenzbegriff. Kapitel 3 beschreibt die aktuelle Situation der Ausbildung von Informationstechnischen Assistentinnen und die Aufgaben der Schulen bei der Umsetzung von Bildungsplänen. Kapitel 4 präsentiert verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, darunter die Parallelen zum dualen System, Fortbildungen und interne Unterstützungsmöglichkeiten. Kapitel 5 bietet eine kritische Reflexion der förderlichen und hinderlichen Faktoren bei der Umsetzung neuer Bildungspläne.
Schlüsselwörter
Kompetenzorientierung, Bildungspläne, Berufskolleg, Informationstechnische Assistenten, Lehrkräfte, Unterstützungsmöglichkeiten, duale Ausbildung, Output-Steuerung, Fach-Steuerung, Lehrplanentwicklung.
- Quote paper
- Heinz Alenfelder (Author), 2015, Umsetzung kompetenzorientierter Bildungspläne. Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte eines NRW-Berufskollegs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299250