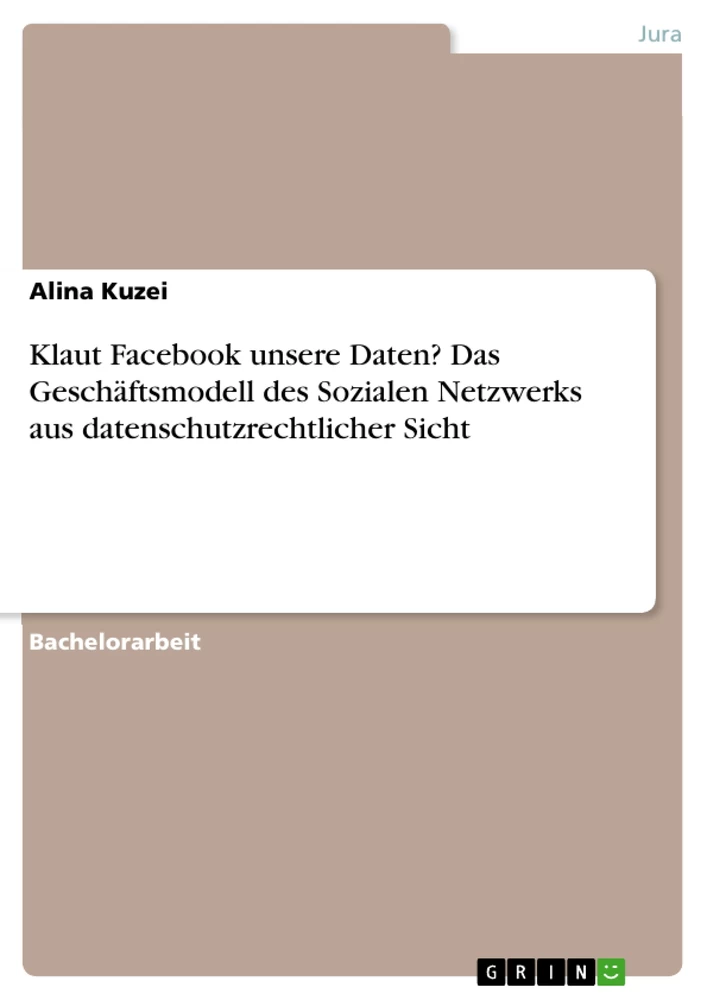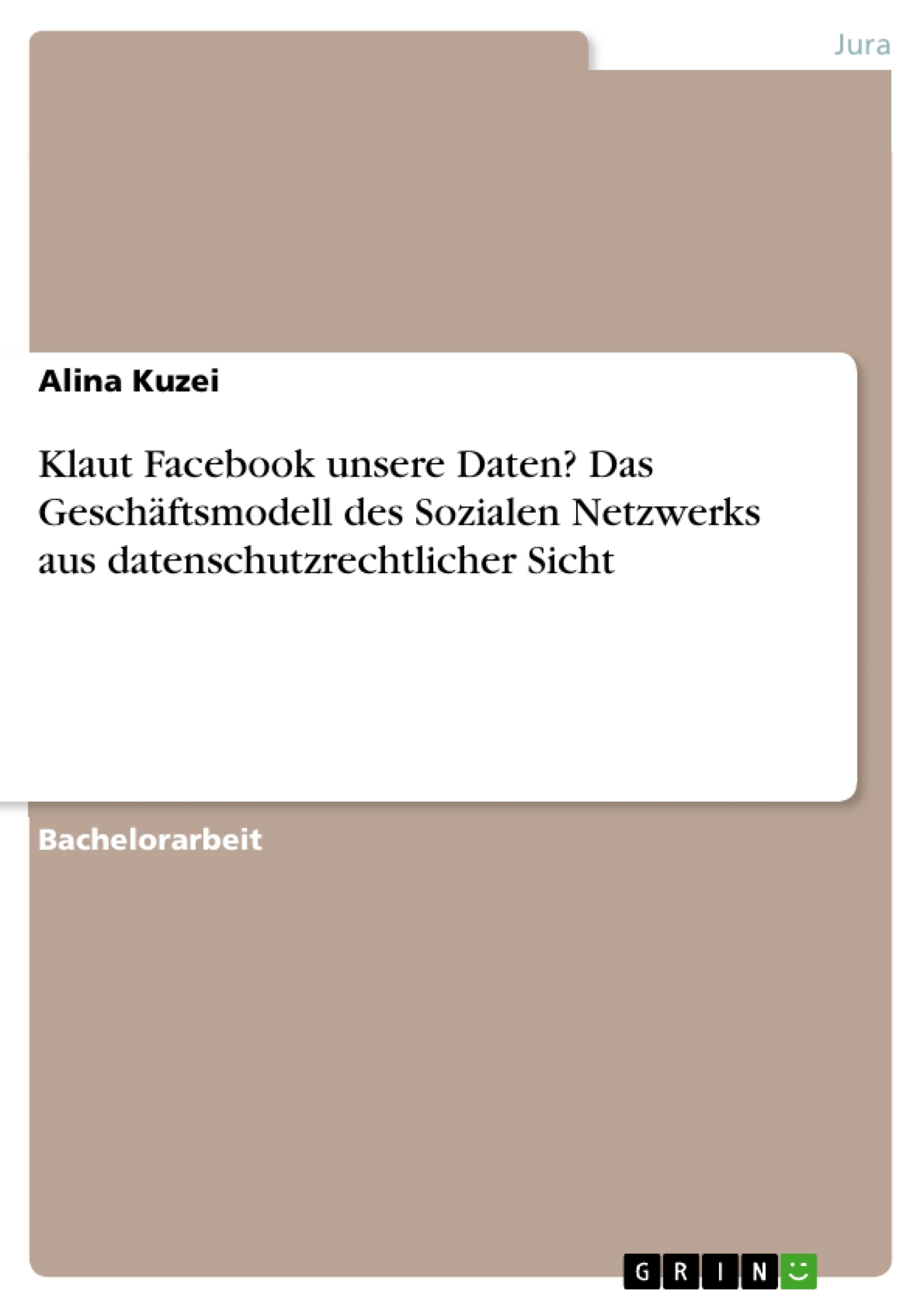80% der deutschen Bevölkerung über dem 14ten Lebensjahr besitzen einen Internet-Zugang. Das Internet hat sich bei den meisten Menschen zu einem erweiterten Lebensraum entwickelt und es gibt kaum noch jemanden, der behaupten kann, nicht Mitglied eines sozialen Netzwerks zu sein. Das Teilen von privaten Fotos, Videos, Musikclips und anderen Vorlieben wird durch soziale Netzwerke ermöglicht und unterstützt. Xing, Twitter, Google+, und verschiedene Kontaktbörsen sind nur wenige bekannte Beispiele.
Aber das weltweit meist genutzte soziale Netzwerk ist Facebook. Die internationalen Nutzerzahlen liegen bei einer Milliarde. Und etwa 25 Mio. Nutzer sind allein in Deutschland registriert worden. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 82 Mio. macht das 30% der Bevölkerung Deutschlands aus. Viele Menschen, die dieses Netzwerk nutzen, wissen jedoch nicht, dass Facebook ihre Daten für immer speichert, ggf. an Dritte weiterleitet, oder nutzt, um daraus Nutzungsprofile zu generieren und personalisierte Werbung zu schalten.
Die Währung, mit der man heutzutage im Internet bezahlt, sind personenbezogene Daten. Demzufolge häufen sich Negativmeldungen zum Thema Datenschutz und Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Bürger Deutschlands. Die vorliegende Arbeit gibt einen strukturierten Überblick über die Themen Facebook und Datenschutz. Im Fokus steht dabei das Geschäftsmodell von Facebook. Die Autorin betrachtet dieses eingehend aus datenschutzrechtlicher Sicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Relevanz
- Vorgehensweise der Arbeit
- Das Geschäftsmodell von Facebook
- Die Facebook Incorporated
- Die Facebook Ireland Limited
- Die Facebook Germany GmbH
- Die Funktionen des sozialen Netzwerks
- Nutzungs-, Schattenprofile und personalisierte Werbung
- Der Social Plugin „Like-Button“
- Datenschutzrechtliche Grundbegriffe
- Deutsches Datenschutzrecht
- Personenbezogene Daten
- Automatisierte Verarbeitung
- Einwilligung
- Wo beginnt das Datenschutzproblem bei Social Plugins?
- Übermittlung personenbezogener Daten in einen Drittstaat? Welches Recht findet Anwendung?
- Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
- Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des Webseitenbetreibers
- Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit Facebooks
- Erstellen von Nutzungsprofilen
- Nutzungsprofil durch Like-Buttons
- Nutzungsprofil durch Zustimmung von Dritten
- Löschungspflicht
- Lösungsvorschläge für datenschutzkonformes Verhalten
- Lösungsvorschläge für Facebook
- Lösungsvorschläge für Facebook-Nutzer
- Urteil des LG Berlin vom 30.04.2013
- Anwendbares Recht
- Datenerhebung Dritter ohne deren Einwilligung
- Datenweitergabe zu Werbezwecken
- Globale Einwilligung
- Zusammenführen von Nutzungsdaten mit anderen Informationen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Geschäftsmodell von Facebook unter datenschutzrechtlichen Aspekten. Ziel ist es, die datenschutzrechtlichen Herausforderungen aufzuzeigen, die sich aus der Funktionsweise des sozialen Netzwerks, insbesondere der Social Plugins, ergeben. Die Arbeit analysiert die Verantwortlichkeiten von Facebook und den Nutzern sowie die Möglichkeiten, datenschutzkonformes Verhalten zu gewährleisten.
- Datenschutzrechtliche Implikationen des Facebook-Geschäftsmodells
- Verantwortlichkeiten von Facebook und Webseitenbetreibern im Umgang mit Nutzerdaten
- Analyse der Rechtslage bezüglich der Datenverarbeitung und -übermittlung
- Bewertung der Wirksamkeit von Einwilligungserklärungen im Kontext von Social Plugins
- Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes bei der Nutzung von Facebook
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung des Datenschutzes im Kontext des Facebook-Geschäftsmodells und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Relevanz der Thematik wird hervorgehoben, da Facebook eine immense Anzahl von Nutzern weltweit hat und der Datenschutz ein immer wichtigeres Thema wird.
Das Geschäftsmodell von Facebook: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Geschäftsmodell von Facebook, inklusive der verschiedenen Unternehmensstrukturen (Facebook Inc., Facebook Ireland, Facebook Germany) und der Kernfunktionen des sozialen Netzwerks. Es beleuchtet insbesondere die Mechanismen der personalisierten Werbung, die auf der Erhebung und Verarbeitung von Nutzerdaten beruhen, sowie die Funktion des "Like-Buttons" als Social Plugin.
Datenschutzrechtliche Grundbegriffe: Hier werden die relevanten datenschutzrechtlichen Begriffe und Grundlagen erläutert. Der Fokus liegt auf dem deutschen Datenschutzrecht, der Definition personenbezogener Daten, der automatisierten Verarbeitung und dem Konzept der Einwilligung als rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung. Diese Grundlagen bilden die Basis für die spätere Analyse des Facebook-Geschäftsmodells.
Wo beginnt das Datenschutzproblem bei Social Plugins?: Dieses Kapitel analysiert die datenschutzrechtlichen Probleme, die im Zusammenhang mit Social Plugins wie dem "Like-Button" auftreten. Es befasst sich mit der grenzüberschreitenden Datenübermittlung, der Verantwortlichkeit von Webseitenbetreibern und Facebook, dem Erstellen von Nutzungsprofilen und der Löschungspflicht. Es werden Lösungsvorschläge für ein datenschutzkonformes Verhalten sowohl für Facebook als auch für die Nutzer präsentiert.
Urteil des LG Berlin vom 30.04.2013: Dieses Kapitel analysiert ein relevantes Urteil des Landgerichts Berlin, welches die datenschutzrechtlichen Aspekte der Datenverarbeitung durch Facebook beleuchtet. Es werden die im Urteil behandelten Punkte wie anwendbares Recht, Datenerhebung ohne Einwilligung, Datenweitergabe zu Werbezwecken, globale Einwilligung und das Zusammenführen von Nutzungsdaten detailliert besprochen und im Kontext der vorherigen Kapitel eingeordnet.
Schlüsselwörter
Facebook, Datenschutzrecht, Social Plugins, Like-Button, personenbezogene Daten, automatisierte Verarbeitung, Einwilligung, Nutzungsprofile, Schattenprofile, Verantwortlichkeit, Drittstaaten, LG Berlin Urteil, Datenschutzkonformes Verhalten, personalisierte Werbung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Datenschutzrechtliche Aspekte des Facebook-Geschäftsmodells
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht das Geschäftsmodell von Facebook unter datenschutzrechtlichen Aspekten. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die sich aus der Funktionsweise des sozialen Netzwerks, insbesondere der Social Plugins (wie dem „Like-Button“), ergeben. Analysiert werden die Verantwortlichkeiten von Facebook und den Nutzern sowie Möglichkeiten, datenschutzkonformes Verhalten zu gewährleisten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine detaillierte Beschreibung des Facebook-Geschäftsmodells (inklusive der verschiedenen Unternehmensstrukturen), eine Erläuterung datenschutzrechtlicher Grundbegriffe (deutsches Datenschutzrecht, personenbezogene Daten, automatisierte Verarbeitung, Einwilligung), eine Analyse der Datenschutzprobleme im Zusammenhang mit Social Plugins (Datenübermittlung, Verantwortlichkeiten, Nutzungsprofile, Löschungspflicht), Lösungsvorschläge für datenschutzkonformes Verhalten (für Facebook und Nutzer), sowie eine Analyse eines relevanten Urteils des Landgerichts Berlin (30.04.2013).
Welche Aspekte des Facebook-Geschäftsmodells werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die Mechanismen der personalisierten Werbung, die auf der Erhebung und Verarbeitung von Nutzerdaten beruhen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Funktion des „Like-Buttons“ als Social Plugin und den damit verbundenen datenschutzrechtlichen Implikationen.
Welche datenschutzrechtlichen Grundbegriffe werden erläutert?
Die Arbeit erklärt wichtige Begriffe wie personenbezogene Daten, automatisierte Verarbeitung und Einwilligung im Kontext des deutschen Datenschutzrechts. Diese Grundlagen dienen als Basis für die Analyse des Facebook-Geschäftsmodells.
Welche Datenschutzprobleme im Zusammenhang mit Social Plugins werden analysiert?
Die Analyse umfasst die grenzüberschreitende Datenübermittlung, die Verantwortlichkeiten von Webseitenbetreibern und Facebook, das Erstellen von Nutzungsprofilen (inkl. Schattenprofilen) und die damit verbundene Löschungspflicht.
Welche Lösungsvorschläge werden präsentiert?
Die Arbeit bietet Lösungsvorschläge für ein datenschutzkonformes Verhalten sowohl für Facebook als auch für die Nutzer. Diese Vorschläge zielen darauf ab, die identifizierten Datenschutzprobleme zu minimieren.
Welches Urteil des LG Berlin wird analysiert?
Die Arbeit analysiert das Urteil des Landgerichts Berlin vom 30.04.2013. Die Analyse umfasst die im Urteil behandelten Punkte wie anwendbares Recht, Datenerhebung ohne Einwilligung, Datenweitergabe zu Werbezwecken, globale Einwilligung und das Zusammenführen von Nutzungsdaten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Facebook, Datenschutzrecht, Social Plugins, Like-Button, personenbezogene Daten, automatisierte Verarbeitung, Einwilligung, Nutzungsprofile, Schattenprofile, Verantwortlichkeit, Drittstaaten, LG Berlin Urteil, Datenschutzkonformes Verhalten, personalisierte Werbung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die datenschutzrechtlichen Herausforderungen aufzuzeigen, die sich aus der Funktionsweise des sozialen Netzwerks, insbesondere der Social Plugins, ergeben. Die Arbeit analysiert die Verantwortlichkeiten von Facebook und den Nutzern sowie die Möglichkeiten, datenschutzkonformes Verhalten zu gewährleisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die eine Einleitung, eine Beschreibung des Facebook-Geschäftsmodells, eine Erläuterung datenschutzrechtlicher Grundlagen, eine Analyse der Datenschutzprobleme bei Social Plugins, eine Analyse des LG Berlin Urteils und ein Fazit enthalten. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen erleichtern die Navigation.
- Citation du texte
- Alina Kuzei (Auteur), 2013, Klaut Facebook unsere Daten? Das Geschäftsmodell des Sozialen Netzwerks aus datenschutzrechtlicher Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303881