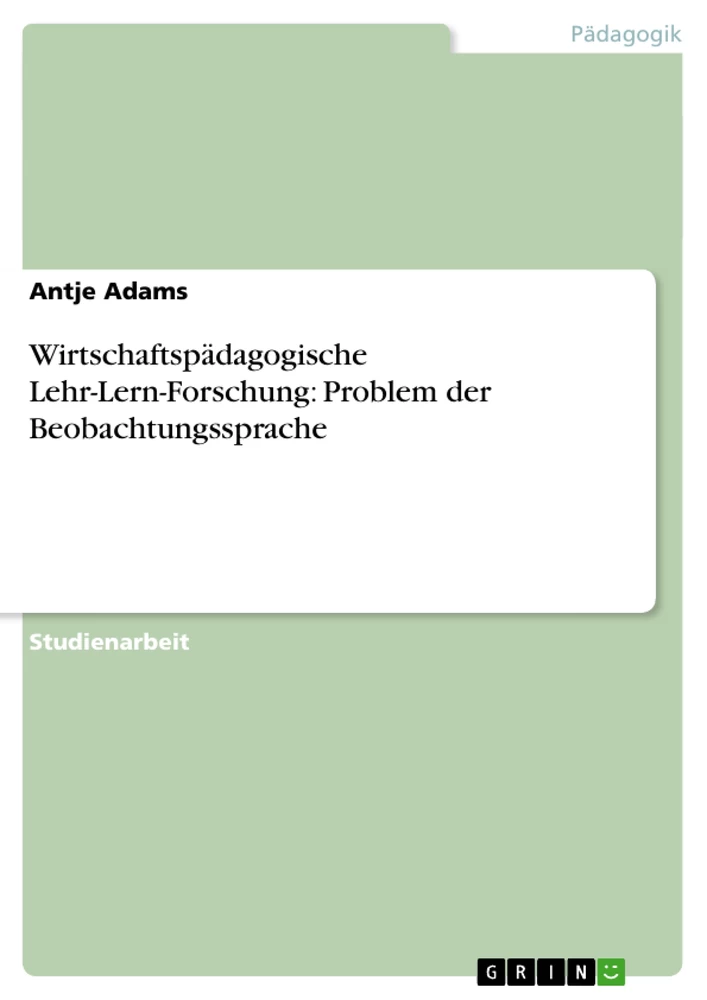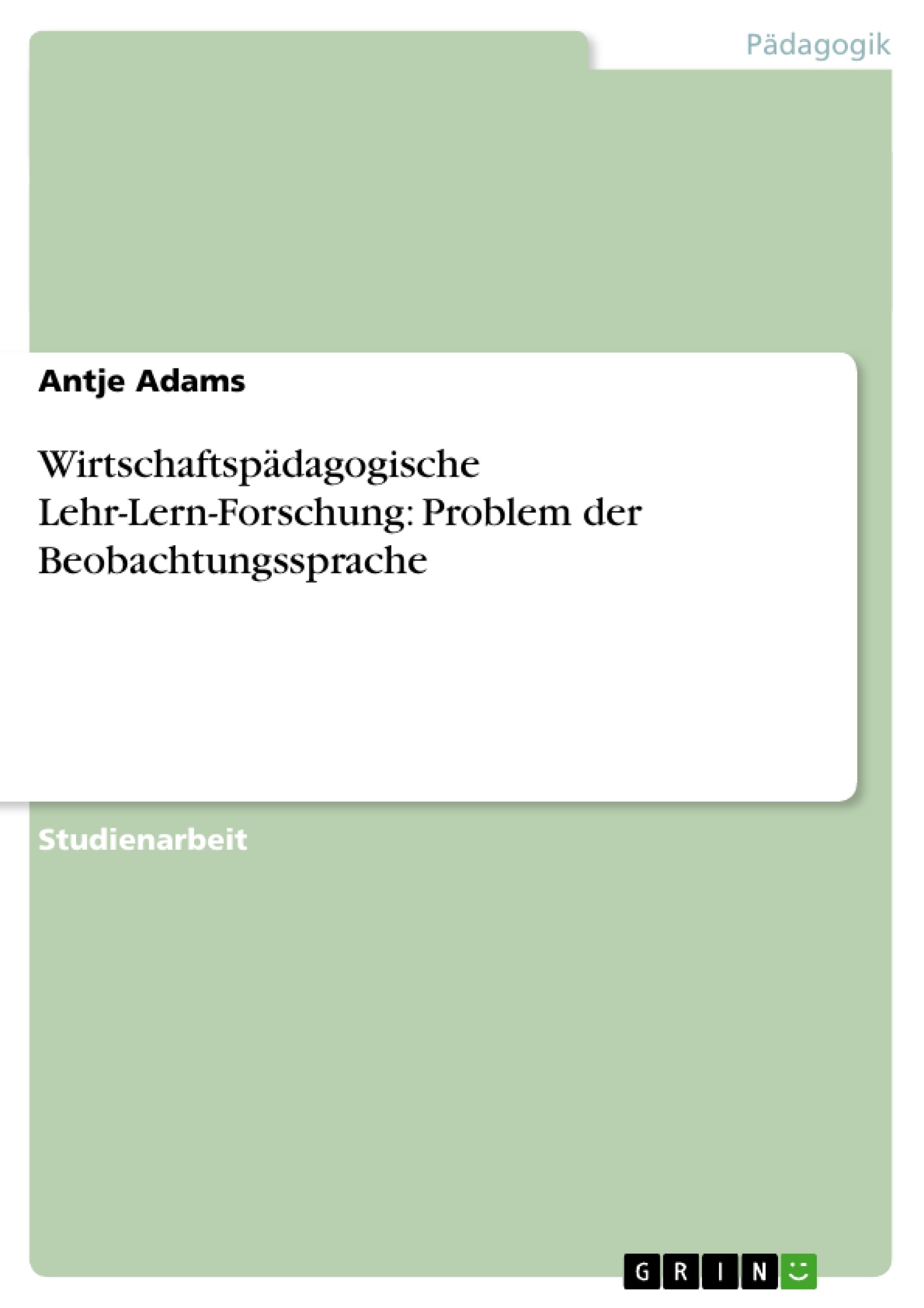Die Pädagogik ist innerhalb des Gebietes der Soziologie eine erziehungswissenschaftliche Disziplin, deren Forschung sich hauptsächlich auf das Beschreiben von tatsächlichen Sachveralten konzentriert, sie ist demnach ein empirische Wissenschaft. Laut Kromrey ist empirisches wissenschaftliches Arbeiten „die Phänomene der realen Welt (möglichst ,objektiv') zu beschreiben und zu klassifizieren [und] die (mög¬lichst allgemeingültigen) Regeln zu finden, durch die die Ereignisse in der realen Welt erklärt und Klassen von Ereignissen vorhergesagt werden können“ (Kromrey 1998, 22). Um Phänomene beschreiben und klassifizieren zu können, müssen zunächst die zu beschreibenden bzw. zu klassifizierenden Phänomen (Daten) erfasst werden, die dann in einem zweiten Schritt zu Gesetzmäßigkeiten zusammengefasst und in Form von Hypothesen und Theorien formuliert werden können. Eine Methode zur Erfassung von Daten ist die der Beobachtung. Im Verlauf dieser Arbeit werde ich zeigen, dass das Beobachten so¬wohl immanente, als auch Probleme im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit auf die Theoriebildung aufwirft und ein weiteres Problem darin besteht, dass während des Prozesses der Umsetzung des Beobachteten in Sprache, viele Quellen von Beobachtungsfehlern zu finden sind. Es werden im Folgenden Beobachtungssprache und theoretische Sprache thematisiert und danach die Zweistufenkonzeption nach Carnap erläutern, da unter anderen Carnap die Bedeutung des Begriffes der Beobachtungssprache als eine der beiden Sprachebenen innerhalb dieser Konzeption entwickelt hat. Beide Sprachebenen lassen sich unter anderem anhand von Indikatoren und Operatonalisierung verbinden, wobei erhebliche Probleme auftreten können. Es wird nicht auf die verschiedenen Arten von Indikatoren und Möglichkeiten der Operatonalisierung eingegangen, da diese für die Darstellung des Problems der Beobachtungssprache nicht relevant sind. Danach wird die Problematik Wissenschaftssprache/Umgangssprache aufgegriffen, indem explizit die Tauglichkeit der Umgangssprache für die Wissenschaft, die inter- und intrapersonellen Differenzen von Beobachtungsbegriffen, auf die Mehrdeutigkeit und die Bedeutungsüberschneidungen von Beobachtungsbegriffen und auf Werturteile innerhalb der Beobachtungssprache diskutiert wird. Abschließend wird aufgezeigt, wie Beobachtungsfehler, die durch die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Mängeln der Sprache entstehen können, wenn auch nur partiell, vermieden werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Beobachtungssprache im Gegensatz zur theoretischen Sprache
- Zweistufenkonzeption nach Carnap
- Operationalisierung anhand von Indikatoren
- Umgangsprache im Gegensatz zur Wissenschaftssprache
- Tauglichkeit von Umgangssprache für die Wissenschaft
- Inter- und intrapersonelle Differenzen
- Bedeutungsüberschneidungen von Begriffen
- Werturteile in Beobachtungswörtern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Problematik der Beobachtungssprache im Kontext empirischer wissenschaftlicher Forschung. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten, die mit der Erfassung und Übersetzung von beobachteten Phänomenen in eine wissenschaftlich brauchbare Sprache verbunden sind.
- Die Unterscheidung zwischen Beobachtungssprache und theoretischer Sprache
- Die Bedeutung der Operationalisierung und die Probleme, die mit Indikatoren verbunden sind
- Die Tauglichkeit der Umgangssprache für wissenschaftliche Zwecke
- Die Herausforderungen, die aus inter- und intrapersonellen Differenzen in der Interpretation von Beobachtungsbegriffen resultieren
- Die Auswirkungen von Werturteilen in Beobachtungswörtern auf die Objektivität empirischer Untersuchungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die Problematik der Beobachtungssprache im Kontext empirischer Forschung ein. Es werden die Herausforderungen des Beobachtungs- und Klassifizierungsprozesses sowie die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Beobachtungen in Sprache hervorgehoben.
- Beobachtungssprache im Gegensatz zur theoretischen Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet die Zweistufenkonzeption von Rudolf Carnap, die eine klare Unterscheidung zwischen Beobachtungssprache und theoretischer Sprache vornimmt. Es erklärt die Bedeutung der Beobachtungssprache als sprachliche Manifestation von intersubjektiv überprüfbaren Gegebenheiten und zeigt, wie sich diese beiden Sprachebenen anhand von Indikatoren und Operationalisierung verbinden lassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Beobachtungssprache im Kontext empirischer Forschung. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Beobachtungssprache, theoretische Sprache, Zweistufenkonzeption, Operationalisierung, Indikatoren, Umgangssprache, Wissenschaftssprache, inter- und intrapersonelle Differenzen, Bedeutungsüberschneidungen, Werturteile.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem der Beobachtungssprache?
Es beschreibt die Schwierigkeit, Beobachtungen fehlerfrei und objektiv in eine wissenschaftliche Sprache zu übersetzen, ohne durch Alltagssprache oder Werturteile verzerrt zu werden.
Was besagt die Zweistufenkonzeption nach Carnap?
Carnap unterscheidet strikt zwischen der Beobachtungssprache (direkt prüfbare Fakten) und der theoretischen Sprache (abstrakte Begriffe).
Warum ist Umgangssprache für die Wissenschaft oft untauglich?
Wegen ihrer Mehrdeutigkeit, ungenauen Begriffsabgrenzungen und den individuellen Interpretationsunterschieden (interpersonelle Differenzen).
Was bedeutet "Operationalisierung" in diesem Kontext?
Es ist der Prozess, theoretische Begriffe durch beobachtbare Indikatoren messbar und sprachlich erfassbar zu machen.
Wie können Beobachtungsfehler vermieden werden?
Durch eine präzise Wissenschaftssprache, klare Definitionen und die Minimierung von Werturteilen in den Beobachtungsprotokollen.
- Quote paper
- Antje Adams (Author), 2002, Wirtschaftspädagogische Lehr-Lern-Forschung: Problem der Beobachtungssprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30664