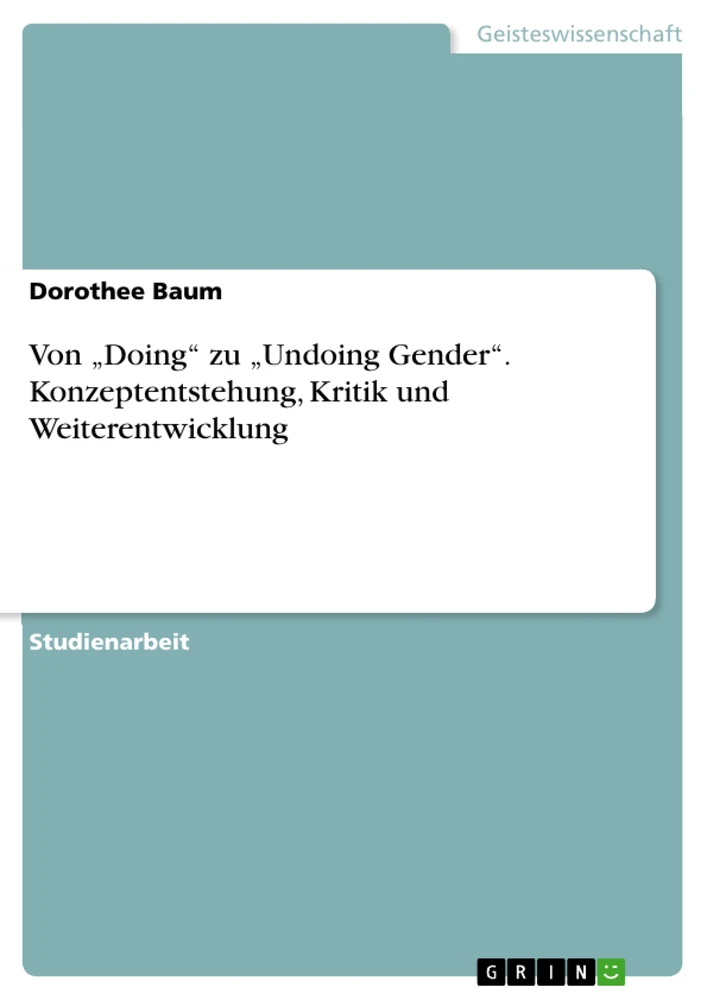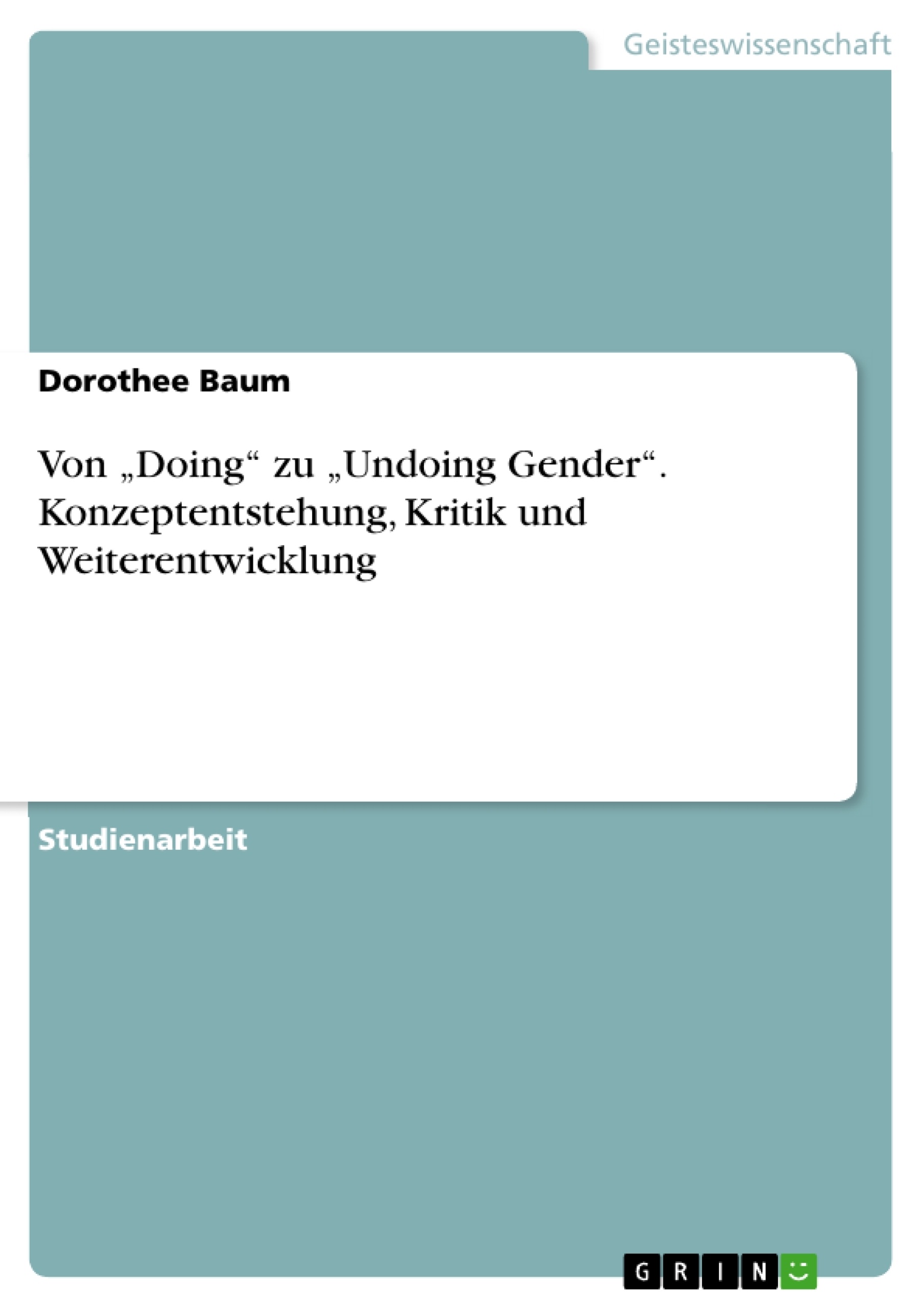Dieser Beitrag befasst sich mit der Entstehung des Konzeptes „doing gender“, seiner Kritik dran und seiner Weiterentwicklung. An erster Stelle wird das auf Candace West und Don H. Zimmerman und mit ihnen auf die Transsexuellenstudien von Suzanne Kessler und Wendy McKenna und insb. jene von Harold Garfinkel zurückgehende Konzept des „doing gender“ erläutert. Fortgesetzt wird mit der Weiterentwicklung dieses Konzeptes bei West und Sarah Fenstermaker (doing difference) und bei Judith Lorber (Genderparadoxien).
Im Anschluss wird die Kritik am Konzept des „doing gender“ zusammengefasst, drauf aufbauend werden drei prominente Gegenkonzepte erläutert: das „undoing gender“ bei Francine M. Deutsch und bei Stefan Hirschauer sowie das „degendering“ bei Judith Lorber. Abschließend wird dem ethnomethodologischen Konzept des „doing gender“ von West und Zimmerman der diskurstheoretischer Ansatz Judith Butlers („gender performance“) gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung.
- II) Das Konzept des Doing Gender: West/Zimmerman
- III) Ausgangspunkt: Transsexuellen-Studien.
- IV) Sex, Sex-Category und Gender......
- V) Fortbildung des Konzeptes des Doing Gender
- A. Doing Difference: Festermaker/West..
- B. Genderparadoxien: Lorber..
- VI) Kritik am Konzept des Doing Gender
- A. Soziale Veränderung vs. Omnirelevanz von Gender
- B. Verselbstständigung des Konzeptes des Doing Gender
- C. Omnipräsenz und differenzielle Relevanz: Gildemeister
- VII) Undoing Gender und Degendering..
- A. Undoing Gender bei Deutsch
- B. Degendering bei Lorber.
- C. Undoing Gender bei Hirschauer.
- VIII) Performing Gender: Butler.
- IX) Schlusswort..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag befasst sich mit der Entstehung des Konzepts „doing gender“, seiner Kritik und seiner Weiterentwicklung. Der Text beleuchtet das Konzept von West und Zimmerman, seine Weiterentwicklung und die Kritik daran. Außerdem werden alternative Konzepte wie „undoing gender“ und „degendering“ sowie der Ansatz der Gender Performance von Judith Butler vorgestellt.
- Entstehung und Entwicklung des Konzepts „doing gender“
- Kritik an der Konzeption des „doing gender“
- Alternative Konzepte zur Regulierung von Geschlechterverhältnissen
- Beziehung zwischen gesellschaftlichen Normen und der Herstellung von Gender
- Das Konzept des „doing gender“ im Kontext von Intersektionalität
Zusammenfassung der Kapitel
I) Einleitung
Dieser Abschnitt führt das Konzept „doing gender“ ein und beschreibt die Themenbereiche, die im Beitrag behandelt werden.
II) Das Konzept des Doing Gender: West/Zimmerman
Dieser Abschnitt beschreibt das ethnomethodologische Konzept des „doing gender“ von West und Zimmerman und dessen Entstehung aus den Transsexuellen-Studien. Die Autoren betonen, dass Geschlecht nicht als feststehende Eigenschaft, sondern als ein fortlaufender Herstellungsprozess zu verstehen ist, der durch alltägliche Interaktionen reproduziert wird.
III) Ausgangspunkt: Transsexuellen-Studien
Dieser Abschnitt beleuchtet die Transsexuellen-Studien als Ursprung des Konzepts. Die Studien von Kessler/McKenna und Garfinkel zeigen, dass weibliches bzw. männliches Verhalten erlernt werden muss, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden, und dass die Vorstellung einer biologisch begründeten Zweigeschlechtlichkeit tief verankert ist.
IV) Sex, Sex-Category und Gender
Dieser Abschnitt stellt die analytische Dreiteilung von West und Zimmerman in die Kategorien Sex, Sex-Category und Gender vor. Sex bezieht sich auf die Geburtsklassifikation, Sex-Category auf die soziale Zuordnung und Gender auf das soziale Geschlecht, das durch situationsadäquates Verhalten erlernt und reproduziert wird.
V) Fortbildung des Konzeptes des Doing Gender
A. Doing Difference: Festermaker/West
Dieser Abschnitt beschreibt die Weiterentwicklung des Konzepts des „doing gender“ zu „doing difference“ von West und Fenstermaker. Dabei wird die Bedeutung von Rasse und Klasse als weitere Differenzkategorien im Zusammenspiel mit Geschlecht hervorgehoben.
B. Genderparadoxien: Lorber
Dieser Abschnitt präsentiert die Konzeption von Judith Lorber, die sich mit den Paradoxien des Geschlechts befasst und die Konstruktion von Geschlechterrollen und deren Folgen für die Gesellschaft beleuchtet.
VI) Kritik am Konzept des Doing Gender
Dieser Abschnitt fasst die Kritik am Konzept des „doing gender“ zusammen und stellt drei prominente Gegenkonzepte vor: „undoing gender“ bei Deutsch und Hirschauer sowie „degendering“ bei Lorber.
VII) Undoing Gender und Degendering..
Dieser Abschnitt beleuchtet die Konzepte von „undoing gender“ und „degendering“ und deren Bedeutung in der Debatte über Gender und soziale Normen.
VIII) Performing Gender: Butler
Dieser Abschnitt stellt das diskurstheoretische Konzept von Judith Butler „gender performance“ vor und setzt es dem ethnomethodologischen Konzept des „doing gender“ von West und Zimmerman gegenüber.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieses Beitrags sind: doing gender, doing difference, undoing gender, degendering, gender performance, ethnomethodologie, Transsexuellenstudien, Sex, Sex-Category, Gender, Rasse, Klasse, Intersektionalität, soziale Konstruktion, gesellschaftliche Normen, Geschlechterverhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept "Doing Gender"?
Nach West und Zimmerman ist Geschlecht keine feststehende Eigenschaft, sondern ein fortlaufender Herstellungsprozess ("Doing"), der in alltäglichen Interaktionen reproduziert wird.
Was ist der Unterschied zwischen Sex, Sex-Category und Gender?
West und Zimmerman unterscheiden zwischen der biologischen Geburtsklassifikation (Sex), der sozialen Zuordnung durch andere (Sex-Category) und dem sozialen Geschlecht durch situationsadäquates Verhalten (Gender).
Was versteht man unter "Undoing Gender"?
Das Konzept von Francine Deutsch beschreibt soziale Interaktionen, die Geschlechterdifferenzen eher verringern oder auflösen, statt sie (wie beim "Doing Gender") zu verstärken.
Wie definiert Judith Butler "Gender Performance"?
Butler versteht Geschlecht als eine performative Tat, die durch ständige Wiederholung diskursiver Normen erst die Illusion einer stabilen Identität erzeugt.
Welche Rolle spielten Transsexuellen-Studien für diese Konzepte?
Studien an Transsexuellen zeigten, dass männliches oder weibliches Verhalten aktiv erlernt und "aufgeführt" werden muss, um gesellschaftlich anerkannt zu werden, was die Konstruiertheit von Geschlecht beweist.
- Citar trabajo
- Dorothee Baum (Autor), 2014, Von „Doing“ zu „Undoing Gender“. Konzeptentstehung, Kritik und Weiterentwicklung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308125