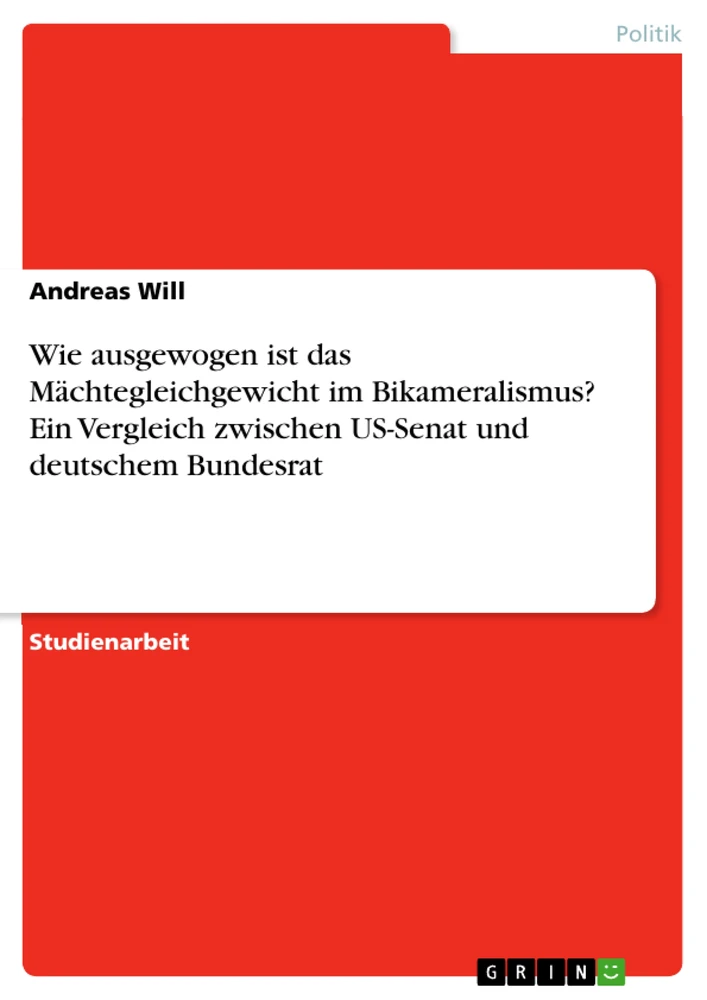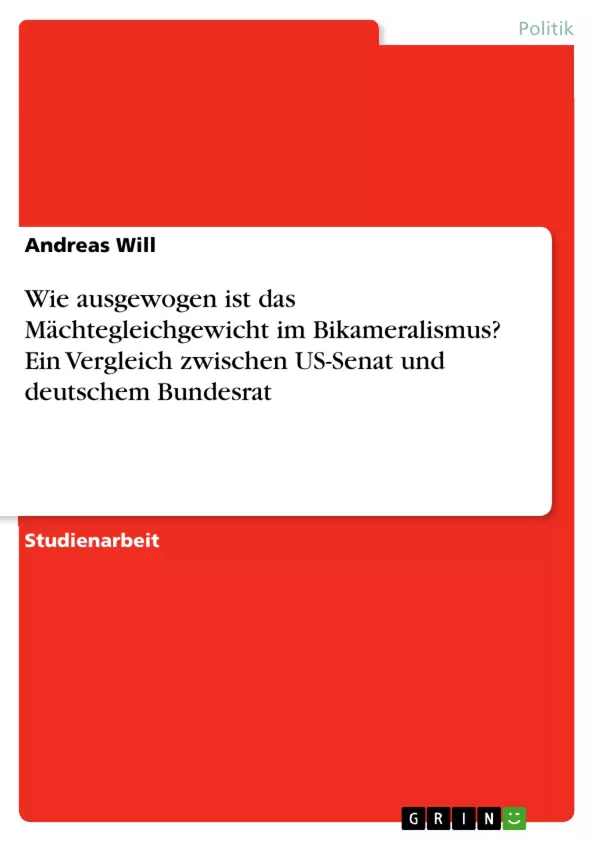Die Idee einer zweiten Kammer ist in der deutschen Geschichte bis auf die Bundesversammlung des Deutschen Bundes 1815 zurückzuführen. Bismarck berief sich auf diese, als er 1871 eine zweite Kammer verfassungsrechtlich festschrieb. Nach dem zweiten Weltkrieg (im Jahre 1948) wurde der sog. „Parlamentarische Rat“ durch die Alliierten (Besatzungsmächte) eingesetzt. Hier diskutieren die vom Landesparlament gewählten Abgeordneten zwischen dem von SPD geforderten Senatsmodell nach US-amerikanischem Beispiel und dem von CDU/CSU vertretenen Bundesratsmodell als zweite Kammern.
Im November 1948 einigte man sich auf eine „abgeschwächte Bundesratslösung“. Dies wurde durch die Verabschiedung eines neuen Grundgesetzes 1949 gesichert (Art. 20 GG: „Ewigkeitsklausel“).
Bis etwa 1780 herrschte in den USA dagegen die Überzeugung einer reinen Demokratie durch ein Einkammersystem („the popular branch of government“). Die föderale Ordnung allerdings bedingte ein Zweikammersystem, so wurde 1781 die erste nationale Verfassung („Articles of Confederation“) verabschiedet. Dies hatte die Einrichtung des heutigen Kongresses zur Folge. Er stellte sowohl Exekutiv- als auch Legistlativorgan dar, allerdings besaß er sehr beschränkte Kompetenzen.
Auf dem Konvent von Philadelphia 1787 fand – ähnlich wie in der deutschen Geschichte – eine Debatte zwischen zwei konträren Systemen statt. Einerseits der für zwei gleichberechtigte Kammern als Legislative stimmende „Virginia-Plan“, andererseits der New Yersey-Plan, welcher sich für ein Einkammersystem mit erweiterten Kompetenzen aussprach. Das Ergebnis war die Einrichtung einer zweiten Kammer des Kongresses: der „heutige“ US-Senat. Da das Repräsentantenhaus bereits per Direktwahl durch das Volk ernannt wurde, kam die Diskussion des Wahlsystems für den Senat auf. Folgendes wurde durch den „Great Compromise“ festgelegt: Jeder Einzelstaat wird zwei Senatoren entsenden. Dies sollte die Diskrepanz zwischen großen und kleinen Gliedstaaten „bekämpfen“.
Es folgt nun eine Zusammenstellung der Gegebenheiten in beiden Systemen, welche letzten Endes in Hinblick auf das Mächtegleichgewicht zwischen den jeweils beiden Kammern ausgewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Historische Entwicklung des Bikameralismus in den USA und Deutschland
- 2. „Wie ausgewogen ist das Mächtegleichgewicht im Bikameralismus?“ – Ein Vergleich zwischen Deutschem Bundesrat und US-Senat
- 2.1 Der deutsche Bundesrat
- 2.1.1 Zusammensetzung
- 2.1.2 Beteiligung am Gesetzgebungsprozess
- 2.1.3 Weitere Funktionen
- 2.1.4 Form des Föderalismus
- 2.1.5 Politikverflechtung
- 2.2 Der US-Senat
- 2.2.1 Zusammensetzung
- 2.2.2 Beteiligung am Gesetzgebungsprozess
- 2.2.3 Weitere Funktionen
- 2.2.4 Form des Föderalismus
- 2.2.5 Parteizugehörigkeit
- 2.1 Der deutsche Bundesrat
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit vergleicht die zweite Kammer des deutschen Bundestages (Bundesrat) und des US-amerikanischen Kongresses (Senat) hinsichtlich ihres Einflusses auf das jeweilige politische System. Ziel ist es, das Mächtegleichgewicht im Bikameralismus beider Länder zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung des Bikameralismus in Deutschland und den USA
- Zusammensetzung und Funktionsweise des deutschen Bundesrates
- Zusammensetzung und Funktionsweise des US-Senats
- Beteiligung beider Kammern am Gesetzgebungsprozess
- Auswirkungen des Bikameralismus auf das Mächtegleichgewicht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Historische Entwicklung des Bikameralismus in den USA und Deutschland: Der Text beschreibt die Entwicklung des Bikameralismus in Deutschland und den USA. In Deutschland reicht die Idee einer zweiten Kammer bis zur Bundesversammlung von 1815 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg einigte man sich auf ein abgeschwächtes Bundesratsmodell. In den USA hingegen dominierte bis etwa 1780 die Idee einer reinen Demokratie mit Einkammersystem. Die föderale Ordnung führte jedoch zur Einrichtung eines Zweikammersystems mit dem Kongress, der sowohl Exekutiv- als auch Legislativfunktionen ausübte. Der Philadelphia-Konvent von 1787 mündete in einem Kompromiss zwischen einem Zweikammersystem (Virginia-Plan) und einem Einkammersystem (New Jersey-Plan), resultierend in der Einrichtung des Senats mit je zwei Senatoren pro Staat.
2. „Wie ausgewogen ist das Mächtegleichgewicht im Bikameralismus?“ – Ein Vergleich zwischen Deutschem Bundesrat und US-Senat: Dieser Abschnitt vergleicht den deutschen Bundesrat und den US-Senat. Der Bundesrat, dessen Mitglieder von den Landesregierungen entsandt werden, unterliegt keiner festen Legislaturperiode und seine Zusammensetzung wechselt unregelmäßig. Die Stimmenverteilung orientiert sich an der Bevölkerungsgröße der Länder. Der Bundesrat besitzt ein suspensives Vetorecht bei Einspruchsgesetzen und ein absolutes Vetorecht bei Zustimmungsgesetzen. Der Vergleich mit dem US-Senat, dessen Mitglieder direkt vom Volk gewählt werden und einer festen Amtszeit unterliegen, hebt die Unterschiede in der Zusammensetzung, der Funktionsweise und dem Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess hervor. Der Abschnitt analysiert die jeweiligen Rollen der Kammern im Gesetzgebungsprozess und die Mechanismen zur Konfliktlösung.
Schlüsselwörter
Bikameralismus, Bundesrat, US-Senat, Gesetzgebungsprozess, Mächtegleichgewicht, Föderalismus, Zweite Kammer, Parlamentarismus, Vetorecht, Gesetzgebung, Demokratie, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich von Bundesrat und US-Senat
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht den deutschen Bundesrat und den US-amerikanischen Senat, die zweiten Kammern ihrer jeweiligen Parlamente. Der Fokus liegt auf dem Einfluss beider Kammern auf ihre politischen Systeme und der Analyse des Mächtegleichgewichts im Bikameralismus beider Länder. Die Arbeit beinhaltet eine historische Entwicklung, eine Beschreibung der Zusammensetzung und Funktionsweise beider Kammern und eine Analyse ihrer Rolle im Gesetzgebungsprozess.
Welche Aspekte des Bikameralismus werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die historische Entwicklung des Bikameralismus in Deutschland und den USA, die Zusammensetzung und Funktionsweise des Bundesrates und des Senats, die Beteiligung beider Kammern am Gesetzgebungsprozess (inkl. Vetorechte), die Auswirkungen des Bikameralismus auf das Mächtegleichgewicht in beiden Ländern und die jeweiligen Formen des Föderalismus.
Wie ist der Bundesrat zusammengesetzt und wie funktioniert er?
Der deutsche Bundesrat wird von den Landesregierungen entsandt, hat keine feste Legislaturperiode und seine Zusammensetzung ändert sich unregelmäßig. Die Stimmenverteilung orientiert sich an der Bevölkerungsgröße der Bundesländer. Er besitzt ein suspensives Vetorecht bei Einspruchsgesetzen und ein absolutes Vetorecht bei Zustimmungsgesetzen. Die Arbeit untersucht auch die Politikverflechtung im Bundesrat.
Wie ist der US-Senat zusammengesetzt und wie funktioniert er?
Die Mitglieder des US-Senats werden direkt vom Volk gewählt und haben eine feste Amtszeit. Der Vergleich hebt die Unterschiede in der Zusammensetzung, der Funktionsweise und dem Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess im Vergleich zum Bundesrat hervor. Die Arbeit analysiert auch die Rolle der Parteizugehörigkeit im Senat.
Welche Rolle spielen die Vetorechte im Vergleich?
Sowohl der Bundesrat als auch der Senat verfügen über Vetorechte. Der Bundesrat hat ein suspensives Veto (aufschiebend) bei Einspruchsgesetzen und ein absolutes Veto bei Zustimmungsgesetzen. Die Arbeit vergleicht diese Vetorechte mit den entsprechenden Mechanismen im US-Senat und analysiert deren Auswirkungen auf das Mächtegleichgewicht.
Welche historischen Entwicklungen werden beleuchtet?
Die Arbeit beschreibt die historische Entwicklung des Bikameralismus in beiden Ländern. In Deutschland reicht die Idee einer zweiten Kammer bis zur Bundesversammlung von 1815 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand ein abgeschwächtes Bundesratsmodell. In den USA dominierte bis etwa 1780 die Idee einer reinen Demokratie. Die föderale Ordnung führte zur Einrichtung eines Zweikammersystems mit dem Kongress. Der Philadelphia-Konvent von 1787 mündete in einem Kompromiss, der zur Einrichtung des Senats führte.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht ein Fazit über den Vergleich des Mächtegleichgewichts im Bikameralismus Deutschlands und der USA. Sie zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Zusammensetzung, den Funktionen und dem Einfluss beider Kammern auf. Das genaue Fazit wird im Kapitel 3 dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Bikameralismus, Bundesrat, US-Senat, Gesetzgebungsprozess, Mächtegleichgewicht, Föderalismus, Zweite Kammer, Parlamentarismus, Vetorecht, Gesetzgebung, Demokratie, Repräsentation.
- Citar trabajo
- Andreas Will (Autor), 2014, Wie ausgewogen ist das Mächtegleichgewicht im Bikameralismus? Ein Vergleich zwischen US-Senat und deutschem Bundesrat, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311065