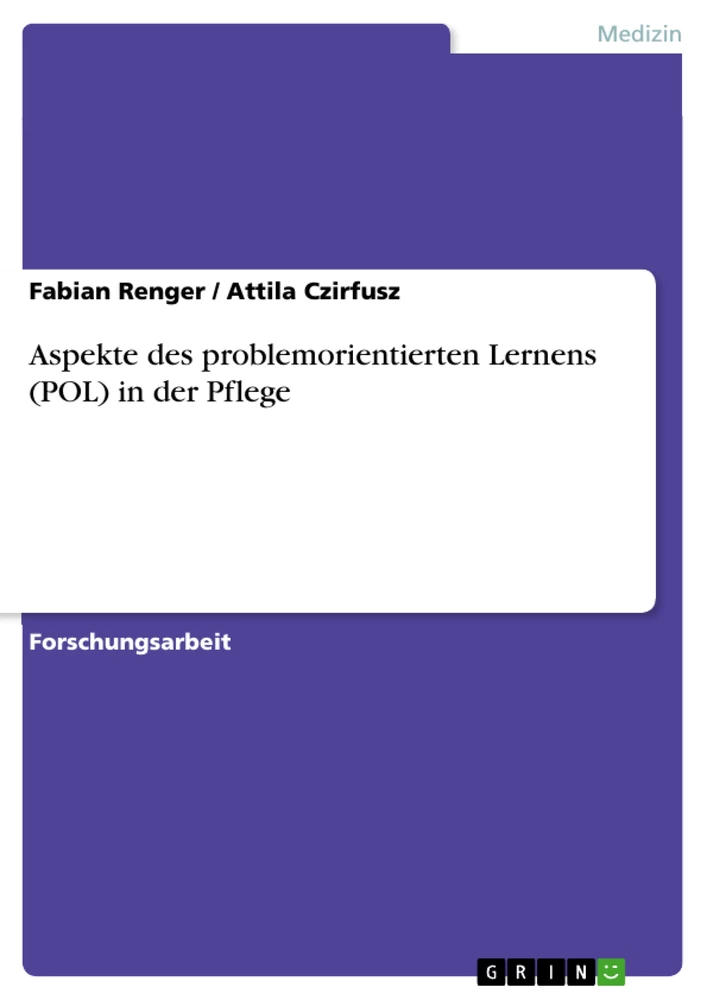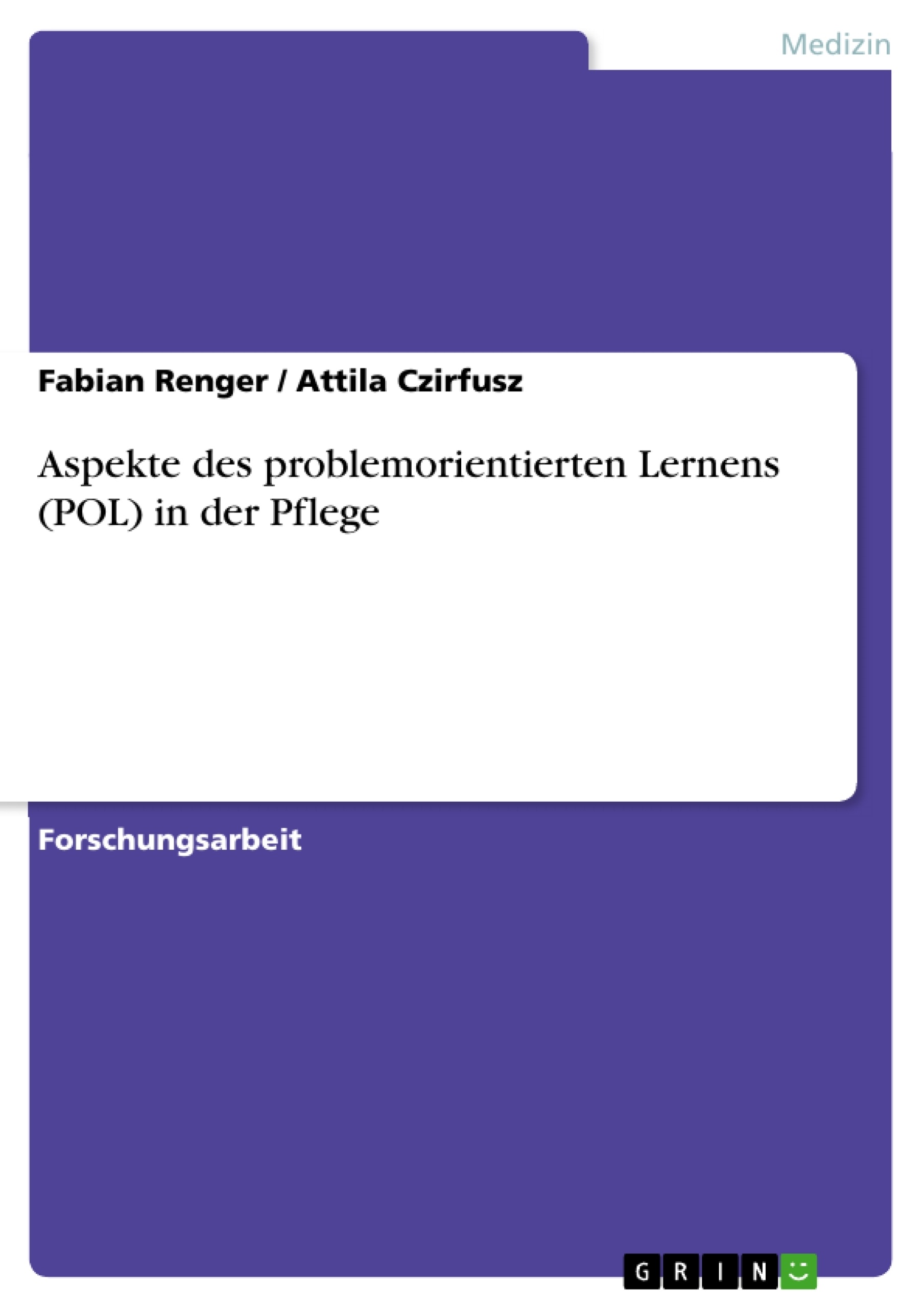Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Aspekten des problemorientierten Lernens (POL) in der Pflege.
Ströbel und Weidner beschreiben die Pflegebedürftigkeit als ein multidimensionales und vielschichtiges Phänomen. Es kann weder auf eine Ursache reduziert werden noch sind Auswirkungen von Einschränkungen und Entwicklungen vergleichbar. Der Pflege bedürftig zu sein, ist Teil menschlichen Lebens. Sorgende Zuwendung und Unterstützung anzunehmen und zu geben, ist die Basis jeder menschlichen Gemeinschaft.
So pflegen Eltern ihre Kinder, Kinder oder Schwiegerkinder ihre Eltern, und selbstverständlich werden auch kranke und behinderte Menschen gepflegt. Ströbel und Weidner merken an, dass ein allgemeines Verständnis von Pflegebedürftigkeit, welches die Laienpflege prägt, für den beruflichen Kontext konkretisiert werden muss. Die Zuschreibungen und der Bedeutungsgehalt zum Begriff „Pflegebedürftigkeit“ variieren jedoch je nach Zusammenhang und Disziplin.
In Anlehnung an Ströbel und Weidner führen Beeinträchtigungen, die Hilfe erfordern und nicht selbst kompensiert werden können, zu Pflegebedürftigkeit. Neben der Heilung einer verursachenden Krankheit stehen im Mittelpunkt des Handelns die Gestaltung und die Bewältigung des Lebensalltages. Systematisierung, Klassifizierung und Standardisierung von Beeinträchtigungen sind innerhalb der Gesundheitswissenschaften unterschiedlich. Sie sind abhängig von der konzeptionellen Grundlage, auf die sich die Gesundheit bezieht.
Inhaltsverzeichnis
- Pflege-Arbeit
- Eigener Gegenstand und Potential nicht benannt
- Fallarbeit
- Begriffsklärung
- Problemorientiertes Lernen in der Pflegeausbildung
- Problemorientiertes Lernen - neuer Wein in alten Schläuchen oder eher alter Wein in neuen Schläuchen?
- Ausbildungskonzepte
- Problemorientiertes Lernen - Transfer durch die Erweiterung von Situationsdeutungen
- Lehren als Drahtseilakt zwischen Instruktion und Konstruktion - Versuch einer Annäherung am Beispiel der Gestaltung eines POL-Unterrichts in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung
- Reflexive Praxis mittels Fallarbeit als didaktische Methode
- Pflegetheorie, Lernfelder und Problemorientiertes Lernen - Entwicklung eines Curriculums für Altenpflege in Ägypten
- Der Lernbereich Training & Transfer
- Entwicklung einer Modellschule mit Skillslabs als drittem Lernort und einem Problem-based Learning Curriculum
- Strukturierte Informationssammlung (SIS)
- Pragmatik
- Begriffsklärung
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Implementierung und Gestaltung von problemorientiertem Lernen (POL) in der Pflegeausbildung. Sie analysiert die Vorteile und Herausforderungen dieser Lernmethode und stellt verschiedene Konzepte und Ansätze vor.
- Analyse der Vorteile und Herausforderungen von POL in der Pflegeausbildung
- Entwicklung von Konzepten und Ansätzen für die Gestaltung von POL-Unterricht
- Bedeutung von Fallarbeit und Praxisreflexion im Kontext von POL
- Integration von Pflegetheorie und Lernfeldern in POL-Curricula
- Bedeutung des Lernbereichs Training & Transfer für die Anwendung von POL in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Pflege-Arbeit
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Pflegebedürftigkeit und erläutert die multidimensionalen Aspekte dieses Phänomens. Es wird die Bedeutung von sorgender Zuwendung und Unterstützung in menschlichen Gemeinschaften hervorgehoben.
Eigener Gegenstand und Potential nicht benannt
Dieses Kapitel beschreibt die Pflegewissenschaft als eine Praxis- und Handlungswissenschaft, die sich mit der Frage „Was ist zu tun?“ beschäftigt. Es wird die Rolle der Pflegeforschung bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Pflegepraxis betont.
Fallarbeit
Dieses Kapitel stellt die methodische Vorgehensweise des problemorientierten Lernens (POL) vor. Es wird die Bedeutung des selbstgesteuerten Wissenserwerbs anhand von Fallbeispielen und die Förderung des Transfers von theoretischem Wissen in die Praxis betont.
Begriffsklärung
Dieses Kapitel definiert den Begriff des problemorientierten Lernens (POL) und setzt ihn in den Kontext der Pflegeausbildung. Es werden verschiedene Ansätze und Ausrichtungen von POL vorgestellt.
Ausbildungskonzepte
Dieses Kapitel stellt verschiedene Konzepte und Ansätze für die Gestaltung von POL-Unterricht in der Pflegeausbildung vor. Es werden die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Auszubildenden, die Förderung von selbstgesteuertem Lernen und die Vermeidung von trägem Wissen berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Problemorientiertes Lernen, Pflegeausbildung, Fallarbeit, Praxisreflexion, Pflegetheorie, Lernfelder, Training & Transfer, Skillslabs, Curriculum, Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Problemorientiertes Lernen (POL) in der Pflege?
POL ist eine didaktische Methode, bei der Auszubildende Wissen selbstgesteuert anhand von konkreten Praxisbeispielen (Fällen) erwerben, statt nur theoretische Instruktionen zu erhalten.
Warum ist Pflegebedürftigkeit ein multidimensionales Phänomen?
Pflegebedürftigkeit lässt sich nicht auf eine einzige Ursache reduzieren. Sie umfasst körperliche, psychische und soziale Einschränkungen, die die Gestaltung des Lebensalltags beeinflussen.
Was sind Skillslabs in der Pflegeausbildung?
Skillslabs sind geschützte Lernorte (Trainingsräume), in denen praktische Fertigkeiten realitätsnah geübt werden können, bevor sie am Patienten angewendet werden.
Wie hilft Fallarbeit beim Transfer von Wissen?
Durch die Arbeit an realen Fällen lernen Auszubildende, theoretische Konzepte auf die Praxis zu beziehen, was die Entstehung von „trägem Wissen“ verhindert und die Problemlösungskompetenz stärkt.
Was bedeutet „Training & Transfer“ im Curriculum?
Dieser Lernbereich dient dazu, die Lücke zwischen Theorie (Schule) und Praxis (Pflegealltag) zu schließen, indem Handlungsmuster gezielt eingeübt und reflektiert werden.
Welche Rolle spielt die Pflegewissenschaft bei POL?
Die Pflegewissenschaft liefert die theoretische Basis und die Forschungsergebnisse, die in POL-Curricula integriert werden, um eine evidenzbasierte Pflegepraxis zu fördern.
- Citar trabajo
- Fabian Renger (Autor), Attila Czirfusz (Autor), 2016, Aspekte des problemorientierten Lernens (POL) in der Pflege, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320933