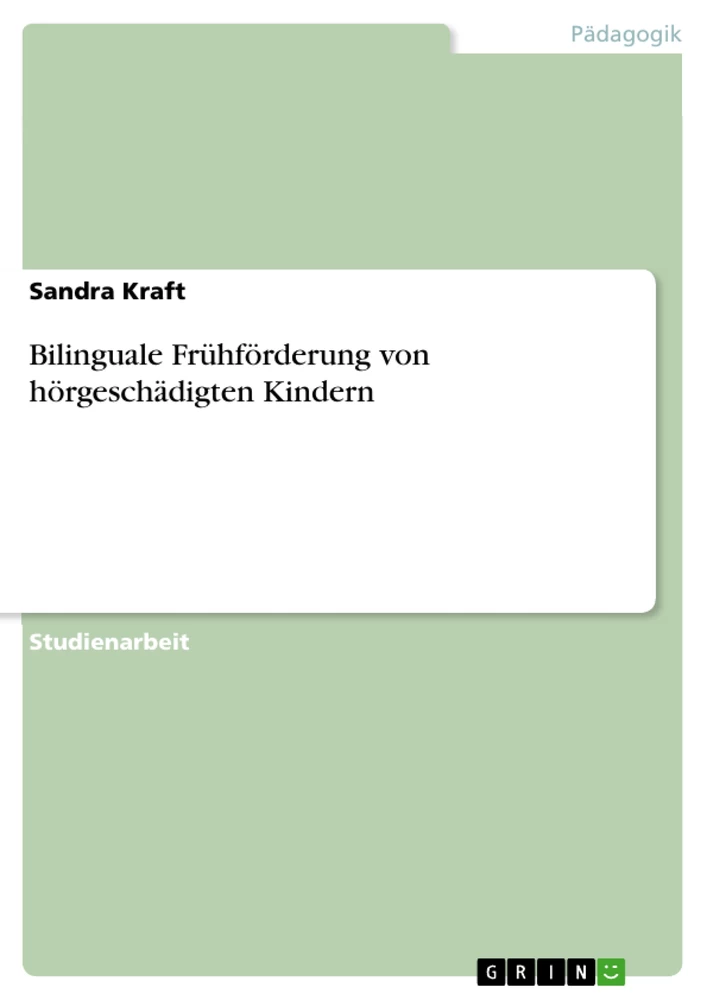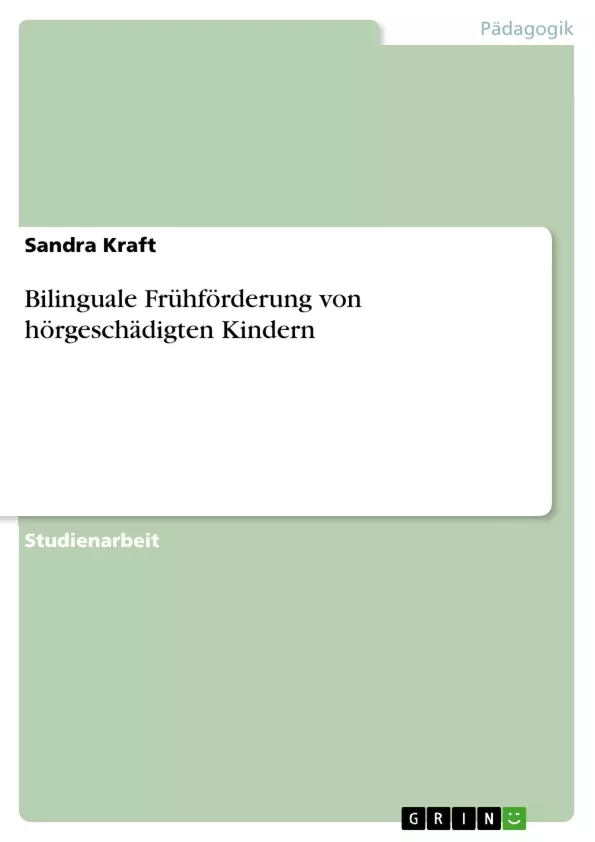Die Idee, eine Arbeit über die Personengruppe der Hörgeschädigten zu schreiben, kam mir, als ich zur Vorbereitung auf eine mündliche Studienleistung in einem Seminar über unterstützte Kommunikation eine Gruppe Gehörloser besuchte, um Eindrücke und Informationen direkt von Betroffenen zu sammeln. Als ich darüber nachdachte, wie ungewohnt es für mich ist, als einziger, die Sprache der Anwesenden nicht zu verstehen (dort wurde gebärdet), wurde mir erst bewusst, dass dieser Zustand für die Menschen im Raum Alltag sein muss, da schließlich die Mehrheit der lautsprachlich kommunizierenden Menschen keine Gebärdensprache beherrscht. Lediglich durch einen Dolmetscher konnte ich mich unterhalten, bis schließlich einer der Gehörlosen anfing, sich mir per Lautsprache mitzuteilen.
Damit fing ich an, mich für die vorliegende Arbeit in das Themenfeld der Hörgeschädigten/-pädagogik einzulesen, um mir ein Bild zu verschaffen. Dass dieses Themenfeld so komplex ist, wie es sich schließlich darstellte, hätte ich nicht erahnt. Tatsächlich liest man in diesem Themenbereich oft sehr ähnliche Fragestellungen, wie ich sie mir selbst stellte. Die Möglichkeiten des Lautspracherwerbs für gehörlose Menschen haben sich in den letzten Jahren durch technische/medizinische Fortschritte stetig verbessert.
Auf den ersten Blick, liest sich das als sehr positive Entwicklung, da man automatisch davon ausgeht, dass Menschen sich mit Lautsprache besser in der Gesellschaft bewegen können, als mit Gebärden. Dennoch begegneten mir in vielen Texten immer wieder Aussagen, die darauf hindeuten, dass Gebärdensprache deswegen nicht ausgeschlossen werden soll und durchaus hilfreich für die Entwicklung gehörloser Menschen sein kann. Sind das nun zwei Förderwege? Gebärden, oder Lautsprache? Warum nicht einfach beides?
Da im Studiengang der Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Begriff Inklusion gern und häufig benutzt wird, dachte ich mir, ich versuche auch darauf Bezug zu nehmen. Denn was spricht auf den ersten Blick nicht mehr für Inklusion, als die Förderung einer Sprache, die die Mehrheit spricht? Da sich der natürliche Spracherwerb einer Erstsprache in frühen Kindesjahren vollzieht, will ich meinen Fokus auf diesen vorschulischen Lebensabschnitt legen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hörschädigung
- Hörgeschädigte
- Technische Ausstattung
- Hörgeräte
- Cochlea-Implantat
- Vorschulische Fördermöglichkeiten
- Inklusion
- Bilinguale Förderung im Sinne von Inklusion?
- Die besondere Bedeutung der Frühförderung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob ein bilinguales Förderkonzept in der Früherziehung hörgeschädigter Kinder sinnvoll ist, um ihnen einen Lebensweg unter dem Zeichen der Inklusion zu ermöglichen.
- Definition von Hörgeschädigten und die unterschiedlichen Gruppen (Schwerhörige, Gehörlose, Ertaubte)
- Technische Ausstattung zur Verbesserung des Hörvermögens (Hörgeräte, Cochlea-Implantat)
- Die Bedeutung der Frühförderung für die Entwicklung von Sprache und Kommunikation
- Das Konzept der Inklusion und seine Anwendung auf die Förderung hörgeschädigter Kinder
- Vorteile und Herausforderungen eines bilingualen Förderkonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit entstand aus dem persönlichen Eindruck der Autorin, als sie eine Gruppe Gehörloser besuchte und erkannte, wie schwierig es für Menschen ohne Gebärdensprachkenntnisse ist, sich mit dieser Gruppe zu verständigen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob ein bilinguales Förderkonzept in der Früherziehung hörgeschädigter Kinder sinnvoll ist, um ihnen einen Lebensweg unter dem Zeichen der Inklusion zu ermöglichen.
Hörschädigung
Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Gruppen innerhalb der Hörgeschädigten (Schwerhörige, Gehörlose, Ertaubte) und erläutert die technischen Ausstattungsmöglichkeiten (Hörgeräte, Cochlea-Implantat), die Hörgeschädigten zur Verbesserung ihres Hörvermögens zur Verfügung stehen. Der Fokus liegt dabei auf der prälingualen Hörschädigung, die für die Sprachentwicklung von Kindern besonders relevant ist.
Inklusion
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Inklusion und erläutert seine Bedeutung im Kontext der Förderung hörgeschädigter Kinder.
Bilinguale Förderung im Sinne von Inklusion?
Dieses Kapitel diskutiert die Vorteile und Herausforderungen eines bilingualen Förderkonzepts für hörgeschädigte Kinder und setzt es in Beziehung zum Inklusionsgedanken.
Die besondere Bedeutung der Frühförderung
Dieses Kapitel betont die Wichtigkeit der Frühförderung für hörgeschädigte Kinder, da in diesen frühen Jahren wichtige Weichen für die spätere Sprachentwicklung gestellt werden.
Schlüsselwörter
Hörgeschädigte, Gehörlose, Schwerhörige, Frühförderung, Inklusion, bilinguale Förderung, Lautsprache, Gebärdensprache, Cochlea-Implantat, Hörgeräte, Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet bilinguale Frühförderung für hörgeschädigte Kinder?
Es handelt sich um ein Förderkonzept, das sowohl die Lautsprache als auch die Gebärdensprache nutzt, um die Kommunikation und Entwicklung des Kindes optimal zu unterstützen.
Warum ist Frühförderung in diesem Bereich so wichtig?
Da sich der natürliche Spracherwerb in den ersten Lebensjahren vollzieht, müssen in dieser Phase die Weichen für die spätere Inklusion und Kommunikation gestellt werden.
Welche Rolle spielen Hörgeräte und Cochlea-Implantate (CI)?
Diese technischen Hilfsmittel verbessern das Hörvermögen erheblich und erleichtern den Erwerb der Lautsprache, ersetzen aber nicht zwingend die Vorteile der Gebärdensprache.
Ist bilinguale Förderung ein Weg zur Inklusion?
Ja, die Arbeit diskutiert, ob die Beherrschung beider Sprachen (Laut- und Gebärdensprache) die Teilhabe an der Gesellschaft verbessert und dem Inklusionsgedanken entspricht.
Was sind die Herausforderungen bei der Erziehung hörgeschädigter Kinder?
Herausforderungen liegen in der Entscheidung für den richtigen Förderweg und der Tatsache, dass die Mehrheit der Gesellschaft keine Gebärdensprache beherrscht.
- Quote paper
- Sandra Kraft (Author), 2012, Bilinguale Frühförderung von hörgeschädigten Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340180