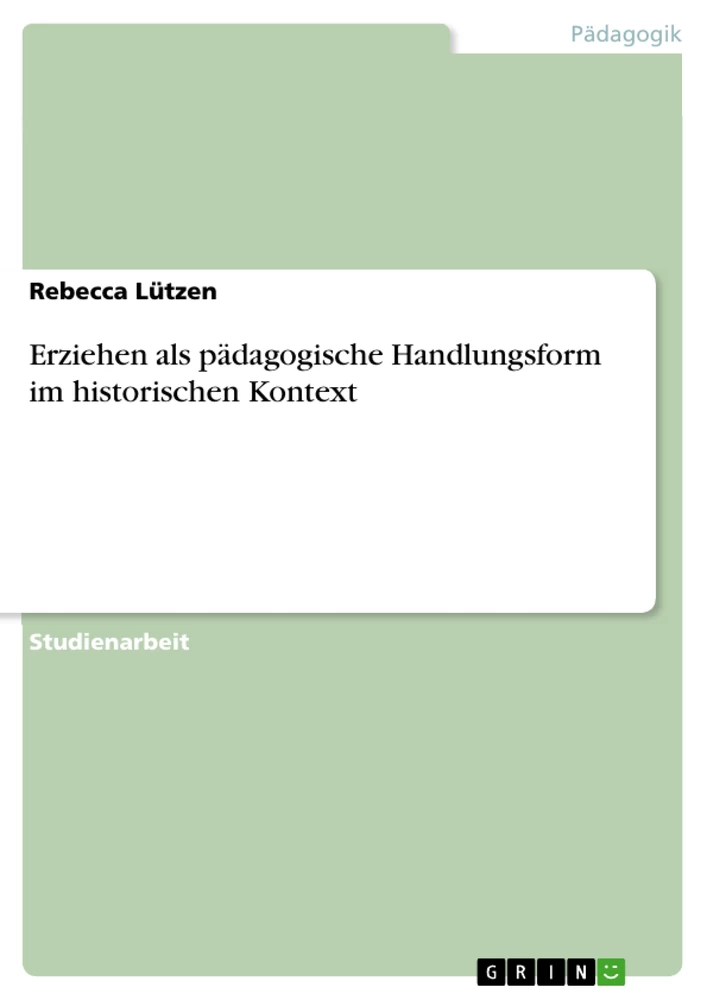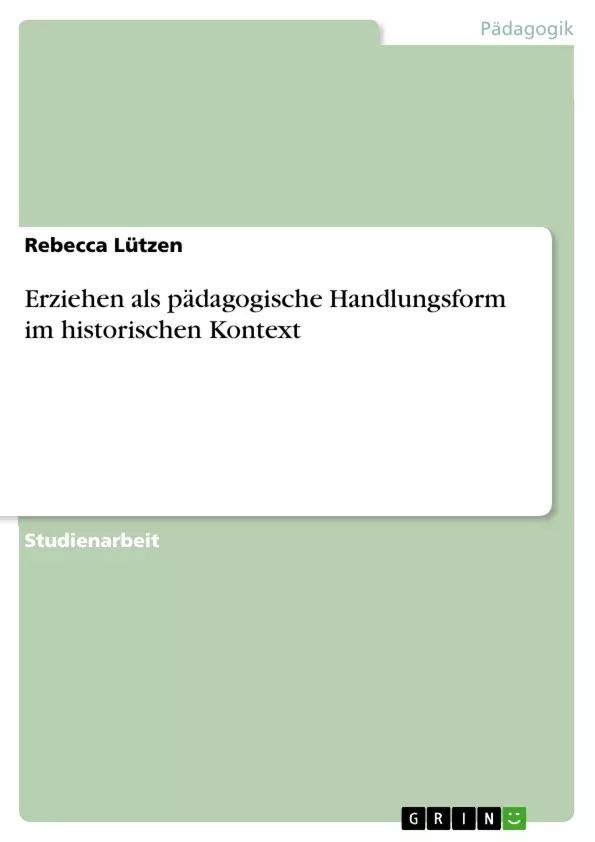Diese Arbeit setzt sich mit der Handlungsform des Erziehens kritisch auseinander. Im ersten Teil soll zunächst die Verbindung zur Wissenschaft der Pädagogik hergestellt werden, bevor im zweiten Teil näher auf den historischen Wandel der Erziehung eingegangen wird. Abschließend wird eine universelle Definition der Handlungsform formuliert und ein Fazit gezogen.
Zunächst einmal muss Erziehung als Konstrukt verstanden werden, da es sich um keinen Beobachtungsbegriff handelt. Das Erziehen ist nicht direkt beobachtbar, jedoch gibt es konkrete Verhaltensweisen, die als „Erziehung“ betrachtet werden können. Wenn man sich mit der Thematik befasst sollte man sich bewusst machen, dass ein großer Interpretationsspielraum zur Verfügung steht und die Rede über die Erziehung stets die Rede über die Rede der Erziehung ist.
Die Auseinandersetzung mit dem Menschen und das Streben nach Interaktion mit ihm machen es zu einem pädagogischen Phänomen. Aber nicht nur allein deswegen ist das Erziehen mit der Pädagogik verknüpft. Die Wissenschaft der Pädagogik leitet sich vom griechischen Wort paidagogike techne ab und bedeutet wörtlich „Knabenführungskunst“. Pädagogik soll sich mit der Erziehung der Kinder und Erwachsenen beschäftigen und ist so eng verwurzelt mit der Handlungsform des Erziehens. Im Folgenden soll nun betrachtet werden inwiefern sich das Verständnis von Erziehung von der Aufklärung bis zur Moderne gewandelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- II. Der historische Kontext des Erziehens
- 1. Die Aufklärung
- 1.1 Jean-Jaques Rousseau
- 1.2 Das aufklärerische Erziehen
- 2. Die deutsche Klassik und der Idealismus.
- 2.1 Immanuel Kant...
- 2.2 Erziehen im Idealismus......
- 3. Die pädagogische Romantik
- 3.1 Pestalozzi und der Gedanke der Volkserziehung..
- 3.2 Erziehen in der Romantik
- 4. Die Vormoderne........
- 4.1 Johann Friedrich Herbart.
- 4.2 Das vormoderne Erziehen
- 5. Moderne..
- 5.1 Maria Montessori.
- 5.2 Erziehen in der Moderne..
- 1. Die Aufklärung
- III. Fazit: Die Möglichkeit eines Universalverständnisses von Erziehen...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der pädagogischen Handlungsform des Erziehens und verfolgt das Ziel, diese kritisch zu beleuchten. Dabei wird zunächst die Verbindung zum Fach der Pädagogik hergestellt. Im anschließenden Teil wird der historische Wandel der Erziehung von der Aufklärung bis zur Moderne untersucht. Abschließend wird versucht, eine universelle Definition des Begriffs „Erziehen“ zu formulieren und ein Fazit zu ziehen.
- Der historische Wandel des Erziehungsbegriffs von der Aufklärung bis zur Moderne.
- Die verschiedenen Epochen und ihre spezifischen Einflüsse auf das Verständnis von Erziehung.
- Die Verbindung zwischen Erziehung und Pädagogik.
- Die Rolle der Vernunft, Natur und Gesellschaft in der Erziehung.
- Die Suche nach einer universellen Definition des Begriffs „Erziehen“.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
In der Einleitung wird der Begriff „Erziehen“ zunächst definiert und seine Verbindung zur Pädagogik hergestellt. Die Arbeit betont dabei den konstruktiven Charakter des Begriffs und die Wichtigkeit der Interpretation im Umgang mit ihm.
II. Der historische Kontext des Erziehens
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Epochen des Erziehens, von der Aufklärung bis zur Moderne, vorgestellt und ihre Einflüsse auf das Verständnis von Erziehung beleuchtet. Die Bedeutung von Vernunft, Natur und Gesellschaft in der Erziehung wird dabei hervorgehoben.
1. Die Aufklärung
Die Aufklärung als eine Schlüsselperiode für das Erziehungsverständnis wird näher betrachtet. Die Bedeutung der Vernunft, der Menschenrechte und der politischen Emanzipation für die Erziehung wird dabei hervorgehoben.
1.1 Jean-Jaques Rousseau
Rousseaus Erziehungsansatz wird in seinem Werk „Émile ou de l'éducation“ dargestellt. Die natürliche Erziehung, die auf die Eigenständigkeit des Zöglings abzielt, ist ein wichtiger Aspekt von Rousseaus Pädagogik.
1.2 Das aufklärerische Erziehen
Das aufklärerische Erziehen zeichnet sich durch die Betonung der Vernunft und die Förderung der Selbstständigkeit des Zöglings aus. Rousseau kritisiert dabei die Gesellschaft als ein Hindernis für die natürliche Entwicklung des Menschen.
2. Die deutsche Klassik und der Idealismus.
Die deutsche Klassik und der Idealismus stellen weitere wichtige Epochen für das Erziehungsverständnis dar. Die Bedeutung der Vernunft, der Moral und der Bildung für die Entwicklung des Menschen wird hier betont.
2.1 Immanuel Kant...
Immanuel Kant, ein wichtiger Vertreter des Idealismus, befasst sich mit dem Menschen als Vernunftwesen und dessen Aufgabe, seine Vernunft zu kultivieren.
2.2 Erziehen im Idealismus......
Der Idealismus sieht Erziehung als einen Prozess der Selbstvervollkommnung des Menschen durch die Kultivierung seiner Vernunft und Moral.
3. Die pädagogische Romantik
Die pädagogische Romantik betont die Bedeutung der Gefühlswelt und der Individualität des Menschen.
3.1 Pestalozzi und der Gedanke der Volkserziehung..
Pestalozzi setzt sich für eine Bildung für alle Kinder ein und betont die Wichtigkeit der praktischen Erfahrung in der Erziehung.
3.2 Erziehen in der Romantik
Die Romantik sieht Erziehung als einen Prozess der Entfaltung der individuellen Anlagen des Menschen. Die Gefühlswelt und die schöpferische Kraft des Menschen stehen dabei im Vordergrund.
4. Die Vormoderne........
Die Vormoderne zeichnet sich durch die Betonung von Vernunft, Ordnung und Disziplin in der Erziehung aus.
4.1 Johann Friedrich Herbart.
Herbart entwickelt ein pädagogisches System, das auf der Entwicklung des Willens und der Charakterbildung basiert.
4.2 Das vormoderne Erziehen
Das vormoderne Erziehen zielt auf die Entwicklung von Vernunft, Moral und Disziplin ab. Es legt dabei Wert auf eine geordnete und strukturierte Erziehung.
5. Moderne..
Die Moderne bringt neue Herausforderungen und Chancen für die Erziehung mit sich.
5.1 Maria Montessori.
Maria Montessori entwickelt ein pädagogisches Konzept, das die Selbsttätigkeit und die natürliche Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt stellt.
5.2 Erziehen in der Moderne..
Die Moderne ist geprägt von Individualismus, Pluralismus und neuen Bildungsidealen. Die Erziehung muss sich an die Herausforderungen dieser Zeit anpassen und auf die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft reagieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem historischen Wandel des Erziehungsbegriffs und der Verbindung von Erziehung und Pädagogik. Wichtige Schlüsselwörter sind: Aufklärung, Vernunft, Natur, Gesellschaft, Individualität, Moral, Bildung, Selbstständigkeit, Volkserziehung, Moderne, Maria Montessori.
- Arbeit zitieren
- Rebecca Lützen (Autor:in), 2014, Erziehen als pädagogische Handlungsform im historischen Kontext, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344654