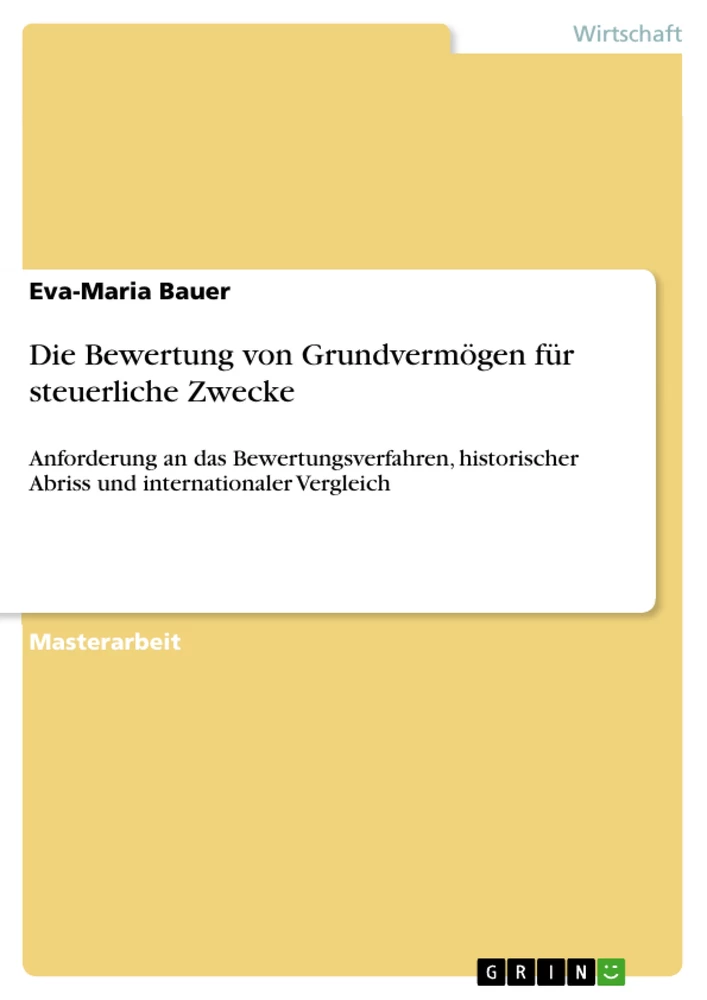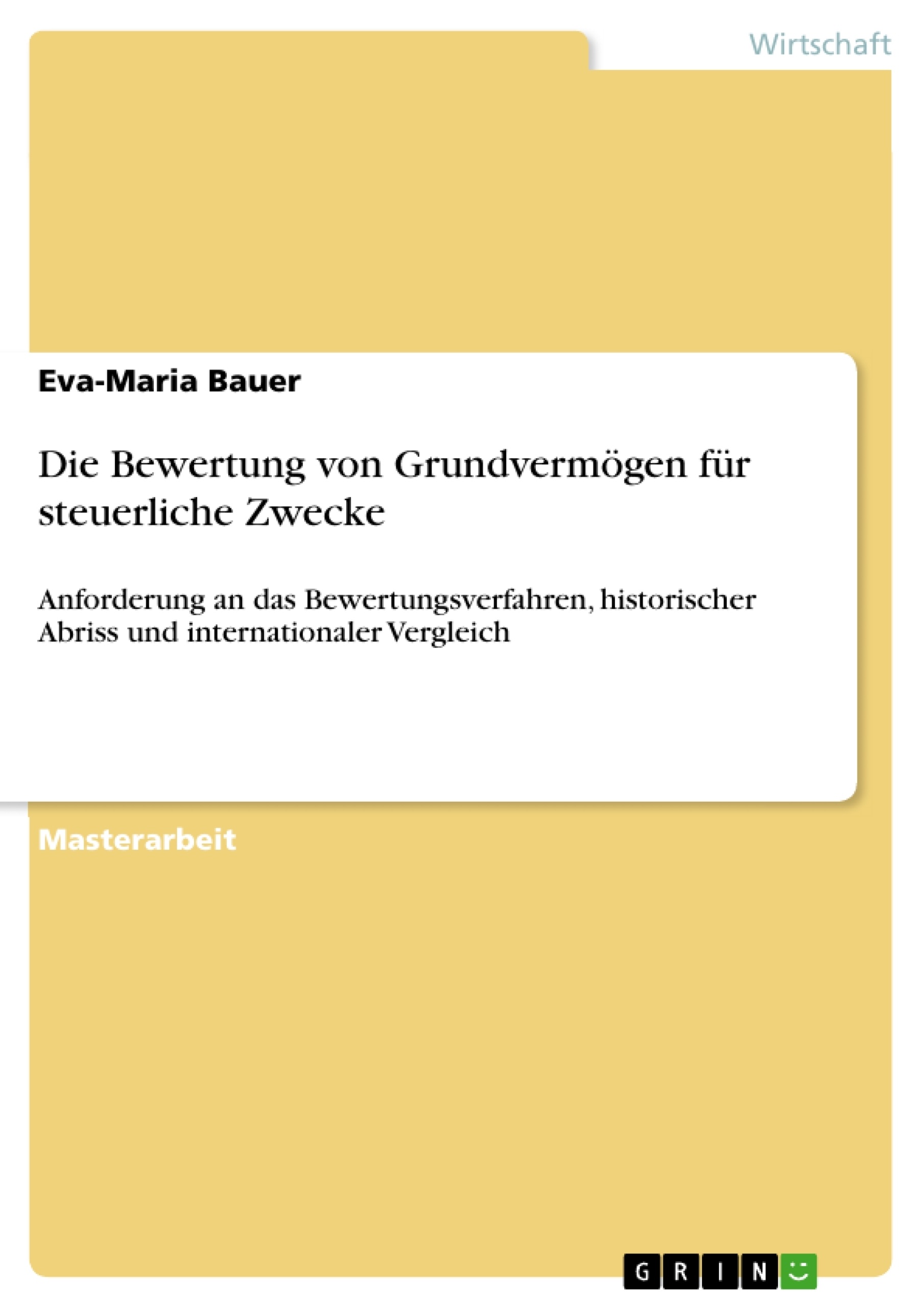Kapitel 2 der Arbeit beschäftigt sich näher mit dem Begriff des Grundvermögens und der Abgrenzung zu anderen Vermögensarten. Kapitel 3 geht auf die Relevanz einer Bewertung von Grundvermögen ein, stellt die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen für die Wertermittlung von Grundvermögen vor und zeigt die Bewertungsansätze auf nationaler und internationaler Ebene.
In Kapitel 4 werden die verfügbaren Bewertungsmaßstäbe ausführlich behandelt. Bewertungsmaßstäbe wie zB der gemeine Wert dienen nämlich zur Orientierung bei der Bewertung und geben vor, welcher Wert mittels Bewertungsverfahren zu ermitteln ist. Abhängig von dem zu ermittelnden Wert, sei es zB der gemeine Wert oder der Einheitswert, ist ein bestimmtes Wertermittlungsverfahren anzuwenden. In den Kapiteln 5 bis 7 werden sodann sowohl Wertermittlungsverfahren, die auf nationaler Ebene angewandt werden, als auch Bewertungsverfahren, die in anderen Nationen herangezogen werden, beschrieben. Kapitel 8 und 9 gehen in weiterer Folge auf die Kombination von Bewertungsverfahren und die Beurteilung der Wertermittlungsverfahren im Vergleich ein.
Kapitel 10 befasst sich mit der Einheitswertermittlung und zeigt, bei welchen Steuern in Österreich der Einheitswert heranzuziehen ist bzw war. Gleichzeitig wird ein Vergleich mit anderen Nationen vorgenommen und dargestellt, ob bei diesen bei der jeweiligen Steuerart auch der Einheitswert oder ein anderer Wert zu ermitteln ist.
Kapitel 11 setzt sich mit der anteiligen Wertermittlung von Grund und Boden und Gebäude auseinander. Dabei werden verschiedene Methoden vorgestellt, wie das Aufteilungsverhältnis ermittelt werden kann. Die Steuerreform 2015/2016 hat diesbezüglich im außerbetrieblichen Bereich eine Änderung des Aufteilungsverhältnisses herbeigeführt.
In einem abschließenden Kapitel werden die Relevanz eines Gutachtens sowie die Anforderungen an ein Gutachten im Abgabeverfahren erläutert. Mit einem Gutachten kann etwa die Bemessungsgrundlage oder das oben genannte Aufteilungsverhältnis nachgewiesen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundvermögen
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.2 Vermögensarten
- 2.3 Bewertungsgegenstand
- 2.4 Abgrenzung von betrieblichem und außerbetrieblichem Vermögen
- 2.4.1 Relevanz der Abgrenzung
- 2.4.2 Betriebliche Einkünfte
- 2.4.3 Außerbetriebliche Einkünfte
- 3. Bewertung von Grundvermögen
- 3.1 Relevanz der Bewertung im außerbetrieblichen Bereich
- 3.1.1 Ansatz
- 3.1.2 Absetzung für Abnutzung
- 3.1.3 Steuerbemessungsgrundlage
- 3.2 Gesetzesgrundlagen zur Bewertung von Grundvermögen
- 3.2.1 Bewertungsgesetz
- 3.2.2 Einkommensteuergesetz
- 3.2.3 Liegenschaftsbewertungsgesetz und ÖNORM B 1802
- 3.3 Bewertungsansätze
- 3.3.1 Grundlegendes
- 3.3.2 Wertermittlung auf nationaler Ebene
- 3.3.3 Wertermittlung im internationalen Vergleich
- 4. Steuerliche Bewertungsmaßstäbe
- 4.1 Unterscheidung Bewertungsmaßstab – Bewertungsmethode
- 4.2 Anschaffungs- und Herstellungskosten
- 4.3 Gemeiner Wert
- 4.4 Teilwert
- 4.5 Grundstückswert
- 4.6 Fiktive Anschaffungskosten
- 4.7 Einheitswert
- 5. Vergleichswertverfahren
- 5.1 Grundlagen
- 5.2 Anforderungen an das Bewertungsverfahren
- 5.3 Nationales Vergleichswertverfahren
- 5.4 Internationaler Vergleich
- 5.4.1 Deutschland
- 5.4.2 Großbritannien
- 5.4.3 Frankreich
- 5.4.4 USA
- 6. Ertragswertverfahren
- 6.1 Grundlagen
- 6.2 Anforderungen an das Bewertungsverfahren
- 6.3 Nationales Ertragswertverfahren
- 6.4 Internationaler Vergleich
- 6.4.1 Deutschland
- 6.4.2 Großbritannien
- 6.4.3 Frankreich
- 6.4.4 USA
- 7. Sachwertverfahren
- 7.1 Grundlagen
- 7.2 Anforderungen an das Bewertungsverfahren
- 8. Kombination der Bewertungsverfahren
- 9. Beurteilung der Bewertungsverfahren im Vergleich
- 9.1 Nationale Ebene
- 9.2 Internationale Ebene
- 10. Einheitswertermittlung
- 10.1 Historische Entwicklung
- 10.2 Grundsteuer
- 10.2.1 Nationale Ebene
- 10.2.2 Internationaler Vergleich
- 10.3 Erbschafts- und Schenkungssteuer
- 10.3.1 Nationale Ebene
- 10.3.2 Internationaler Vergleich
- 10.4 Vermögensteuer
- 10.4.1 Nationale Ebene
- 10.4.2 Internationaler Vergleich
- 10.5 Grunderwerbsteuer
- 10.5.1 Nationale Ebene
- 10.5.2 Internationaler Vergleich
- 11. Ermittlung des Wertanteiles von Grund und Boden und Gebäude
- 11.1 Erfordernis einer Aufteilung von Grund und Boden und Gebäude
- 11.2 Methoden
- 11.3 Verhältnismethode
- 11.3.1 Alte Rechtslage
- 11.3.2 Neue Rechtslage
- 11.4 Differenzmethode
- 11.5 Verwaltungspraxis
- 12. Gutachten
- 12.1 Anwendung
- 12.2 Beweismittel, Beweiswürdigung und Beweislast
- 12.3 Anforderungen an ein Gutachten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Bewertung von Grundvermögen für steuerliche Zwecke. Ziel ist es, die Anforderungen an das Bewertungsverfahren zu analysieren, einen historischen Abriss zu geben und einen internationalen Vergleich durchzuführen. Die Arbeit beleuchtet dabei verschiedene Bewertungsmethoden und deren Anwendung in unterschiedlichen Ländern.
- Anforderungen an steuerliche Grundstücksbewertungsverfahren
- Historische Entwicklung der Grundstücksbewertung
- Internationaler Vergleich verschiedener Bewertungsmethoden
- Analyse verschiedener Bewertungsmaßstäbe (Gemeiner Wert, Teilwert etc.)
- Relevanz der Bewertung für verschiedene Steuerarten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der steuerlichen Grundstücksbewertung ein und skizziert die Problemstellung der Arbeit. Es beschreibt den Aufbau und die Struktur der folgenden Kapitel und definiert den Rahmen der Untersuchung.
2. Grundvermögen: Dieses Kapitel klärt den Begriff "Grundvermögen" und definiert die verschiedenen Vermögensarten, die darunter fallen. Es beschreibt den Bewertungsgegenstand und grenzt betriebliches von außerbetrieblichem Vermögen ab, wobei die Relevanz dieser Unterscheidung für die Steuerberechnung hervorgehoben wird. Die unterschiedlichen Einkunftsarten und ihre Beziehung zum Grundvermögen werden erläutert.
3. Bewertung von Grundvermögen: Dieses Kapitel behandelt die Relevanz der Grundstücksbewertung im außerbetrieblichen Bereich, insbesondere im Hinblick auf Ansatz, Absetzung für Abnutzung und Steuerbemessungsgrundlage. Es beleuchtet die relevanten Gesetzesgrundlagen (Bewertungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Liegenschaftsbewertungsgesetz und ÖNORM B 1802) und verschiedene Bewertungsansätze, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.
4. Steuerliche Bewertungsmaßstäbe: Hier werden die verschiedenen steuerlichen Bewertungsmaßstäbe wie Anschaffungs- und Herstellungskosten, Gemeiner Wert, Teilwert, Grundstückswert, fiktive Anschaffungskosten und Einheitswert detailliert beschrieben und voneinander abgegrenzt. Das Kapitel betont die Unterscheidung zwischen Bewertungsmaßstab und Bewertungsmethode.
5. Vergleichswertverfahren: Dieses Kapitel analysiert das Vergleichswertverfahren, seine Grundlagen und Anforderungen. Es beschreibt das nationale Verfahren und vergleicht es mit internationalen Ansätzen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA. Der Fokus liegt auf den spezifischen Kriterien und Methoden, die in den jeweiligen Ländern angewendet werden.
6. Ertragswertverfahren: Ähnlich wie Kapitel 5, analysiert dieses Kapitel das Ertragswertverfahren, seine Grundlagen und Anforderungen. Es vergleicht das nationale Verfahren mit internationalen Ansätzen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA, wobei die Unterschiede in der Anwendung und den zugrundeliegenden Prinzipien herausgearbeitet werden.
7. Sachwertverfahren: Dieses Kapitel behandelt das Sachwertverfahren, seine Grundlagen und Anforderungen an das Bewertungsverfahren. Es stellt die Methodik dar und erläutert die Anwendung im Kontext der steuerlichen Bewertung von Grundvermögen.
8. Kombination der Bewertungsverfahren: Das Kapitel beleuchtet die Möglichkeiten und die Notwendigkeit der Kombination verschiedener Bewertungsverfahren zur Ermittlung eines möglichst realistischen Grundstückswertes.
9. Beurteilung der Bewertungsverfahren im Vergleich: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Beurteilung der verschiedenen Bewertungsverfahren, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Es analysiert Stärken und Schwächen der jeweiligen Verfahren und zieht Schlussfolgerungen für die Praxis.
10. Einheitswertermittlung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einheitswertermittlung, ihrer historischen Entwicklung und ihrer Bedeutung für die Grundsteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie die Vermögensteuer. Es vergleicht die nationalen Regelungen mit internationalen Ansätzen.
11. Ermittlung des Wertanteiles von Grund und Boden und Gebäude: Dieses Kapitel behandelt die Methoden zur Ermittlung des Wertanteils von Grund und Boden und Gebäude, einschließlich der Verhältnis- und Differenzmethode. Es wird die Notwendigkeit einer solchen Aufteilung erläutert und die historische Entwicklung der Rechtslage beleuchtet.
12. Gutachten: Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung von Gutachten im Rahmen der Grundstücksbewertung, die Anforderungen an ein solches Gutachten, sowie Aspekte der Beweismittel, Beweiswürdigung und Beweislast.
Schlüsselwörter
Grundvermögen, Steuerliche Bewertung, Bewertungsverfahren, Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, Gemeiner Wert, Teilwert, Einheitswert, Internationaler Vergleich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA, Grundsteuer, Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Vermögensteuer, Grunderwerbsteuer, Bewertungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Liegenschaftsbewertungsgesetz.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Steuerliche Bewertung von Grundvermögen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Bewertung von Grundvermögen für steuerliche Zwecke. Sie analysiert die Anforderungen an Bewertungsverfahren, gibt einen historischen Abriss und führt einen internationalen Vergleich durch. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Bewertungsmethoden und deren Anwendung in unterschiedlichen Ländern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Anforderungen an steuerliche Grundstücksbewertungsverfahren, historische Entwicklung der Grundstücksbewertung, internationaler Vergleich verschiedener Bewertungsmethoden, Analyse verschiedener Bewertungsmaßstäbe (Gemeiner Wert, Teilwert etc.), Relevanz der Bewertung für verschiedene Steuerarten (Grundsteuer, Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Vermögensteuer, Grunderwerbsteuer), Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, Kombination von Bewertungsverfahren, Einheitswertermittlung, Ermittlung des Wertanteils von Grund und Boden und Gebäude sowie die Erstellung von Gutachten.
Welche Bewertungsverfahren werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Es wird jeweils auf die Grundlagen, Anforderungen und den internationalen Vergleich (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA) eingegangen. Die Kombination verschiedener Verfahren wird ebenfalls behandelt.
Welche Bewertungsmaßstäbe werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene steuerliche Bewertungsmaßstäbe wie Anschaffungs- und Herstellungskosten, Gemeiner Wert, Teilwert, Grundstückswert, fiktive Anschaffungskosten und Einheitswert. Die Unterscheidung zwischen Bewertungsmaßstab und -methode wird hervorgehoben.
Welche Steuerarten sind relevant für die Grundstücksbewertung?
Die Relevanz der Grundstücksbewertung für die Grundsteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Vermögensteuer und Grunderwerbsteuer wird ausführlich dargestellt. Ein internationaler Vergleich der Regelungen in verschiedenen Ländern ist Bestandteil der Arbeit.
Wie wird der Wertanteil von Grund und Boden und Gebäude ermittelt?
Die Arbeit beschreibt Methoden zur Ermittlung des Wertanteils von Grund und Boden und Gebäude, einschließlich der Verhältnis- und Differenzmethode. Die historische Entwicklung der Rechtslage wird beleuchtet.
Welche Rolle spielen Gutachten in der Grundstücksbewertung?
Die Arbeit beschreibt die Anwendung von Gutachten im Rahmen der Grundstücksbewertung, die Anforderungen an ein solches Gutachten, sowie Aspekte der Beweismittel, Beweiswürdigung und Beweislast.
Welche Gesetzesgrundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet relevante Gesetzesgrundlagen wie das Bewertungsgesetz, das Einkommensteuergesetz, das Liegenschaftsbewertungsgesetz und die ÖNORM B 1802.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einer Definition von Grundvermögen. Es folgen Kapitel zu den Bewertungsverfahren, den Bewertungsmaßstäben, der Einheitswertermittlung, der Wertanteilsbestimmung von Grund und Boden und Gebäude sowie ein Kapitel zu Gutachten. Ein umfassendes Inhaltsverzeichnis befindet sich im Dokument.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel ist im Dokument enthalten und gibt einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundvermögen, Steuerliche Bewertung, Bewertungsverfahren, Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, Gemeiner Wert, Teilwert, Einheitswert, Internationaler Vergleich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA, Grundsteuer, Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Vermögensteuer, Grunderwerbsteuer, Bewertungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Liegenschaftsbewertungsgesetz.
- Citation du texte
- Eva-Maria Bauer (Auteur), 2016, Die Bewertung von Grundvermögen für steuerliche Zwecke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345158