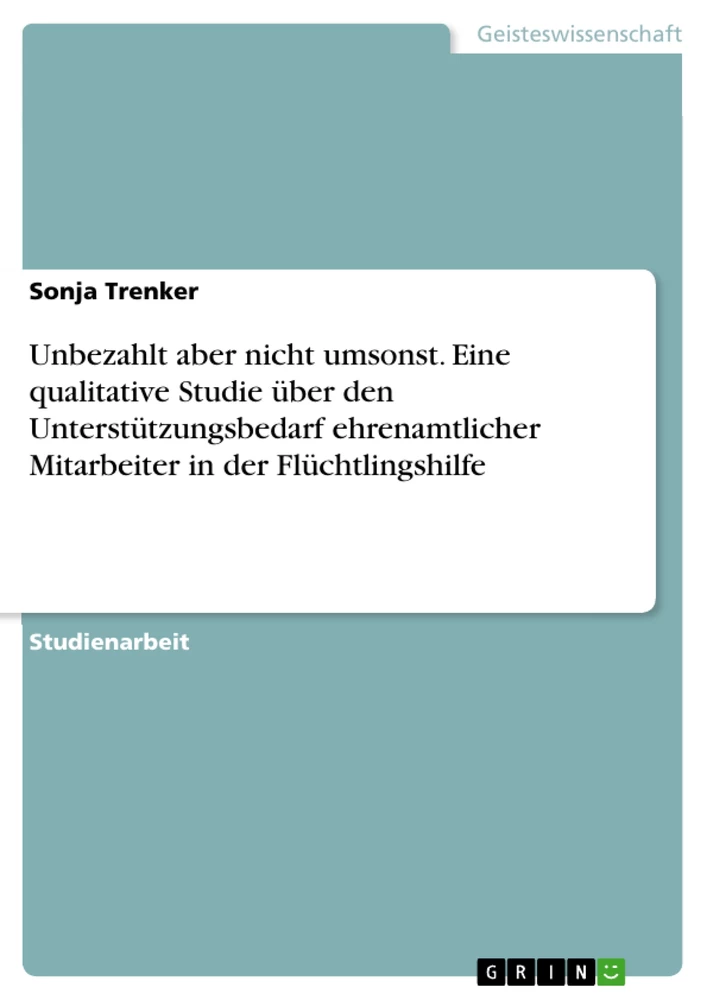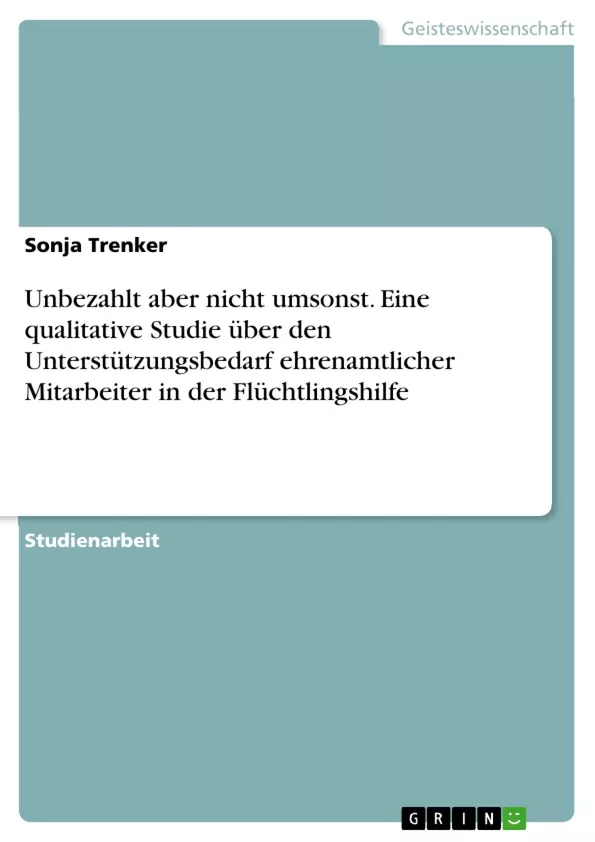Die Flüchtlingshilfe ist eine sehr komplexe Thematik, die in sich selbst bereits viele Schwierigkeiten birgt und auch bei vielen Mitmenschen auf Unverständnis stößt. Daher stellt sich in dieser Arbeit die Frage: Welchen Unterstützungsbedarf haben Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlings-und / oder Integrationsarbeit engagieren?
Im Folgenden gilt es nun unter Punkt 2. den theoretischen Hintergrund zu der Thematik genauer zu beleuchten. Dabei werden zunächst die relevanten Begriffe geklärt, um anschließend eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Motiven, sowie den Herausforderungen des Ehrenamts auseinanderzusetzen. Im Weiteren soll unter Punkt 3 das methodische Vorgehen der Planungs- und Durchführungsphase betrachtet werden. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden im Punkt 4. zusammengefasst und kritisch reflektiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2. 1 Klärung der grundlegenden Begriffe
- 2. 1. 1 Ehrenamt
- 2. 1. 2 Flucht
- 2. 2 Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Ehrenamt
- 2. 2. 1 Voraussetzungen und Motive
- 2. 2. 2 Bleibemotive
- 2. 2. 3 Herausforderungen für Ehrenamtliche
- 3. Planungs- und Durchführungsphase
- 3. 1 Wahl der Erhebungsmethode – Das Leitfadeninterview
- 3. 2 Zielgruppenauswahl
- 3. 3 Leitfadenerstellung
- 4. Auswertung der Interviews
- 4. 1 Kategorienbildung
- 4. 2 Reflexion der Interviews
- 4. 3 Qualitative Inhaltsanalyse und Interpretation
- 5. Quantitative Weiterentwicklung der Forschung
- 6. Reflexion und Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Anhang
- 8. 1 Interviewleitfaden
- 8. 2 Kategoriensystem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Unterstützungsbedarf ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe. Sie zielt darauf ab, die Motivationsfaktoren, Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe dieser engagierten Personen zu untersuchen und zu analysieren.
- Die Definition und Abgrenzung des Begriffs „Ehrenamt“ im Kontext der Flüchtlingshilfe
- Die Analyse der Motive und Herausforderungen, die Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe erleben
- Die Identifizierung von Unterstützungsbedürfnissen ehrenamtlicher Mitarbeiter
- Die Anwendung qualitativer Forschungsmethoden, insbesondere des Leitfadeninterviews, zur Datenerhebung und -auswertung
- Die Reflexion der Ergebnisse und die Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der Flüchtlingshilfe in Deutschland und stellt die Forschungsfrage nach dem Unterstützungsbedarf von Ehrenamtlichen in diesem Bereich.
Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Arbeit. Es werden die Begriffe „Ehrenamt“ und „Flucht“ definiert und es wird eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen, Motiven und Herausforderungen des Ehrenamts in der Flüchtlingshilfe vorgenommen.
Kapitel 3 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, welche auf dem Leitfadeninterview als Erhebungsmethode basiert. Hier wird auch die Auswahl der Zielgruppe und die Erstellung des Interviewleitfadens erläutert.
Kapitel 4 befasst sich mit der Auswertung der Interviews. Es werden die Kategorienbildung, die Reflexion der Interviews sowie die qualitative Inhaltsanalyse und Interpretation dargestellt.
Kapitel 5 geht auf die Möglichkeiten der quantitativen Weiterentwicklung der Forschung ein. Dieses Kapitel beleuchtet, wie die Erkenntnisse der qualitativen Forschung in quantitative Studien integriert werden könnten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Ehrenamt, Flüchtlingshilfe, Integration, qualitative Forschung, Leitfadeninterview, Unterstützungsbedarf, Motivation, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Unterstützungsbedarf haben Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe?
Die Studie untersucht spezifische Bedürfnisse wie psychologische Begleitung, fachliche Schulungen und organisatorische Entlastung für Freiwillige.
Was sind typische Motive für ein Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe?
Motive reichen von altruistischen Werten und politischem Engagement bis hin zum Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung und sozialem Anschluss.
Welche Herausforderungen erleben Ehrenamtliche?
Herausforderungen umfassen bürokratische Hürden, emotionale Belastung durch Schicksale der Geflüchteten und teilweise fehlendes Verständnis im sozialen Umfeld.
Welche Forschungsmethode wurde in dieser Arbeit verwendet?
Es wurde eine qualitative Methode angewandt, konkret das Leitfadeninterview, um tiefe Einblicke in die individuellen Erfahrungen der Helfer zu gewinnen.
Wie wird das Ehrenamt in dieser Studie definiert?
Das Ehrenamt wird als unbezahlte, freiwillige Tätigkeit definiert, die im organisierten Rahmen zur Unterstützung von Geflüchteten und deren Integration geleistet wird.
- Quote paper
- Sonja Trenker (Author), 2016, Unbezahlt aber nicht umsonst. Eine qualitative Studie über den Unterstützungsbedarf ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368528