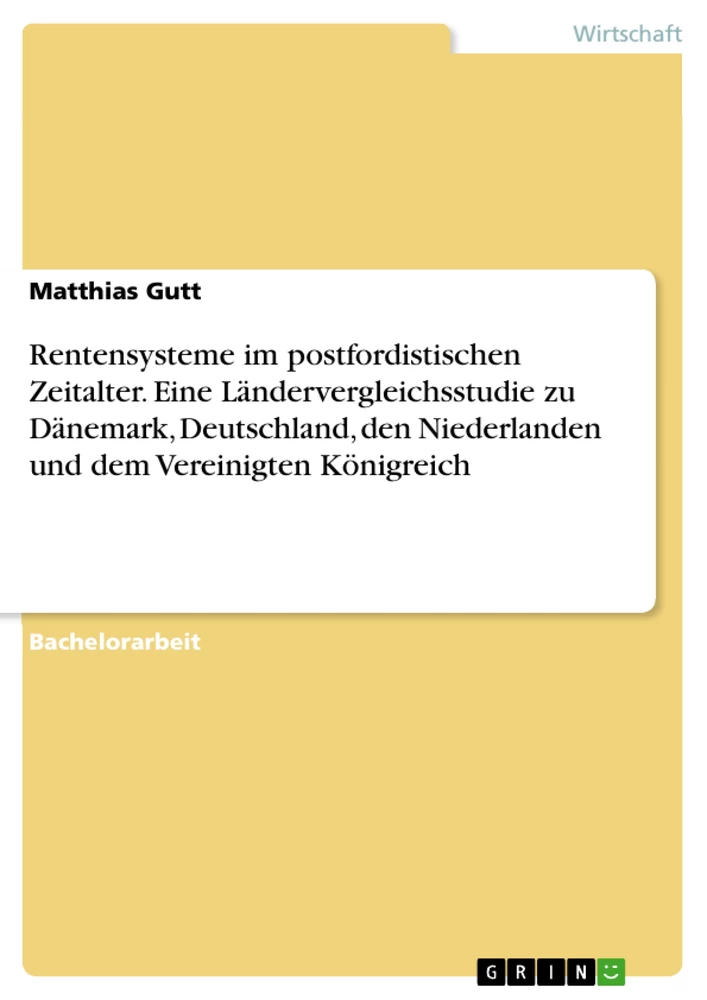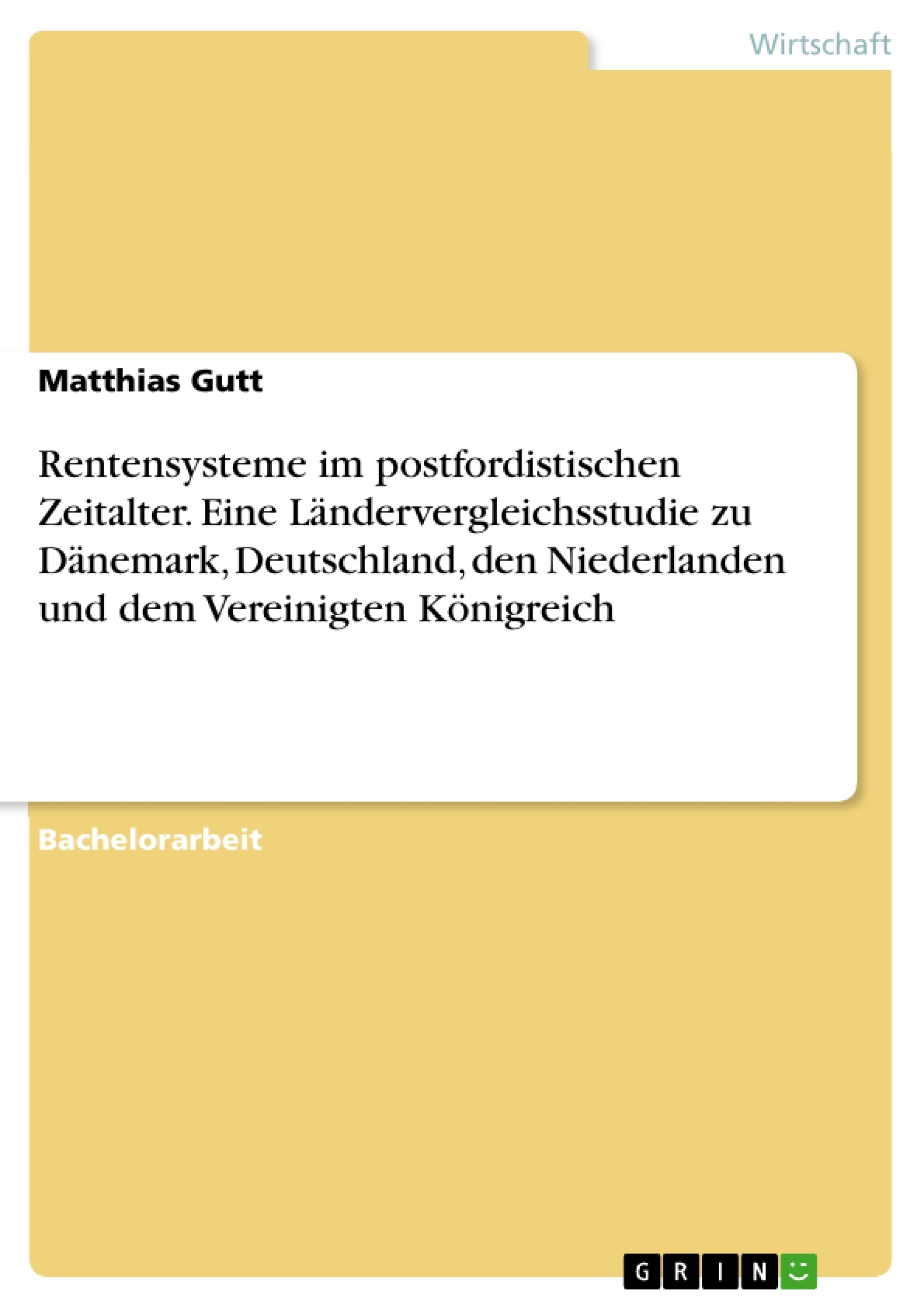Mit dem Anbruch der postfordistischen Ära erlebt die Arbeitswelt einen in ihrer Geschichte beispiellosen und auch im 21. Jahrhundert weiter fortschreitenden Umgestaltungsprozess. Dem Postfordismus vorausgegangen ist der Fordismus, unter dem das Industrie-Zeitalter der Massenproduktion, gekennzeichnet durch Fließbandarbeit, Fabriken, Massenkonsum, Vollzeiterwerbstätigkeit mit einem hohen Anteil sozialversicherungspflichtiger Normalarbeitsverhältnisse, verstanden wird. Den Postfordismus hingegen charakterisieren eine Abnahme von Industriearbeitsplätzen, Normalarbeitsverhältnissen und Vollzeiterwerbstätigkeit sowie eine Zunahme nichtindustrieller Arbeitsplätze und atypischer Beschäftigungsformen.
Bereits seit den 70er Jahren ist ein „grundlegender struktureller Wandel der Arbeitsmärkte“ zu verzeichnen. Hierzu zählt auch die zunehmende Verdrängung von Normalarbeitsverhältnissen durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern sich unter den gegebenen Bedingungen unterschiedliche Sozialstaatsmodelle auf die Alterssicherungsfunktion im Falle prekärer Erwerbsbiografien auswirken? Hierzu ist auch von Interesse, welche Rolle die gesellschaftlichen Institutionen dabei spielen. Einen interessanten Ansatz liefert der historische Neo- Institutionalismus. Dieser postuliert, dass es ein Bestreben gibt, einmal eingeschlagenen Pfaden, in den jeweiligen Politikfeldern beharrlich zu folgen.
Diese Arbeit soll erforschen, ob auch für dieses spezielle Politikfeld im Bereich der Alterssicherung angenommen werden kann, dass es eine Tendenz zur sogen. Pfadabhängigkeit gibt. Konkret soll dies am Beispiel der Alterssicherungssysteme überprüft werden. Die Charakterisierung unterschiedlicher Alterssicherungssysteme soll auf Grundlage der Klassifizierung der basierenden Sozialstaatsmodelle bzw. Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen erfolgen. Zu diesem Zweck wird folgende Fragestellung/Hypothese untersucht: „Ermöglichen Wohlfahrtssysteme sozialdemokratisch-skandinavischer Prägung eine effektivere Absicherung bei prekären Erwerbsbiografien im Alter als Wohlfahrtssysteme konservativ-kontinentaleuropäischer oder liberalangelsächsischer Art?“ Die Untersuchung findet im Rahmen eines MSSD statt. Es wird der Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Wohlfahrtssystem und der Alterssicherung einer bestimmten Personengruppe untersucht sowie die diesen Zusammenhang vermittelnden Mechanismen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Vorgehensweise
- Theoretische Grundlagen, Konzepte und Zentrale Begriffe
- Historischer Neo-Institutionalismus
- Pfadabhängigkeitstheorie
- Wohlfahrtssysteme nach Esping-Andersen
- Systemspezifische Merkmale
- Dekommodifizierung
- Stratifizierung
- Universalismus
- Wohlfahrtssystemtypen
- Liberal-angelsächsisches System
- Konservativ-kontinentaleuropäisches System
- Sozialdemokratisch-skandinavisches System
- Prekäre Beschäftigung und prekäre Erwerbsbiografien
- Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung
- 1. Säule
- 2. Säule
- 3. Säule
- Systemspezifische Merkmale
- Historischer Neo-Institutionalismus
- Bestimmung der Variablen
- Operationalisierung der unabhängigen Variable „Wohlfahrtssystem“
- Operationalisierung der abhängigen Variable „Alterssicherungsfunktion bei prekären Erwerbsbiografien“
- Zuordnung der Wohlfahrtssysteme
- Fallauswahl
- Vergleichende Auswertung
- Dänemark
- Deutschland
- Niederlande
- Vereinigtes Königreich
- Untersuchung der Alterssicherungsfunktion
- Dänemark
- Deutschland
- Niederlande
- Vereinigtes Königreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die Funktionsweise von Rentensystemen im postfordistischen Zeitalter. Sie untersucht, wie verschiedene Wohlfahrtssysteme die Altersabsicherung von Personen mit prekären Erwerbsbiografien beeinflussen.
- Die Rolle des historischen Neo-Institutionalismus und der Pfadabhängigkeitstheorie bei der Analyse von Rentensystemen
- Die Klassifizierung von Wohlfahrtssystemen nach Esping-Andersen und deren Relevanz für die Altersvorsorge
- Der Einfluss prekären Beschäftigungsverhältnissen auf die Altersabsicherung
- Die vergleichende Analyse von Alterssicherungssystemen in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich
- Die Bewertung der Effektivität der Alterssicherungsfunktion bei prekären Erwerbsbiografien in den untersuchten Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des postfordistischen Zeitalters und die damit verbundenen Veränderungen in der Arbeitswelt ein. Sie stellt die Fragestellung und die Vorgehensweise der Arbeit dar.
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es erläutert den historischen Neo-Institutionalismus, die Pfadabhängigkeitstheorie und die Typologie von Wohlfahrtssystemen nach Esping-Andersen. Darüber hinaus werden wichtige Konzepte wie prekäre Beschäftigung und das Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung definiert.
Kapitel 3 legt die Operationalisierung der unabhängigen und abhängigen Variablen im Rahmen des MSSD fest.
Kapitel 4 beschreibt die Fallauswahl und die Zuordnung der untersuchten Länder zu den jeweiligen Wohlfahrtssystemtypen.
Kapitel 5 stellt die Ergebnisse der vergleichenden Analyse der Alterssicherungsfunktion in den vier ausgewählten Ländern dar.
Schlüsselwörter
Postfordismus, Wohlfahrtssysteme, Rentensysteme, Pfadabhängigkeit, Esping-Andersen, prekäre Beschäftigung, Erwerbsbiografie, Alterssicherung, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Nettoersatzraten, MSSD
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert Rentensysteme im Postfordismus?
Der Postfordismus ist durch eine Abnahme von Normalarbeitsverhältnissen und eine Zunahme atypischer, oft prekärer Beschäftigungsformen geprägt, was die Alterssicherung vor neue Herausforderungen stellt.
Was besagt die Pfadabhängigkeitstheorie?
Diese Theorie aus dem historischen Neo-Institutionalismus postuliert, dass politische Systeme dazu neigen, einmal eingeschlagenen Wegen beharrlich zu folgen, was radikale Reformen erschwert.
Welche Wohlfahrtssysteme unterscheidet Esping-Andersen?
Er klassifiziert drei Typen: das liberal-angelsächsische (z.B. UK), das konservativ-kontinentaleuropäische (z.B. Deutschland) und das sozialdemokratisch-skandinavische System (z.B. Dänemark).
Welches System sichert prekäre Erwerbsbiografien am besten ab?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass dänische (skandinavische) Systeme aufgrund ihres Universalismus eine effektivere Absicherung im Alter bieten als konservative oder liberale Modelle.
Was ist das Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung?
Es besteht aus der gesetzlichen Rentenversicherung (1. Säule), der betrieblichen Altersvorsorge (2. Säule) und der privaten Vorsorge (3. Säule).
Welche Länder werden in der Studie verglichen?
Die Ländervergleichsstudie analysiert die Rentensysteme von Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.
- Citar trabajo
- Matthias Gutt (Autor), 2017, Rentensysteme im postfordistischen Zeitalter. Eine Ländervergleichsstudie zu Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380747