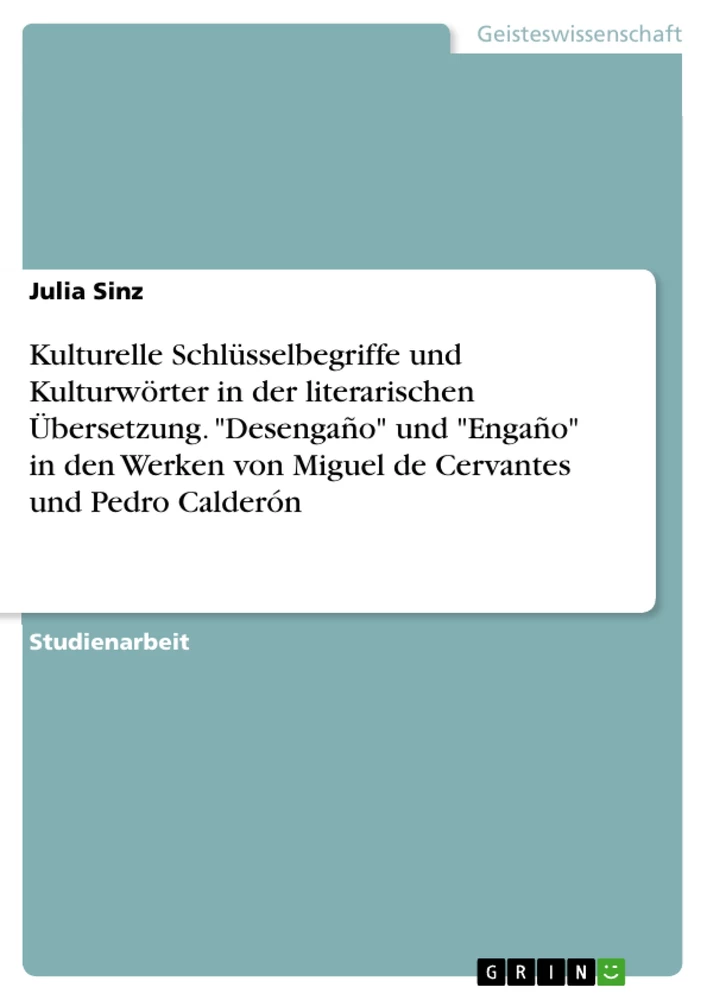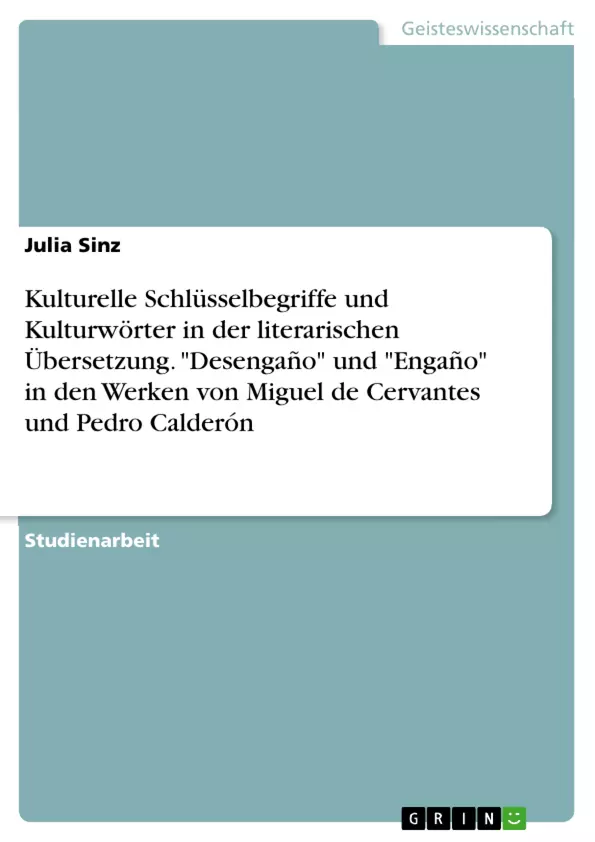Die Angewandte Linguistik behandelt die für alle Sprachen und Kulturen geltenden Eigenschaften zwischenmenschlicher Kommunikation unter Einbezug der verschiedenen Formen des Übersetzens und Dolmetschens. Untersuchungen zur Kulturspezifik in der Translation nehmen in der Angewandten Sprachwissenschaft einen besonderen Stellenwert ein, sind jedoch Teil eines noch ungenügend bearbeiteten Untersuchungsbereichs. Nur eine geringe Auswahl an Literatur und Untersuchungen befassen sich mit Kulturwörtern und kulturellen Schlüsselbegriffen in literarischen Übersetzungen und genauso verhält es sich auch mit der Desengaño-Thematik.
Diese wird zwar in literaturwissenschaftlichen Werken zum Siglo de Oro des Öfteren erwähnt, jedoch wird es lediglich bei Schulte genauer behandelt. Zur Kombination beider Themengebiete sind bisher keine spezifischen Betrachtungen vorhanden. Aus diesem Grund soll im Rahmen dieser Arbeit eine Analyse unterschiedlicher Übersetzungsmethoden für kulturelle Schlüsselbegriffe und Kulturwörter in literarischen Übersetzungen angefertigt werden. Zu diesem Zweck werden verschiedene deutsche Übersetzungen von ausgewählten Werken von Cervantes und Calderón aus der Zeit des Siglo de Oro beispielhaft auf die jeweiligen Verfahren zur Wiedergabe von desengaño und engaño untersucht.
Zunächst werden im ersten Teil dieser Arbeit die theoretischen Grundlagen zur Betrachtung kultureller Schlüsselbegriffe und Kulturwörter in literarischen Übersetzungen dargelegt und behandelt. Im zweiten Teil der Arbeit folgt daraufhin zuerst ein kurzer Überblick über Bedeutung und Definition der Desengaño-Thematik in der Literatur des Siglo de Oro. Anschließend werden verschiedene deutsche Übersetzungen von Werken von Pedro Calderón de la Barca und Miguel de Cervantes Saavedra auf ihren Umgang mit desengaño und engaño hin untersucht und verglichen. Abschließend werden die bei der Analyse und Gegenüberstellung der gewählten Übersetzungen erarbeiteten Resultate kritisch bewertet und auf Schwierigkeiten untersucht. Zu Beginn wird jedoch mit einer Definition und Differenzierung von kulturellen Schlüsselbegriffen und Kulturwörtern in die theoretischen Grundlagen eingeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Formen, Funktionen und Texttypen
- Problematik für den Übersetzer
- Translatorische Verfahren
- Bewertung übersetzerischer Probleme anhand der Desengaño-Thematik in spanischen Werken aus der Zeit des Siglo de Oro
- Bedeutung von desengaño und engaño in Spanien
- Untersuchung deutscher Übersetzungen von desengaño und engaño in literarischen Werken
- Kritische Analyse der Untersuchungsergebnisse
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Übersetzung kultureller Schlüsselbegriffe und Kulturwörter in literarischen Übersetzungen, insbesondere mit dem Konzept des "desengaño" in spanischen Werken des Siglo de Oro. Ziel ist es, die Schwierigkeiten des Übersetzens dieser Konzepte zu beleuchten und verschiedene Übersetzungsmethoden zu analysieren.
- Definition und Differenzierung von kulturellen Schlüsselbegriffen und Kulturwörtern
- Analyse der Problematik bei der Übersetzung von kulturellen Schlüsselbegriffen und Kulturwörtern
- Untersuchung verschiedener Übersetzungsverfahren für "desengaño" und "engaño" in deutschen Übersetzungen spanischer Werke
- Kritik der Analyseergebnisse und Herausarbeitung von Schwierigkeiten in der Übersetzungspraxis
- Relevanz der Untersuchung für die Übersetzungswissenschaft und die Interkulturelle Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Übersetzung kultureller Schlüsselbegriffe und Kulturwörter in den Kontext der Angewandten Linguistik und Translation. Sie hebt die Relevanz des "desengaño" als Kulturbegriff im Siglo de Oro hervor und begründet die Notwendigkeit der Untersuchung.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert und differenziert zwischen kulturellen Schlüsselbegriffen und Kulturwörtern und beleuchtet deren Besonderheiten in literarischen Texten. Es geht auf verschiedene Formen, Funktionen und Texttypen ein, in denen diese Begriffe vorkommen.
- Bewertung übersetzerischer Probleme anhand der Desengaño-Thematik in spanischen Werken aus der Zeit des Siglo de Oro: Dieses Kapitel beleuchtet zunächst die Bedeutung des "desengaño" und "engaño" in der spanischen Literatur des Siglo de Oro. Anschließend werden verschiedene deutsche Übersetzungen von Werken von Calderón de la Barca und Cervantes Saavedra auf ihren Umgang mit diesen Konzepten untersucht und verglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Aspekten der Übersetzungswissenschaft, insbesondere mit dem Konzept des "desengaño" als kulturellem Schlüsselbegriff im Siglo de Oro. Relevante Schlüsselwörter sind: Übersetzungswissenschaft, kulturelle Schlüsselbegriffe, Kulturwörter, Desengaño, Engaño, Siglo de Oro, spanische Literatur, deutsche Übersetzungen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeuten die Begriffe "desengaño" und "engaño" im Siglo de Oro?
Diese Begriffe sind zentrale kulturelle Schlüsselbegriffe der spanischen Barockliteratur. "Engaño" steht für Täuschung oder Illusion, während "desengaño" die schmerzhafte Enttäuschung oder das Erwachen zur Wahrheit beschreibt.
Warum ist die Übersetzung dieser Begriffe so schwierig?
Da es sich um Kulturwörter handelt, sind sie tief in der spanischen Mentalität des 17. Jahrhunderts verwurzelt. Eine einfache Eins-zu-eins-Übersetzung ins Deutsche kann die komplexen religiösen und philosophischen Konnotationen oft nicht vollständig erfassen.
Welche Autoren werden in der Analyse untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Werke der bedeutenden spanischen Autoren Miguel de Cervantes und Pedro Calderón de la Barca.
Welche Rolle spielt die Angewandte Linguistik in dieser Arbeit?
Die Angewandte Linguistik liefert die theoretischen Grundlagen zur Untersuchung der Kulturspezifik in der Translation und hilft dabei, verschiedene translatorische Verfahren zu bewerten.
Was ist das Ziel des Vergleichs verschiedener deutscher Übersetzungen?
Ziel ist es, kritisch zu bewerten, wie unterschiedliche Übersetzer mit der Desengaño-Thematik umgegangen sind und welche Strategien zur Wiedergabe kultureller Konzepte am effektivsten sind.
- Citar trabajo
- Julia Sinz (Autor), 2014, Kulturelle Schlüsselbegriffe und Kulturwörter in der literarischen Übersetzung. "Desengaño" und "Engaño" in den Werken von Miguel de Cervantes und Pedro Calderón, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381338