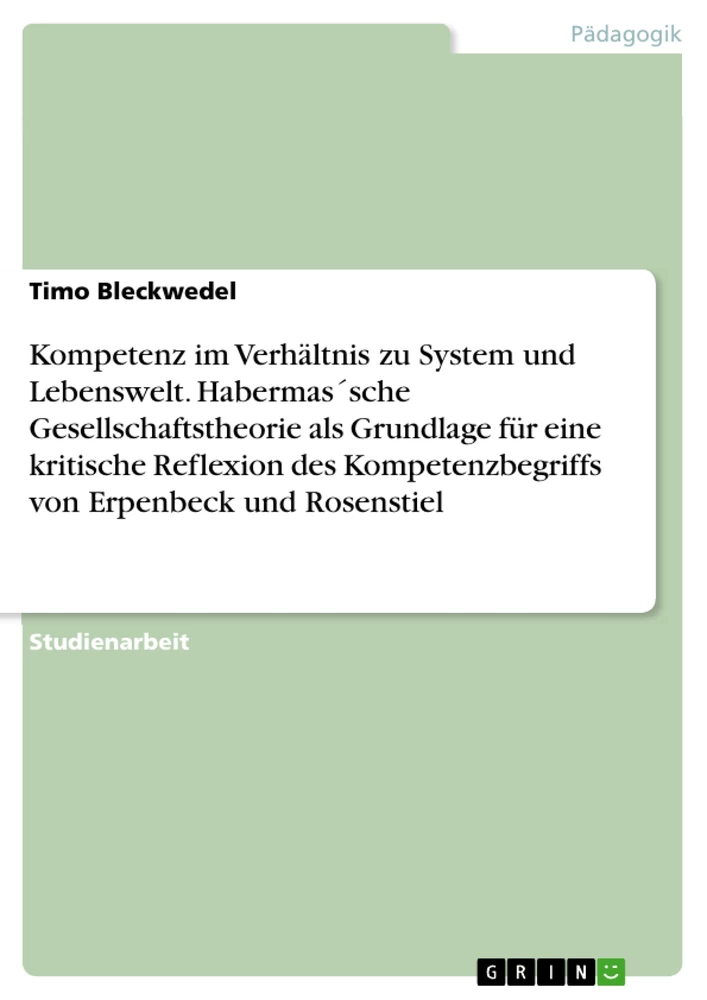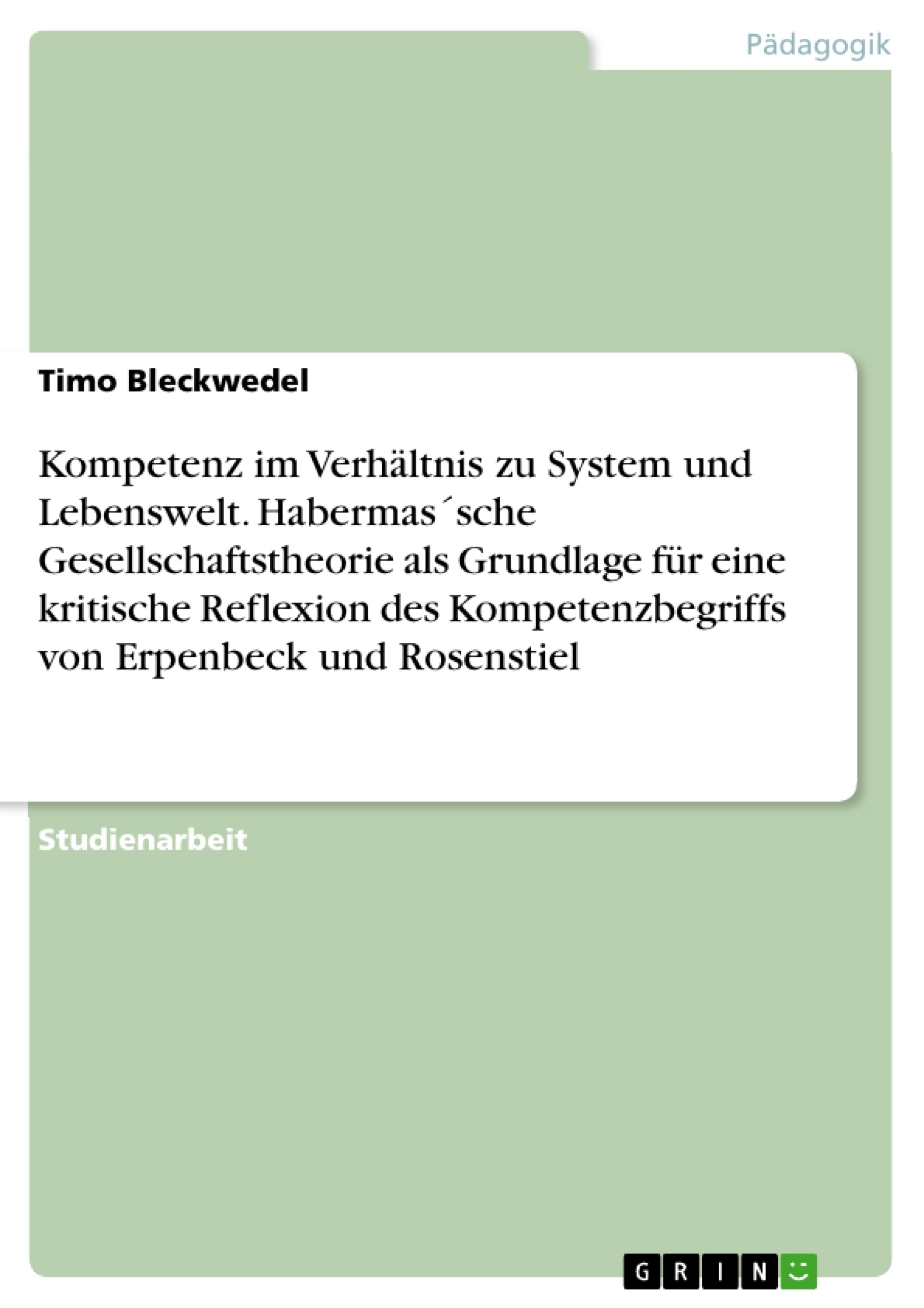Diese Ausarbeitung versucht eine kritische Analyse des in den letzten Jahren eine zunehmende Verbreitung und Beliebtheit erfahrenden Kompetenzbegriffes. Hierzu wird Kompetenz und Kompetenzmessung in einem ersten Abschnitt erläutert. Der Kompetenz-Abschnitt schließt mit einer kritischen Zusammenfassung, die auf theorieimmanente Leerstellen hinweist. Es wird aufgezeigt, dass der zuvor explizierte Kompetenzbegriff einseitig auf die produktive Verarbeitung von Veränderung und Komplexitätszunahme abzielt. Moralische Fragen nach den Ursachen von gesellschaftlichen Veränderungen und den langfristigen Folgen der vom Kompetenzbegriff explizit erfassten, spontanen und kreativen Lösungshandlungen werden nicht gestellt.
Diese Leerstelle soll mit der Habermas´schen Gesellschaftstheorie gefüllt werden. Diese wird im folgenden Abschnitt skizziert. Insbesondere die im letzten Unterpunkt beschriebene Kolonialisierung der Lebenswelt liefert einen theoretischen Anknüpfungspunkt an den Kompetenzbegriff.
Im letzten Abschnitt wird versucht, die Gefahren eines rein zweckrational, ohne moralische Reflexionsebene, ausgerichteten Kompetenzbegriffes mithilfe des Habermas´schen Kolonialisierungstheorems zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kompetenz
- 2.1 Der Begriff: Kompetenz
- 2.2 Definition von Kompetenz
- 2.3 Kompetenzmessung
- 2.4 Einflussorte von Kompetenz (Schule, Beruf)
- 2.5 Kritische Zusammenfassung
- 3. Habermas Gesellschaftstheorie
- 3.1 Die Theorie des Kommunikativen Handelns
- 3.2 Diskurstheorie
- 3.3 System Lebenswelt
- 3.4 Kolonialisierung der Lebenswelt
- 4. Zusammenfassende Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer kritischen Reflexion des Kompetenzbegriffs von Erpenbeck und von Rosenstiel vor dem Hintergrund der Habermas'schen Gesellschaftstheorie. Das Ziel der Arbeit ist es, die Einseitigkeit des Kompetenzbegriffs aufzuzeigen und dessen Grenzen im Hinblick auf moralische Fragen und die langfristigen Folgen von kreativen Problemlösungen zu analysieren.
- Der Kompetenzbegriff und dessen Bedeutung in Bildung und Beruf
- Die Habermas'sche Gesellschaftstheorie und ihre Relevanz für die Analyse von Kompetenz
- Die Kolonialisierung der Lebenswelt als theoretischer Anknüpfungspunkt für die Kritik am Kompetenzbegriff
- Die Gefahren eines rein zweckrationalen Kompetenzbegriffs ohne moralische Reflexionsebene
- Die Bedeutung von Selbstorganisation und Reflexion im Kompetenzbegriff
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Kompetenz
Dieses Kapitel erläutert den Kompetenzbegriff anhand des Standardwerks „Handbuch Kompetenzmessung“ von Erpenbeck und von Rosenstiel. Es werden die begriffliche Fassung von Kompetenz, die wissenschaftlichen Kriterien ihrer Definition, die Anwendung in Kompetenzmessverfahren und die Einflussorte von Kompetenz im Alltag und im Beruf beleuchtet. Die kritische Zusammenfassung dieses Kapitels weist auf die theorieimmanenten Leerstellen des Kompetenzbegriffs hin und verdeutlicht, dass der Begriff primär auf die produktive Verarbeitung von Veränderungen und Komplexität abzielt, ohne moralische Fragen oder langfristige Folgen zu berücksichtigen.
Kapitel 3: Habermas Gesellschaftstheorie
Das Kapitel skizziert die Habermas'sche Gesellschaftstheorie, insbesondere die Theorie des Kommunikativen Handelns, die Diskurstheorie und die Konzepte von System und Lebenswelt. Der Fokus liegt auf der Kolonialisierung der Lebenswelt, die einen theoretischen Anknüpfungspunkt für die Kritik am Kompetenzbegriff bietet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf zentrale Begriffe wie Kompetenz, Selbstorganisation, Lebenswelt, Kolonialisierung, Diskurstheorie, Bildung, Qualifikation, Moral, Reflexion, Zweckrationalität, Handlungsfähigkeit und Komplexität. Die zentralen Theorien, die in der Arbeit beleuchtet werden, sind die Habermas'sche Gesellschaftstheorie und das Kompetenzmodell von Erpenbeck und von Rosenstiel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Kritik am Kompetenzbegriff von Erpenbeck?
Die Kritik besagt, dass der Begriff einseitig auf die produktive Bewältigung von Komplexität abzielt und moralische Fragen nach Ursachen und langfristigen Folgen vernachlässigt.
Wie definiert Habermas die „Kolonialisierung der Lebenswelt“?
Es beschreibt das Eindringen von zweckrationalen Systemlogiken (wie Markt oder Bürokratie) in Bereiche des privaten und sozialen Lebens, die eigentlich auf kommunikativem Handeln basieren.
Welche Gefahr birgt ein rein zweckrationaler Kompetenzbegriff?
Ohne eine moralische Reflexionsebene führt Kompetenz nur zur effizienten Problemlösung innerhalb bestehender Systeme, ohne deren Sinnhaftigkeit oder ethische Vertretbarkeit zu hinterfragen.
Was ist der Unterschied zwischen Qualifikation und Kompetenz?
Während Qualifikation eher auf formale Abschlüsse und Wissen zielt, beschreibt Kompetenz die Fähigkeit zur Selbstorganisation und zum kreativen Handeln in unvorhersehbaren Situationen.
Warum wird Habermas zur Analyse herangezogen?
Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns bietet den notwendigen Rahmen, um die fehlende moralisch-reflexive Dimension im gängigen Kompetenzmodell aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Timo Bleckwedel (Autor:in), 2012, Kompetenz im Verhältnis zu System und Lebenswelt. Habermas´sche Gesellschaftstheorie als Grundlage für eine kritische Reflexion des Kompetenzbegriffs von Erpenbeck und Rosenstiel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385398