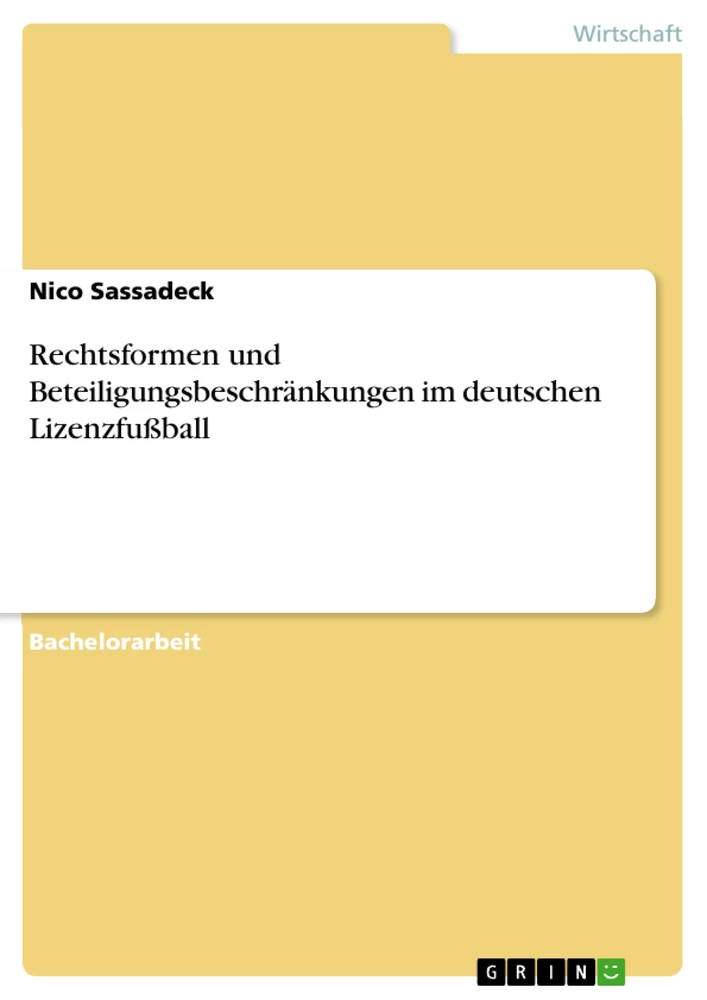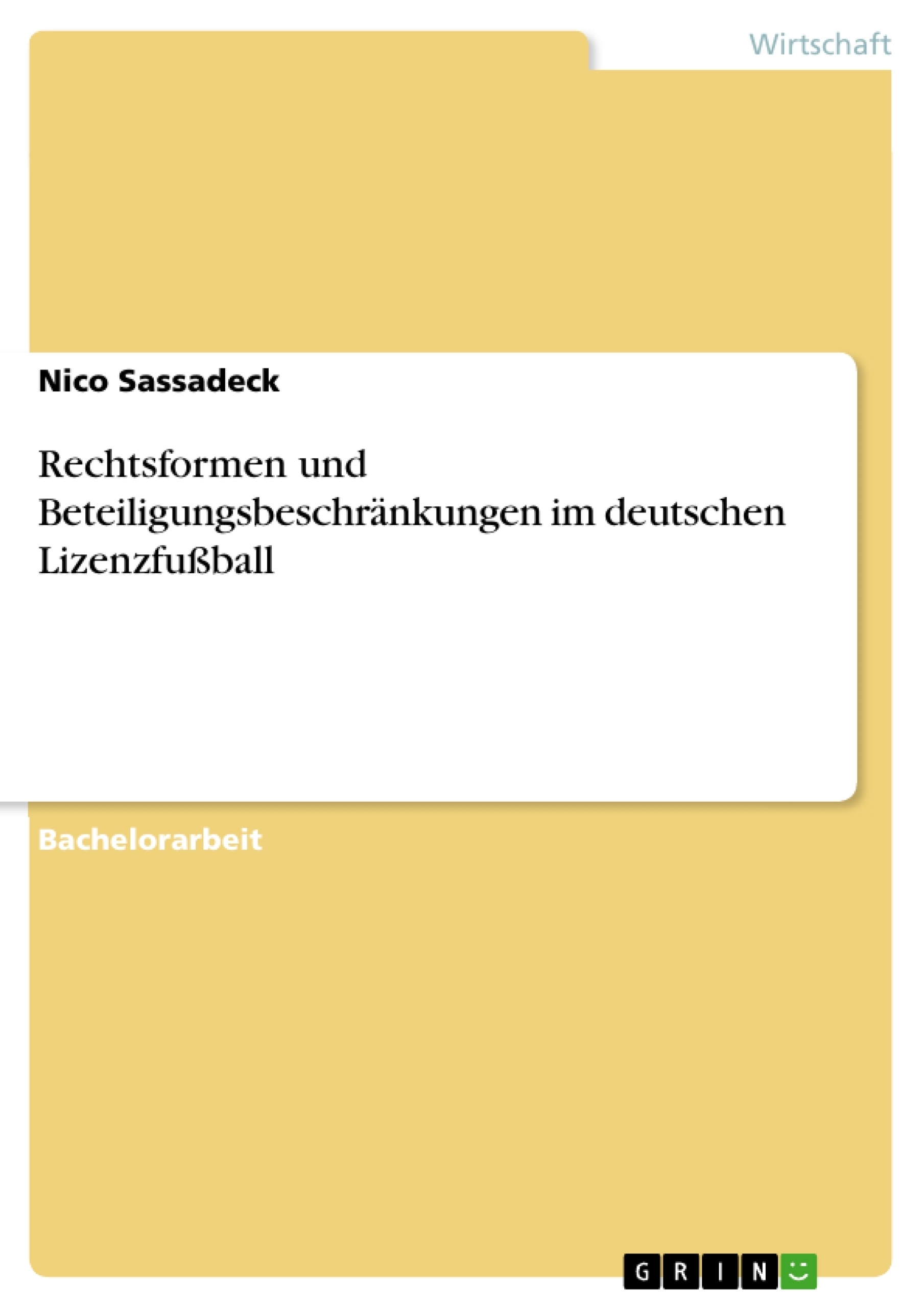Fußball, ein Spiel bei dem Begeisterung und Enttäuschung, Freude und Wut sowie Sieg oder Niederlage so nah beieinander liegen und oftmals nur Nuancen über den Verlauf einer Partie entscheiden können. Letztendlich ist der Fußball mit seinen Akteuren aber auch nur ein Sport! Oder stellt er doch mehr dar?
Der Fußball in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung erlebt. Spielten die begabtesten Spieler Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts noch nebenberuflich, schließlich erhielten sie keine Vergütung für das Fußballspielen, und aus reiner Freude am Sport vor einigen wenigen Zuschauern gegeneinander, so symbolisieren die heutigen Fußballprofis „Popstars“, die schon in jungen Jahren Millionen verdienen und ihre Wettkämpfe vor einem weltweiten Publikum, anwesend im Stadion selbst oder vor dem Fernseher, austragen.
Die Vereine haben sich zu mittelständischen Unternehmen entwickelt und verzeichnen Umsätze in Millionenhöhe. Steigenden Einnahmen stehen höhere Ausgaben gegenüber und die Anforderungen an die sogenannten Manager der Bundesligaklubs steigen auf Grund der immensen Geldsummen, die in der Branche fließen, dem immer weiter wachsenden Interesse der Öffentlichkeit, sowie der grundsätzlichen Bedeutung des Fußballs in der Gesellschaft, stetig an. Die sportliche Leitung der jeweiligen Klubs arbeitet unter höchst professionellen Strukturen. Nichts wird dem Zufall überlassen und Experten für sämtliche Bereiche, sei es für die Trainingslehre, die medizinische Abteilung, Ernährungsberatung oder psychologische Beratung, werden engagiert. Der Gewinn des Weltmeistertitels im Jahr 2014 ist in dieser Hinsicht auch ein Verdienst der vielen Bundesligaklubs, da diese durch ihre exzellente Arbeit zur Entwicklung der Spieler beigetragen haben und bestätigt die Klubs, ihren bisherigen Weg im sportlichen Bereich weiterzuführen.
Doch wie sind die Bundesligaklubs außerhalb des sportlichen Bereichs aufgestellt? Entsprechen sie den Anforderungen? Welche Möglichkeiten haben die Bundesligaklubs, um die vorhanden Strukturen an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen? Welche Vorgaben müssen von den Bundesligaklubs bei ihrer Rechtsformwahl beachtet werden und welche Gefahren drohen? Diese Fragen und weitere Sachverhalte rund um das Thema „Rechtsformen und Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Lizenzfußball“ sollen im Laufe dieser Bachelorarbeit beantwortet, beziehungsweise erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Organisationsstruktur des deutschen Fußballsports
- 2.1 Der DFB als Dachverband des deutschen Fußballs
- 2.2 Der Liga-Fußballverband und die Deutsche Fußball Liga
- 2.3 Profivereine im deutschen Lizenzfußball und das Lizenzierungsverfahren der DFL
- 3. Der Fußballbundesligaverein als Idealverein
- 3.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen der vereinsrechtlichen Organisation
- 3.2 Die Abgrenzung zum wirtschaftlichen Verein
- 3.3 Anwendung des Nebenzweckprivilegs
- 3.4 Rechtsformverfehlung und die Folge für die Vereine
- 3.5 Ergebnis
- 4. Ausgliederung der Lizenzfußballabteilung auf eine Kapitalgesellschaft
- 4.1 Motive für eine Ausgliederung
- 4.1.1 Wirtschaftliche Aspekte
- 4.1.2 Beseitigung der Rechtsformverfehlung
- 4.1.3 Problem der faktischen Satzungsänderung
- 4.1.4 Schutz des Muttervereins vor Insolvenz und Gläubigerschutz
- 4.1.5 Professionalisierung der Geschäftsführung
- 4.2 Wahl der Rechtsform
- 4.2.1 Begrenzung der Rechtsformwahl durch Vorgaben des DFB
- 4.2.2 Betrachtung der verwendeten Rechtsformen in den deutschen Bundesligen
- 4.3 Ausgliederung auf eine Aktiengesellschaft
- 4.3.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen der AG
- 4.3.2 Organisations- und Führungsstruktur einer AG
- 4.3.3 Kapitalbeschaffung gemäß den Anforderungen an eine Fußball AG
- 4.3.4 Nachteil der Satzungsstrenge einer AG
- 4.3.5 Praxisbeispiel Eintracht Frankfurt AG
- 4.4 Ausgliederung auf eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- 4.4.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen der GmbH
- 4.4.2 Organe der GmbH
- 4.4.3 Ausgestaltung der Geschäftsanteile und potenzielle Gesellschafter
- 4.4.4 Praxisbeispiel Bayer Leverkusen GmbH
- 4.5 Ausgliederung auf eine Kommanditgesellschaft auf Aktien
- 4.5.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen der KGaA
- 4.5.2 Organisationsstruktur der KGaA
- 4.5.3 Sonderform GmbH & Co. KGaA anhand des Beispiels von Borussia Dortmund
- 4.6 Zusammenfassung und Würdigung der einzelnen Rechtsformen
- 4.1 Motive für eine Ausgliederung
- 5. Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Profifußball
- 5.1 Motive für Beteiligungen und Gefahren für den Sport
- 5.2 Zwecke der Beteiligungsbeschränkungen
- 5.3 Das Verbot von Mehrheitsbeteiligungen
- 5.3.1 Der Begriff der Mehrheitsbeteiligung und der Fußballverein als Kapitalgesellschaft
- 5.3.2 Die „50 + 1“-Regel
- 5.3.3 Die „Lex Leverkusen“
- 5.3.4 Die „Lex Kind“
- 5.4 Mehrfachbeteiligungen
- 5.4.1 Das Fehlen eines Verbots von Mehrfachbeteiligungen im deutschen Lizenzfußball
- 5.4.2 Gefahren durch das Fehlen einer entsprechenden Beteiligungsbeschränkung
- 5.5 Sonstige Beteiligungsbeschränkungen
- 5.5.1 Das Verbot der Untereinander-Beteiligungen
- 5.5.2 Die mehrfache personelle Einflussnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rechtsformen und Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Lizenzfußball. Ziel ist es, die verschiedenen Rechtsformen von Fußballvereinen zu analysieren und deren Vor- und Nachteile im Kontext des deutschen Fußballsystems zu bewerten. Weiterhin werden die bestehenden Beteiligungsbeschränkungen beleuchtet und deren Auswirkungen auf den Sport diskutiert.
- Rechtsformen von Fußballvereinen (e.V., AG, GmbH, KGaA)
- Ausgliederung von Lizenzfußballabteilungen in Kapitalgesellschaften
- Beteiligungsbeschränkungen und deren Rechtfertigung
- Die „50+1“-Regel und Ausnahmen
- Risiken und Herausforderungen durch Mehrfachbeteiligungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rechtsformen und Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Lizenzfußball ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den professionellen Fußball und die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse der verschiedenen Rechtsformen und Beteiligungsmodelle.
2. Organisationsstruktur des deutschen Fußballsports: Dieses Kapitel beschreibt die Organisationsstruktur des deutschen Fußballs, beginnend mit dem DFB als Dachverband. Es beleuchtet die Rolle des Liga-Fußballverbandes und der DFL, sowie die Anforderungen an Profivereine und das Lizenzierungsverfahren. Der Fokus liegt auf der hierarchischen Struktur und den jeweiligen Kompetenzen der beteiligten Organisationen, um das rechtliche Umfeld für die weiteren Kapitel zu etablieren.
3. Der Fußballbundesligaverein als Idealverein: Das Kapitel analysiert den Fußballbundesligaverein unter gesellschaftsrechtlichen Aspekten. Es untersucht die vereinsrechtliche Organisation, grenzt den wirtschaftlichen Verein ab und beleuchtet die Anwendung des Nebenzweckprivilegs. Die Rechtsformverfehlung und deren Folgen werden ausführlich diskutiert, um das Spannungsfeld zwischen Vereinszweck und wirtschaftlicher Notwendigkeit herauszustellen. Das Kapitel mündet in eine Bewertung der aktuellen Situation.
4. Ausgliederung der Lizenzfußballabteilung auf eine Kapitalgesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit den Motiven für die Ausgliederung der Lizenzfußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA). Es analysiert wirtschaftliche Aspekte, die Beseitigung von Rechtsformverfehlungen, den Schutz des Muttervereins und die Professionalisierung der Geschäftsführung. Die verschiedenen Rechtsformen werden im Detail vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen (Eintracht Frankfurt AG, Bayer Leverkusen GmbH, Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA) veranschaulicht, um die Vor- und Nachteile jeder Form aufzuzeigen.
5. Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Profifußball: Das Kapitel behandelt die Motive für Beteiligungen an Fußballvereinen und die damit verbundenen Gefahren für den Sport. Es analysiert die Zwecke der Beteiligungsbeschränkungen, insbesondere das Verbot von Mehrheitsbeteiligungen und die „50+1“-Regel, sowie Ausnahmen wie die „Lex Leverkusen“ und die „Lex Kind“. Die Problematik von Mehrfachbeteiligungen und das Fehlen eines entsprechenden Verbots werden ebenfalls diskutiert, um die Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen darzustellen.
Schlüsselwörter
Deutscher Lizenzfußball, Rechtsformen, Beteiligungsbeschränkungen, „50+1“-Regel, AG, GmbH, KGaA, e.V., Ausgliederung, wirtschaftliche Aspekte, Vereinsrecht, Kapitalgesellschaften, Mehrheitsbeteiligungen, Lex Leverkusen, Lex Kind, DFB, DFL.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Rechtsformen und Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Lizenzfußball
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Rechtsformen und Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Lizenzfußball. Sie analysiert verschiedene Rechtsformen von Fußballvereinen und bewertet deren Vor- und Nachteile im Kontext des deutschen Fußballsystems. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beleuchtung bestehender Beteiligungsbeschränkungen und deren Auswirkungen auf den Sport.
Welche Rechtsformen von Fußballvereinen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rechtsformen eingetragener Verein (e.V.), Aktiengesellschaft (AG), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) im Kontext von Fußballvereinen. Sie vergleicht diese Rechtsformen hinsichtlich ihrer Eignung für den professionellen Fußball.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind die verschiedenen Rechtsformen von Fußballvereinen, die Ausgliederung von Lizenzfußballabteilungen in Kapitalgesellschaften, die Beteiligungsbeschränkungen und deren Rechtfertigung, die „50+1“-Regel und deren Ausnahmen, sowie die Risiken und Herausforderungen durch Mehrfachbeteiligungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Organisationsstruktur des deutschen Fußballsports, Der Fußballbundesligaverein als Idealverein, Ausgliederung der Lizenzfußballabteilung auf eine Kapitalgesellschaft und Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Profifußball. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Welche Organisationen spielen im deutschen Fußball eine Rolle?
Die Arbeit behandelt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Dachverband, den Liga-Fußballverband und die Deutsche Fußball Liga (DFL). Es wird die hierarchische Struktur und die jeweiligen Kompetenzen dieser Organisationen erläutert.
Was versteht man unter der „50+1“-Regel?
Die „50+1“-Regel ist eine Beteiligungsbeschränkung im deutschen Fußball, die sicherstellen soll, dass die Vereine mehrheitlich in den Händen ihrer Mitglieder bleiben. Sie besagt, dass die Mitglieder eines Vereins mindestens 50% plus eine Stimme der Anteile halten müssen.
Welche Ausnahmen von der „50+1“-Regel gibt es?
Die Arbeit diskutiert Ausnahmen von der „50+1“-Regel, wie die „Lex Leverkusen“ und die „Lex Kind“, die unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen von der Regel zulassen.
Welche Motive gibt es für die Ausgliederung der Lizenzfußballabteilung?
Motive für die Ausgliederung sind wirtschaftliche Aspekte, die Beseitigung von Rechtsformverfehlungen, der Schutz des Muttervereins vor Insolvenz, Gläubigerschutz und die Professionalisierung der Geschäftsführung.
Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Rechtsformen?
Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Rechtsformen (AG, GmbH, KGaA) im Detail und veranschaulicht diese anhand von Praxisbeispielen wie Eintracht Frankfurt AG, Bayer Leverkusen GmbH und Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA.
Welche Gefahren bergen Mehrfachbeteiligungen?
Die Arbeit diskutiert die Gefahren, die durch das Fehlen eines Verbots von Mehrfachbeteiligungen im deutschen Lizenzfußball entstehen können, und beleuchtet die Problematik der mehrfache personelle Einflussnahme.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Lizenzfußball, Rechtsformen, Beteiligungsbeschränkungen, „50+1“-Regel, AG, GmbH, KGaA, e.V., Ausgliederung, wirtschaftliche Aspekte, Vereinsrecht, Kapitalgesellschaften, Mehrheitsbeteiligungen, Lex Leverkusen, Lex Kind, DFB, DFL.
- Citar trabajo
- Nico Sassadeck (Autor), 2015, Rechtsformen und Beteiligungsbeschränkungen im deutschen Lizenzfußball, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419170