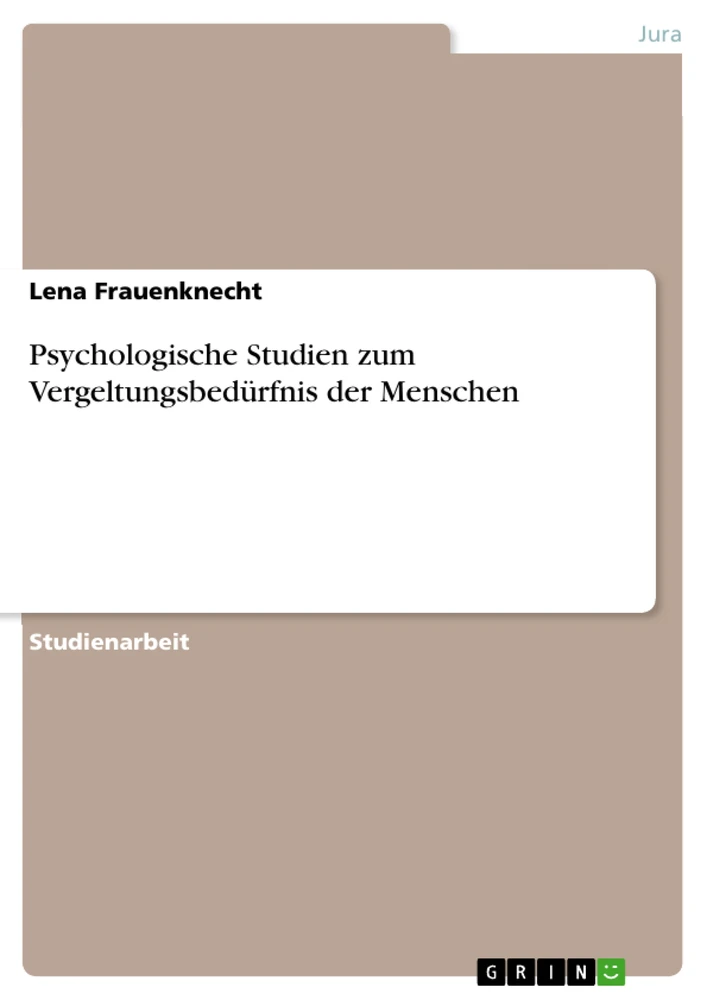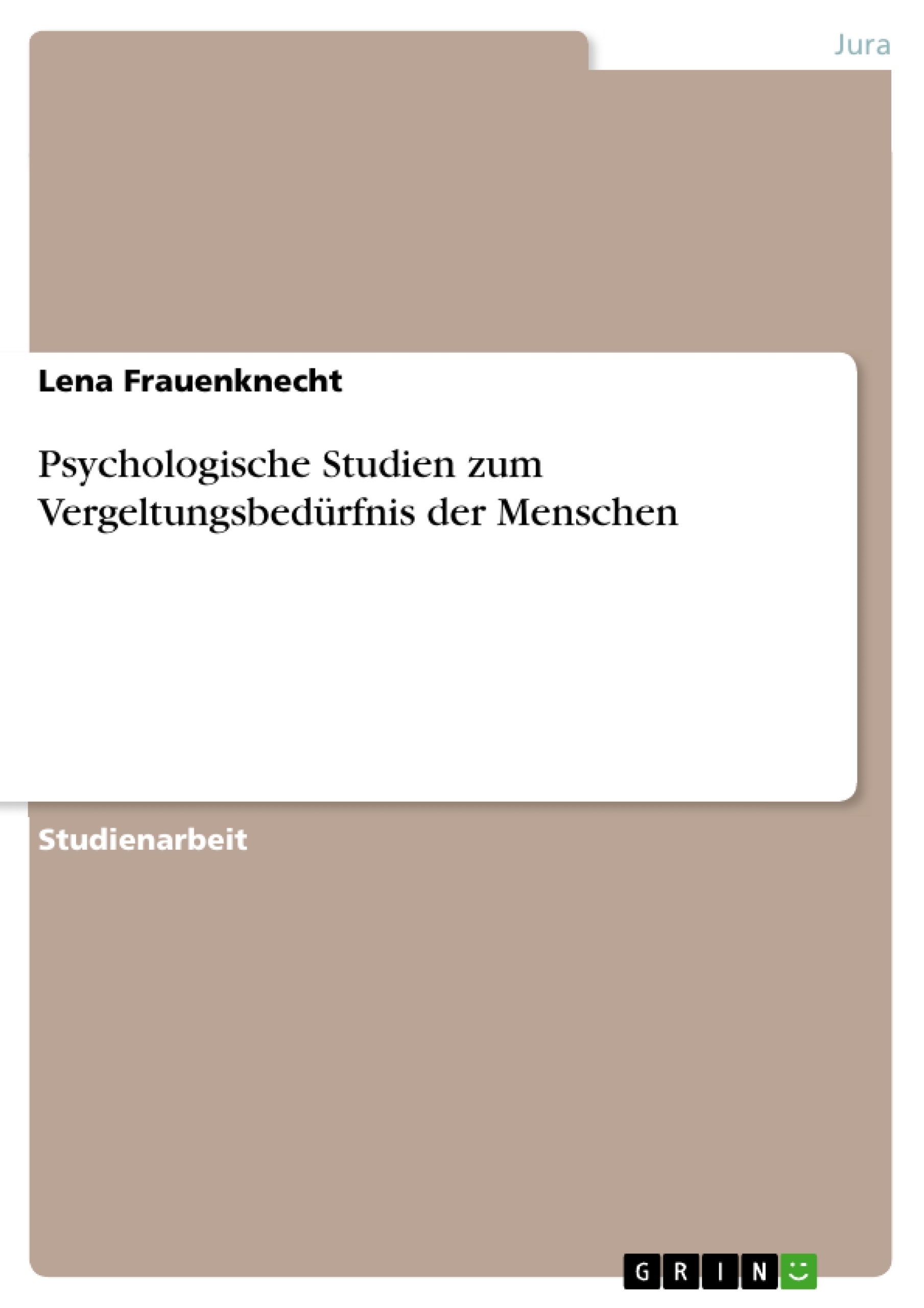Im Rahmen der Arbeit erfolgt eine Analyse psychologischer Studien zum Vergeltungsbedürfnis der Menschen im Kontext der Kriminalstrafe.
„Wie du mir, so ich dir.“, „Cui honorem, honorem.“ – Diese Redewendungen aus dem alltäglichen Sprachgebrauch veranschaulichen eines sehr deutlich: Die Menschen sind nachtragend – im negativen wie im positiven Sinne. Der Wunsch nach Vergeltung ist somit eine Art Grundbedürfnis, das fast einem jedem von uns innewohnt. Fälschlicherweise wird das Bedürfnis nach Vergeltung häufig mit Rachsucht gleichgesetzt, weshalb dem Vergeltungswunsch in der Regel vorrangig negative Konnotationen anhaften. Dies hat zur Folge, dass Menschen ihr Verlangen danach, erlittenes Unrecht vergolten sehen zu wollen, oftmals nicht laut äußern, zum Teil sogar leugnen. Auch innerhalb des Strafrechts ist die Bestrafung aus Motiven der Vergeltung teils verpönt, sodass es manchmal scheint, als würde der vergeltende Charakter, der im Grunde jeder Sanktion innewohnt, unter dem Deckmantel der Generalprävention verschleiert.
Das Vergeltungsbedürfnis stellt vor allem im Kontext von Straftaten und deren Sanktionierung einen interessanten Untersuchungsgegenstand dar. In der vorliegenden Arbeit soll daher eine Analyse psychologischer Studien erfolgen, die sich mit der Vergeltung als Strafmotiv auseinandersetzen. Die Tatsache, dass uns der Gedanke an Vergeltung fast allen bekannt ist und in diversesten Lebenssituationen begegnet, lässt den Rückschluss zu, dass sich die Psychologie – ähnlich wie die Philosophie oder die Strafrechtslehre – eingehend mit dem Vergeltungskonzept beschäftigt hat. Tatsächlich aber hat die Psychologie der Frage nach den Gründen, die eine Bestrafung von Menschen rechtfertigen können, bislang vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt. Ob die Vergeltung einen legitimen Strafzweck darstellt, ist im Strafrecht seit jeher stark umstritten. Kaum ein anderer Grund, der zur Rechtfertigung für Strafen herangezogen wird, polarisiert innerhalb der Gesellschaft derart stark wie die Vergeltung.
Im Zuge dieser Arbeit sollen daher psychologische Studien untersucht werden, die gegebenenfalls ein allgemeines Vergeltungsbedürfnis der Menschen belegen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen insbesondere dahingehend näher beleuchtet werden, ob die Vergeltung einen legitimen Strafzweck darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. „Strafe“ und „Vergeltung“
- I. Terminologie
- II. Die Vergeltung als Strafzweck in Relation zu präventiven Ansätzen
- 1. Absolute Straftheorie
- 2. Relative Straftheorien
- a) Spezialprävention
- b) Generalprävention
- 3. Vereinigungstheorien
- 4. Empirisch-soziologische Theorie
- III. Psychologische Studien zum Vergeltungsbedürfnis der Menschen
- 1. Tiefenpsychologischer Ansatz
- 2. Analysekriterien und das Corpus
- 3. Ausgewählte Studien von Kevin Carlsmith und Kollegen als exemplarische Belege für das Vergeltungsbedürfnis der Menschen
- a) „Incapacitation and just deserts as motives for punishment“, Darley/Carlsmith/Robinson (2002)
- aa) Studie 1
- bb) Studie 2
- b) „The roles of retribution and utility in determining punishment“, Carlsmith (2006)
- c) „The fine line between interrogation and retribution“, Carlsmith/Sood (2008)
- d) „The Paradoxical Consequences of Revenge“, Carlsmith/Gilbert/Wilson (2008)
- a) „Incapacitation and just deserts as motives for punishment“, Darley/Carlsmith/Robinson (2002)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit das Vergeltungsbedürfnis der Menschen eine zentrale Rolle im Strafrecht spielt. Es wird untersucht, ob und inwieweit die Vergeltung als Strafzweck gerechtfertigt ist und welche Folgen diese Denkweise für die Praxis des Strafens hat.
- Die unterschiedlichen Straftheorien und ihre Verhältnis zur Vergeltung
- Die Rolle der Vergeltung in der Rechtsphilosophie
- Empirische Forschungsergebnisse zum Vergeltungsbedürfnis der Menschen
- Die ethischen und rechtlichen Herausforderungen einer retributiven Straftheorie
- Die Auswirkungen des Vergeltungsbedürfnisses auf die Gestaltung des Strafvollzugs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die zentralen Fragestellungen und die Methodik der Untersuchung vorgestellt werden. Anschließend werden die Begriffe „Strafe“ und „Vergeltung“ terminologisch geklärt und die Vergeltung als Strafzweck im Kontext verschiedener Straftheorien analysiert. In einem weiteren Schritt werden psychologische Studien zum Vergeltungsbedürfnis der Menschen beleuchtet, wobei exemplarisch ausgewählte Studien von Kevin Carlsmith und Kollegen vorgestellt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der Motive für Strafen sowie auf den möglichen Paradoxien der Vergeltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen „Strafe“ und „Vergeltung“. Weitere wichtige Themenfelder sind die unterschiedlichen Straftheorien, das Vergeltungsbedürfnis der Menschen, die Rolle der Prävention und Resozialisierung im Strafrecht, die ethischen und rechtlichen Herausforderungen einer retributiven Straftheorie sowie die empirische Forschung zum Thema. Die Arbeit beleuchtet die Themen aus rechtlicher, psychologischer und soziologischer Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Vergeltungsbedürfnis dasselbe wie Rachsucht?
Nein, fälschlicherweise wird es oft gleichgesetzt. Die Arbeit zeigt, dass Vergeltung ein Grundbedürfnis nach Ausgleich von erlittenem Unrecht ist, das oft negativ konnotiert und daher geleugnet wird.
Welche Rolle spielt Vergeltung im deutschen Strafrecht?
Sie ist als Strafgrund (absolute Straftheorie) hoch umstritten und wird oft hinter präventiven Ansätzen (General- und Spezialprävention) verschleiert.
Was zeigen die Studien von Kevin Carlsmith?
Diese psychologischen Studien belegen ein tief verwurzeltes Vergeltungsbedürfnis bei Menschen und untersuchen Paradoxien, wie etwa die emotionalen Folgen von Rache.
Was ist der Unterschied zwischen absoluten und relativen Straftheorien?
Absolute Theorien sehen den Strafgrund allein in der Tat (Vergeltung), während relative Theorien einen Zweck verfolgen (Prävention künftiger Taten).
Ist Vergeltung ein legitimer Strafzweck?
Die Arbeit analysiert diese Frage kritisch auf Basis psychologischer Erkenntnisse und juristischer Lehrmeinungen, ohne eine einfache Ja/Nein-Antwort zu geben.
- Citar trabajo
- Lena Frauenknecht (Autor), 2017, Psychologische Studien zum Vergeltungsbedürfnis der Menschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429635