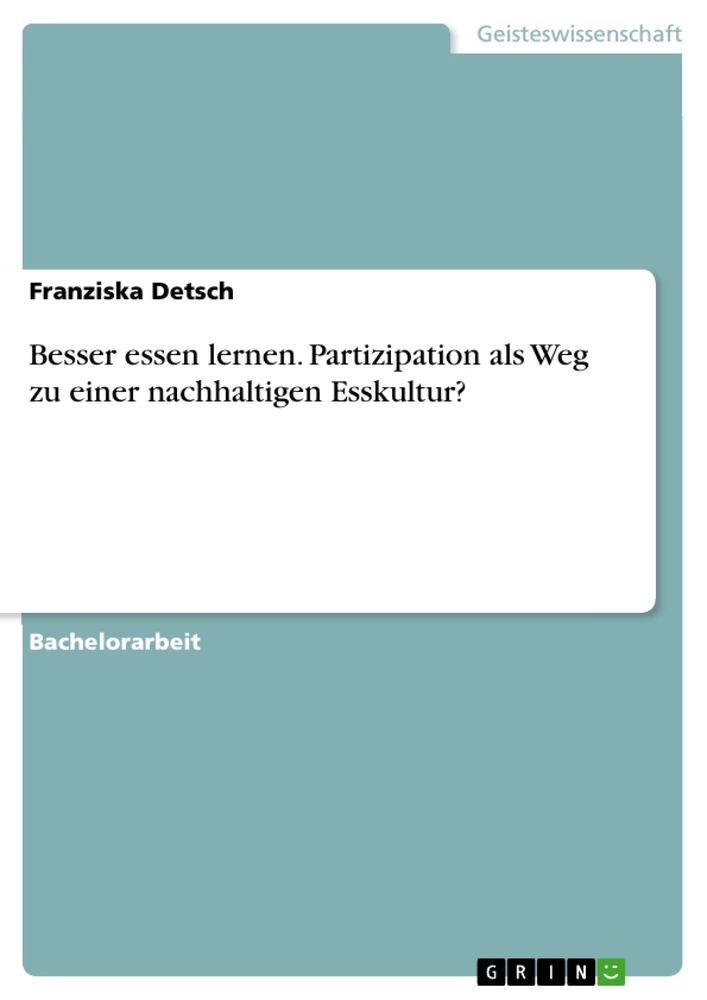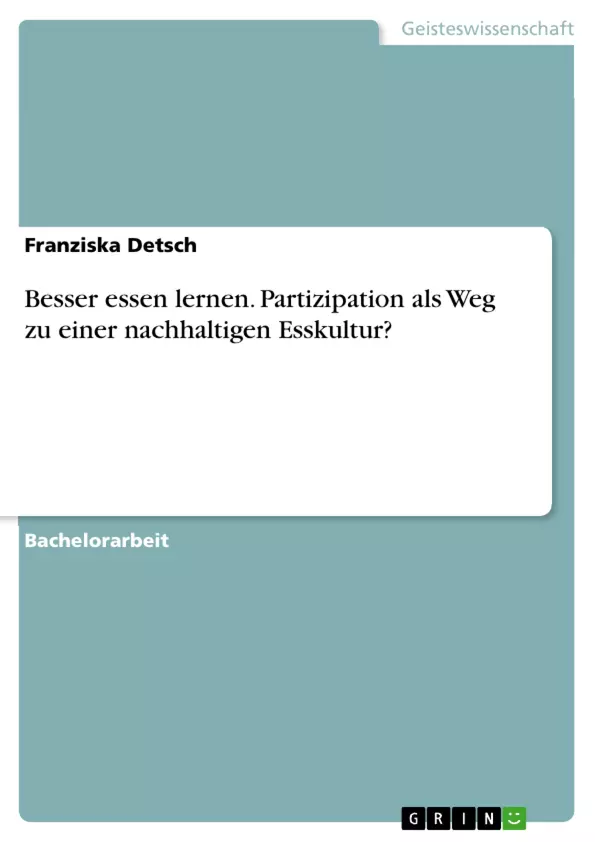Essen und Trinken zählen zu den grundlegendsten Bedürfnissen. Welche Nahrungsmittel wir erzeugen, wie wir sie zubereiten sowie in welcher Weise und in welchen Situationen wir sie zu uns nehmen, ist größtenteils von sozialen Faktoren abhängig. Entscheidungen, die rund um die Nahrungsaufnahme getroffen werden, haben zugleich weitreichendere Auswirkungen auf ökonomische und ökologische Zusammenhänge und werden z.B. im Zusammenhang mit Klimawandel und einem überlasteten Gesundheitssystem diskutiert.
Die Reflexion der vielschichtigen Zusammenhänge und Auswirkungen unseres Esshandelns wirft die Fragen auf, ob ein gesellschaftsumfassender Wandel der Esskultur möglich ist und wie dieser sich gestalten könnte. Das normative Moment einer notwendigen Veränderung zu einer für Mensch und Umwelt nachhaltigeren Esskultur bildet das Motiv dieser Bachelorarbeit, deren zentrale Fragestellung lautet: Wie kann eine gesunde und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Esskultur entstehen?
Ein einmal erlerntes und habitualisiertes Esshandeln zu ändern, bedarf einer tiefgreifenden Veränderung der individuellen Bedeutungszuschreibung zum Essen. Folgt man dem sozialisazionstheoretischen Ansatz, so stellen Familie und Kindertagesstätte die wohl prägendsten Institutionen der kindlichen Ernährungsbildung dar. Die These dieser Arbeit ist, dass ein umfassender Wandel der Esskultur sich nur einstellen kann, wenn Kinder und Erwachsene an einer nachhaltigen Ernährungsgestaltung durch Wissenserwerb und die praktische Mitgestaltung und Mitbestimmung über das eigene Ernährungshandeln in den jeweiligen Lebenswelten partizipieren können.
In dieser Arbeit werden anhand einer qualitativ-empirischen Untersuchung die Esskulturen unterschiedlicher Familien im privat-familiären und im halböffentlich-institutionellen Umfeld der Kita analysiert, um die Bedeutung von Partizipationsprozessen für die Herausbildung einer gesünderen und nachhaltigeren Esskultur aufzuklären. Dafür erfolgt eine Erläuterung zentraler Begriffe und die Reflexion von theoretischen Konzepten der Sozialität des Essens, der Sozialisation und des nachhaltigen Esshandelns. Es schließt sich die Beschreibung des methodischen Vorgehens im Rahmen der empirischen Untersuchung an. Anschließend erfolgen die Analyse von Leitfadeninterviews mit Elternteilen und die kategorienbasierte Systematisierung der Ergebnisse. Die Arbeit schließt mit einem Fazit im Rückbezug auf die aufgestellten Forschungsthesen sowie den Forschungsperspektiven.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Essen und Ernährung
- Esskultur
- Nachhaltigkeit
- Partizipation
- Reflexion der theoretischen Ausgangspunkte
- Sozialisation in den Institutionen Familie und Kita
- Sozialität des Essens
- Nachhaltiges Esshandeln
- Methodisches Vorgehen im Forschungsprozess
- Forschungsinteresse
- Fallauswahl
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Analyse des Datenmaterials
- Wie gestaltet sich die familiäre Esskultur?
- Wie gestaltet sich die kitainterne Esskultur?
- Welche partizipativen Ansätze sind beim Esshandeln zu erkennen?
- Fazit
- Forschungsperspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Partizipationsprozessen für die Herausbildung einer gesünderen und nachhaltigeren Esskultur. Dabei werden die Esskulturen dreier Familien im privat-familiären und halböffentlich-institutionellen Umfeld der Kita analysiert.
- Die prägende Rolle der Institutionen Familie und Kita in der kindlichen Ernährungsbildung
- Die Sozialität des Essens als Ausdruck von Kultur, Identität und sozialen Beziehungen
- Die Bedeutung des nachhaltigen Esshandelns in Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Ressourcen
- Die verschiedenen Formen und Grade der Partizipation von Eltern und Kindern im Bereich Ernährung
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung einer gesünderen und nachhaltigeren Esskultur durch Partizipation.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beleuchtet zunächst zentrale Begriffe wie Essen, Ernährung, Esskultur, Nachhaltigkeit und Partizipation. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Sozialisation, Sozialität des Essens und des nachhaltigen Esshandelns erläutert.
Das methodische Vorgehen der qualitativ-empirischen Untersuchung wird transparent dargestellt, inklusive Fallauswahl, Datenerhebung und Datenauswertung.
Die Analyse der Interviews mit drei Familien fokussiert auf die familiäre Esskultur, die kitainterne Esskultur und die darin identifizierten partizipativen Ansätze. Dabei werden die Strukturen der Esssituationen, die Einkäufe, die Wahl und Zubereitung der Nahrungsmittel sowie die Einflussfaktoren auf das Esshandeln der Familien beleuchtet.
Im Fazit werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und in Bezug auf die Forschungsfrage und die Thesen gesetzt. Abschließend werden Perspektiven für weiterführende Forschungsarbeiten gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Esskultur, Nachhaltigkeit, Partizipation, Sozialisation, Ernährungspädagogik, Familienstrukturen, Kita-Alltag, Ernährungswissen, Lebensmittelskandale, Bio-Produkte, Vegetarische Ernährung, Fleischkonsum, regionale Produkte, saisonale Verfügbarkeit und Gesundheitsförderung.
- Citation du texte
- Franziska Detsch (Auteur), 2013, Besser essen lernen. Partizipation als Weg zu einer nachhaltigen Esskultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432539