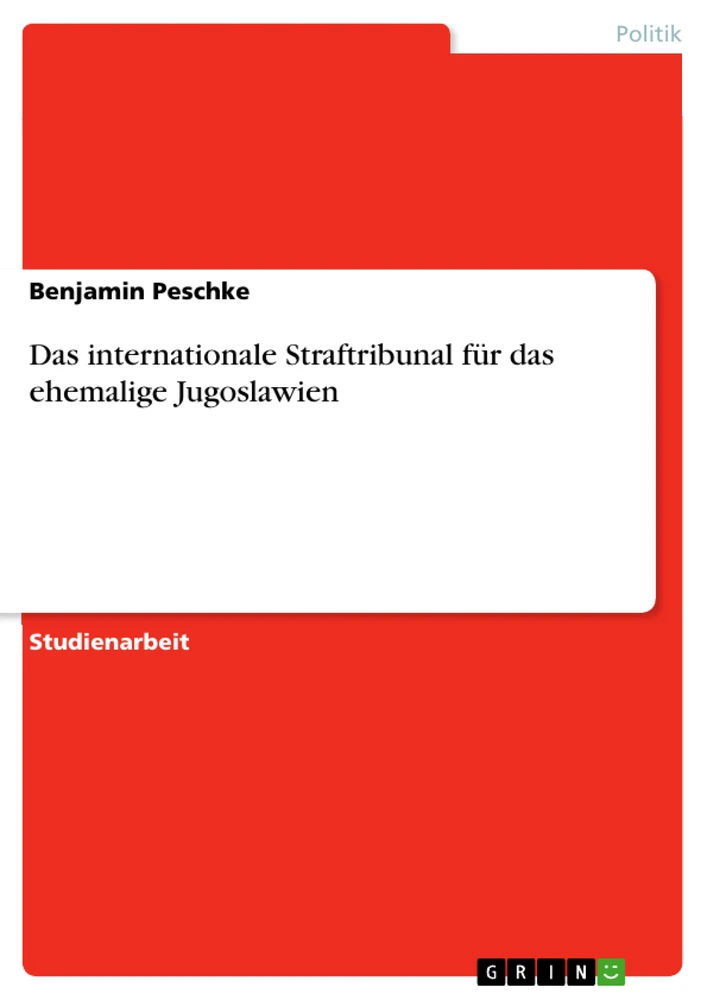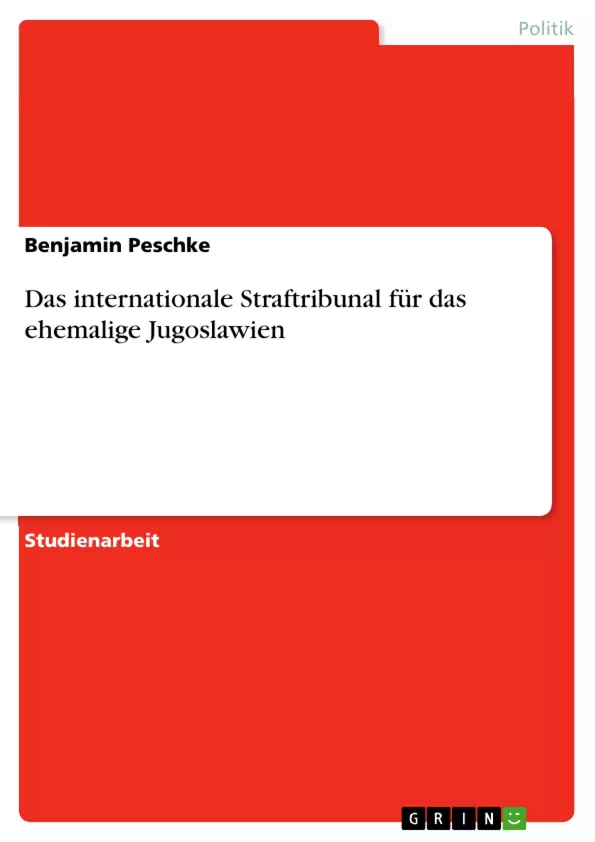Im Zuge der Kamphandlungen in Slowenien, Kroatien und vor allem in Bosnien-Herzegowina kam es auf allen, aber vor allem auf Seiten der bosnisch-serbischen Milizen zu Kriegsverbrechen und Gräueltaten, wie man es im Europa des späten zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr erwartet hatte. Die Vereinten Nationen entschieden sich nach dem Beispiel von Nürnberg ein Tribunal einzuberufen, das diese Verbrechen ahnden und somit zum Friedensprozess beitragen sollte.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Hintergründen der Einrichtung dieses Tribunals, dessen Aufgaben, der Arbeit des Gerichts und dessen Mithilfe an der Friedenssicherung. Außerdem will ich die Anwendung internationalen Strafrechts am Beispiel des Jugoslawien Tribunals mit den Visionen des Kantschen Idealismus vergleichen und so die Theorie mit der heutigen Praxis in Verbindung bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien
- Der Krieg in Bosnien-Herzegowina
- „Ethnische Säuberung“ als Kriegsziel
- Das Tribunal
- Einsetzung und Gründung
- Die VN-Resolution als Rechtsgrundlage
- Aufgaben und Tatbestände
- Internationales Strafrecht, der Sieg des kantschen Idealismus?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entstehung und Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) im Kontext des Balkankonflikts der 1990er Jahre. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe der Tribunaleinrichtung, seine Aufgaben und Beiträge zur Friedenssicherung. Darüber hinaus wird die Anwendung internationalen Strafrechts am Beispiel des ICTY mit den Ideen des Kantschen Idealismus verglichen, um Theorie und Praxis in Beziehung zu setzen.
- Die Entstehung des Balkankonflikts und die Rolle des ICTY
- Kriegsverbrechen und „ethnische Säuberungen“ im ehemaligen Jugoslawien
- Die Rolle internationalen Strafrechts in der Friedenssicherung
- Der Vergleich der ICTY-Arbeit mit den Visionen des Kantschen Idealismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit setzt den Kontext des ICTY im historischen Vergleich mit den Nürnberger Prozessen und erläutert die besonderen Herausforderungen im Zuge des Kalten Krieges. Sie skizziert den Ausbruch des Balkankonflikts und die Notwendigkeit der Einrichtung eines Tribunals zur Ahndung der Kriegsverbrechen.
- Der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien: Dieses Kapitel beleuchtet die politischen und ethnischen Spannungen, die zum Zerfall Jugoslawiens führten. Es beschreibt die Konflikte in Slowenien und Kroatien und führt zur Eskalation des Krieges in Bosnien-Herzegowina.
- Der Krieg in Bosnien-Herzegowina: Dieses Kapitel befasst sich mit den Kriegsverbrechen, die im Zuge des bosnischen Konflikts begangen wurden, insbesondere mit der Politik der „ethnischen Säuberungen“. Die Intervention der Vereinten Nationen mit Schutztruppen, Schutzzonen und Sanktionen wird beleuchtet.
- „Ethnische Säuberung“ als Kriegsziel: Dieses Kapitel vertieft die Analyse der „ethnischen Säuberungen“ als systematische und geplante Kriegsstrategie. Es erklärt, wie die geplante Vertreibung als Kriegsziel zu einem neuen Grad von Grausamkeit führte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen wie Internationales Strafrecht, Völkermord, „ethnische Säuberung“, Balkankonflikt, ICTY, Nürnberger Prozesse, Kantscher Idealismus, Friedenssicherung und humanitäres Völkerrecht. Die Arbeit analysiert den Einsatz von internationalem Strafrecht zur Verfolgung von Kriegsverbrechen im Kontext des Jugoslawien-Konflikts und stellt die Verbindung zur Philosophie des Kantschen Idealismus her.
- Quote paper
- Benjamin Peschke (Author), 2004, Das internationale Straftribunal für das ehemalige Jugoslawien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443749