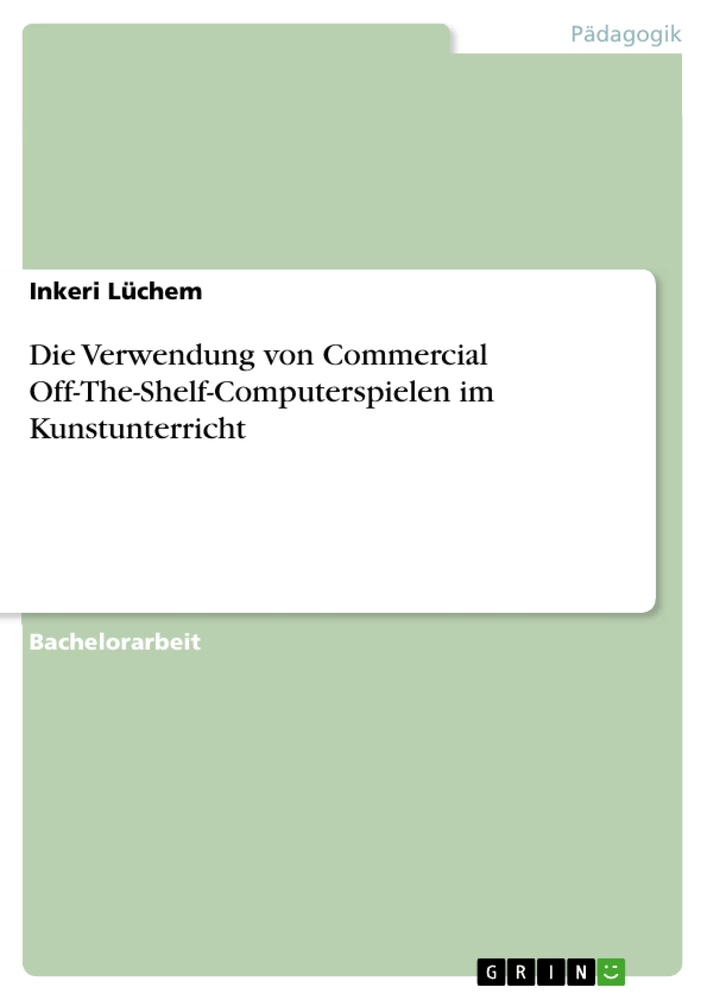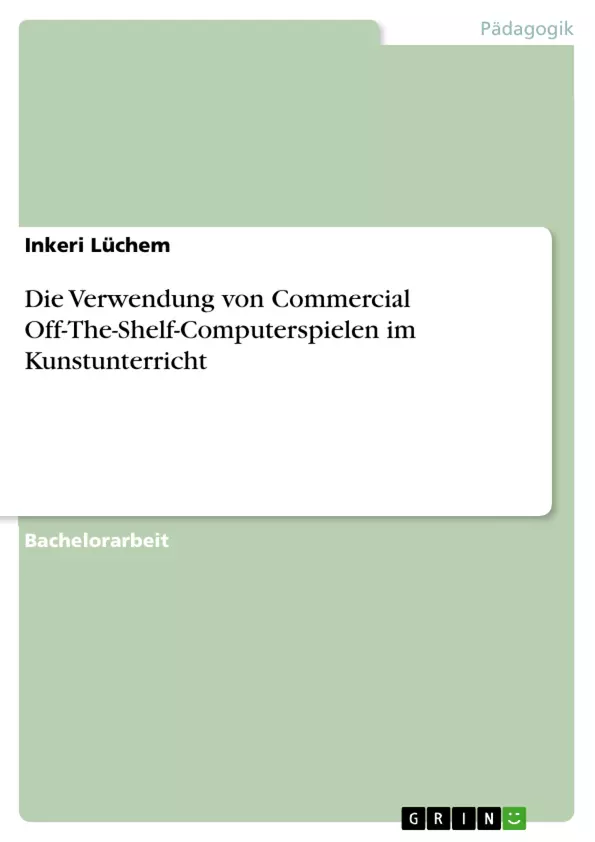Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung theoretischer Hintergründe des Spielens in der Pädagogik und der Kunst, die aktuelle Situation von COTS-Games im (Schul-)Alltag Jugendlicher und Möglichkeiten der praktischen Anwendung im Kunstunterricht.
Erwartungen an Lerneffekte durch Computerspiele entstehen zu einem großen Teil durch die Annahme, dass die enge Anbindung an die Lebenswelten und Interessen Jugendlicher positive Auswirkungen hat. Als medienpädagogische Grundlage untersuche ich ein Kompetenzmodell der handlungsorientierten Medienpädagogik. Durch interaktive Unterrichtsvorhaben und vielfältige Aufgabenstellungen mit thematischer Anknüpfung an die Erlebniswelt der Schüler_innen sollen diese eigene Vorstellungen entwickeln und sich nicht-sprachlich äußern lernen.
Ergänzend zur theoretischen Arbeit wird die praktische Anwendung im Kunstunterricht skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Neue politische Anerkennung für Computerspiele
- 2. Die Spieltheorie im kunstwissenschaftlichen und pädagogischen Diskurs
- 3. Computerspiele als Bildmedium
- 3.1 Das doppelte Bild im Computerspiel
- 3.2 Zweckentfremdung und Aneignung in der Geschichte der Computerspiele
- 3.3 Aneignung als künstlerisches Prinzip
- 4. Potential und Grenzen von COTS im Unterricht
- 4.1 Interaktive Medien im Unterricht heute
- 4.2 Mögliche positive Effekte von COTS
- 4.3 Grenzen und Einschränkungen
- 5. Die konkrete Anwendung von COTS im Kunstunterricht
- 5.1 Ziele und Rahmenbedingungen
- 5.2 Grundlagen der Medienpädagogik
- 5.3 Rechtliches
- 5.4 Ressourcen
- 5.5 Minecraft
- 5.5.1 Minecraft als Beispiel einer digitalen Maker-Kultur
- 5.5.2 Anwendungsmöglichkeiten und -beispiele
- 5.6 Weitere COTS
- 5.7 Eigene Spieleentwicklung
- 6. Digitale Spielepädagogik für Gamer_innen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von kommerziellen Computerspielen (COTS) im Kunstunterricht. Die Zielsetzung ist es, das Potential und die Grenzen von COTS im Unterricht zu erforschen und konkrete Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dabei werden pädagogische, rechtliche und medienpädagogische Aspekte berücksichtigt.
- Politische Anerkennung von Computerspielen als Leitmedien und kulturelle Güter
- Computerspiele als Bildmedien und ihre künstlerische Aneignung
- Potential und Grenzen von COTS im Kunstunterricht
- Medienpädagogische Grundlagen und Kompetenzmodelle
- Konkrete Beispiele der Anwendung von COTS (z.B. Minecraft)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Neue politische Anerkennung für Computerspiele: Dieses Kapitel beleuchtet die veränderte öffentliche Wahrnehmung von Computerspielen. Nach anfänglicher Kritik bezüglich Gewalt und negativer Auswirkungen, werden Computerspiele im Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008 positiv als "Leitmedien" und Identitätsstifter gewürdigt. Die wachsende Anerkennung manifestiert sich in Initiativen wie dem Deutschen Computerspielpreis und der Webseite www.spielbar.de, die verschiedene Perspektiven und Bewertungen von Spielen präsentieren und somit die Medienkompetenz fördern sollen. Die zunehmende Akzeptanz ist jedoch weiterhin verknüpft mit der Betonung pädagogischer Werte und der Fokussierung auf jugendliche Nutzer.
2. Die Spieltheorie im kunstwissenschaftlichen und pädagogischen Diskurs: (Es fehlt der Text für Kapitel 2 in der Vorlage. Hier sollte eine Zusammenfassung des zweiten Kapitels eingefügt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die im Kapitel behandelten Spieltheorien im kunstwissenschaftlichen und pädagogischen Kontext beschreibt.)
3. Computerspiele als Bildmedium: Dieses Kapitel untersucht Computerspiele als Bildmedien, beleuchtet das „doppelte Bild“ im Computerspiel, analysiert die Zweckentfremdung und Aneignung in der Geschichte der Computerspiele und betont die Aneignung als künstlerisches Prinzip. Es wird argumentiert, dass die künstlerische Auseinandersetzung mit Computerspielen die Medienkompetenz fördert und mit den Kompetenzbereichen der Kultusministerkonferenz korreliert. Der Fokus liegt auf dem kreativen Umgang mit den Spielstrukturen und der Reflexion von Mediennutzung.
4. Potential und Grenzen von COTS im Unterricht: Kapitel 4 evaluiert das Potential und die Grenzen des Einsatzes von kommerziellen Computerspielen im Unterricht. Es wird der aktuelle Stand interaktiver Medien im Unterricht beleuchtet, mögliche positive Effekte von COTS im Unterricht diskutiert und gleichzeitig die Grenzen und Einschränkungen dieser Anwendung beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die spezifischen Eigenschaften von COTS in pädagogisch sinnvoller Weise genutzt werden können, ohne dabei die potentiellen Nachteile zu ignorieren.
5. Die konkrete Anwendung von COTS im Kunstunterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung von COTS im Kunstunterricht. Es werden Ziele und Rahmenbedingungen, medienpädagogische Grundlagen, rechtliche Aspekte, Ressourcen und die Anwendung von Minecraft als Beispiel einer digitalen Maker-Kultur diskutiert. Zusätzlich werden weitere COTS und die Möglichkeit der eigenen Spieleentwicklung betrachtet. Das Kapitel bietet einen praxisorientierten Leitfaden für den Einsatz von Computerspielen im Kunstunterricht.
6. Digitale Spielepädagogik für Gamer_innen: (Es fehlt der Text für Kapitel 6 in der Vorlage. Hier sollte eine Zusammenfassung des sechsten Kapitels eingefügt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die im Kapitel behandelten Aspekte der digitalen Spielepädagogik für Gamer_innen beschreibt.)
Schlüsselwörter
Computerspiele, Kunstunterricht, Medienpädagogik, Medienkompetenz, COTS, digitale Maker-Kultur, Spieltheorie, Bildmedien, Rechtliche Rahmenbedingungen, Minecraft, interaktive Medien, Jugendliche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Verwendung von kommerziellen Computerspielen (COTS) im Kunstunterricht"
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von kommerziellen Computerspielen (COTS) im Kunstunterricht. Sie erforscht das Potential und die Grenzen von COTS im Unterricht und zeigt konkrete Anwendungsmöglichkeiten auf. Pädagogische, rechtliche und medienpädagogische Aspekte werden dabei berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 beleuchtet die neue politische Anerkennung von Computerspielen. Kapitel 2 (Text fehlt in der Vorlage) behandelt Spieltheorien im kunstwissenschaftlichen und pädagogischen Diskurs. Kapitel 3 untersucht Computerspiele als Bildmedien, inklusive der Aneignung als künstlerisches Prinzip. Kapitel 4 evaluiert das Potential und die Grenzen von COTS im Unterricht. Kapitel 5 befasst sich mit der konkreten Anwendung von COTS im Kunstunterricht, mit Beispielen wie Minecraft. Kapitel 6 (Text fehlt in der Vorlage) behandelt Aspekte der digitalen Spielepädagogik für Gamer_innen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Potential und die Grenzen von COTS im Kunstunterricht zu erforschen und konkrete Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Pädagogische, rechtliche und medienpädagogische Aspekte werden dabei berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Politische Anerkennung von Computerspielen, Computerspiele als Bildmedien und deren künstlerische Aneignung, Potential und Grenzen von COTS im Kunstunterricht, medienpädagogische Grundlagen und Kompetenzmodelle sowie konkrete Beispiele der Anwendung von COTS (z.B. Minecraft).
Welche Rolle spielt Minecraft in dieser Arbeit?
Minecraft dient als Beispiel für eine digitale Maker-Kultur und wird als konkretes Beispiel für die Anwendung von COTS im Kunstunterricht vorgestellt. Die Arbeit zeigt Anwendungsmöglichkeiten und -beispiele von Minecraft im Kunstunterricht auf.
Welche rechtlichen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit berührt rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit dem Einsatz von COTS im Kunstunterricht. Genaueres wird im Kapitel 5 erläutert.
Welche medienpädagogischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt medienpädagogische Grundlagen und Kompetenzmodelle im Kontext des Einsatzes von Computerspielen im Unterricht. Diese werden insbesondere in Kapitel 4 und 5 erläutert.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe umfasst Lehrende im Kunstunterricht, Medienpädagogen und alle Interessierten, die sich mit dem Einsatz von Computerspielen im Bildungskontext auseinandersetzen möchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Computerspiele, Kunstunterricht, Medienpädagogik, Medienkompetenz, COTS, digitale Maker-Kultur, Spieltheorie, Bildmedien, rechtliche Rahmenbedingungen, Minecraft, interaktive Medien, Jugendliche.
Wo finde ich weitere Informationen zu den fehlenden Kapiteln 2 und 6?
Die Vorlage enthielt keine Zusammenfassungen für Kapitel 2 und 6. Für detaillierte Informationen müsste die vollständige Arbeit konsultiert werden.
- Quote paper
- Inkeri Lüchem (Author), 2018, Die Verwendung von Commercial Off-The-Shelf-Computerspielen im Kunstunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444048