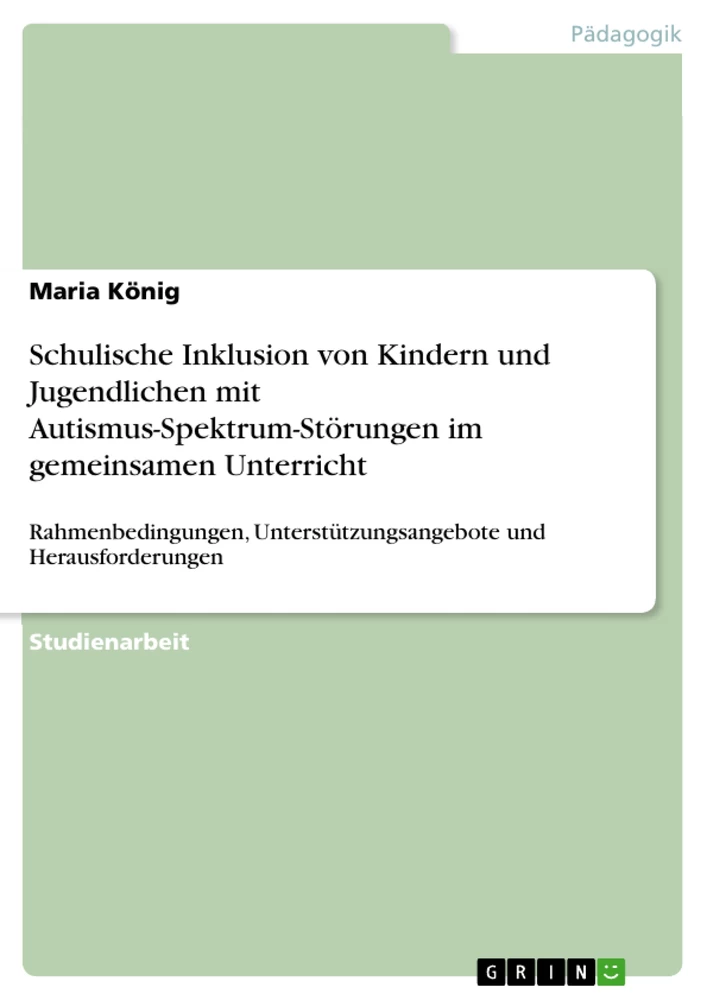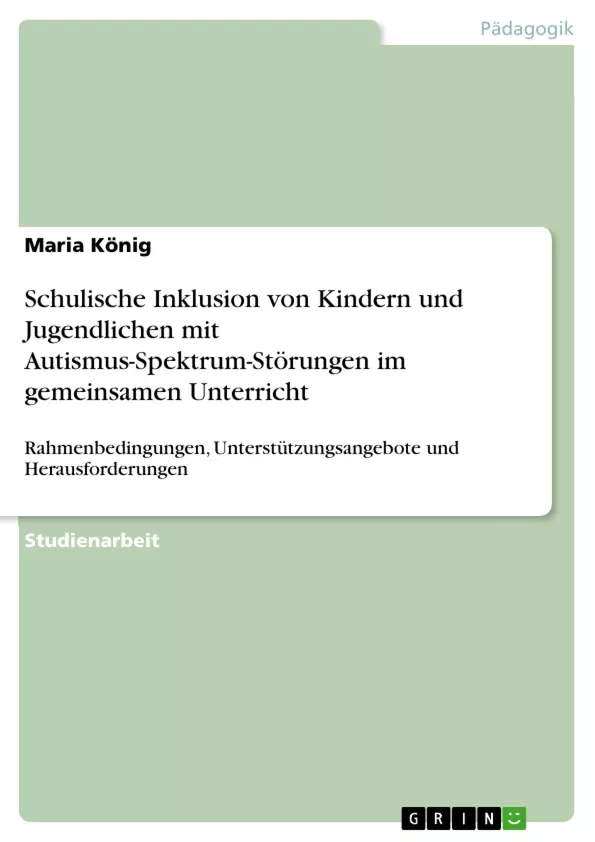Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen brauchen Unterstützung. Früher geschah dies in den Förderschulen, heute sollen das die Regelschulen leisten können. Das Schwierige dabei ist, dass Autisten in keine Schublade passen, denn von Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie sich ins System einfügen, doch genau das fällt Autisten so schwer. Daher ist es unschwer zu glauben, dass es bei den verschiedenen Erscheinungsformen und Schweregraden von Autismus-Spektrum-Störungen nicht oder schwer möglich ist, jedem Schüler gerecht zu werden. Nach aktuellem Forschungsstand sind etwa sechs bis sieben von 1000 Menschen von Autismus-Spektrum-Störungen betroffen, doch nur ein geringer Teil erhält eine offizielle Diagnose.
Diese Arbeit thematisiert die schulische Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen im gemeinsamen Unterricht. Der Fokus soll dabei auf die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen in Regelschulen liegen. Die Arbeit soll zudem herausstellen, welche Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen erhalten können, damit die Inklusion möglichst gelingend ist. Nicht außer Acht gelassen werden außerdem die Herausforderungen für die Lehrkräfte, die maßgebend für eine gelingende Inklusion sind. Im ersten Teil wird ein Verständnis von Autismus aufgebaut. Dies wird im Folgenden dafür genutzt um herauszustellen, welche schulischen Förderungen Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen benötigen. Das Rahmenmodell zur schulischen Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen von Eckert und Sempert (2012) bietet eine theoretische Grundlage. Mit dieser Grundlage wird anschließend ein konkretes Förderkonzept, das TEACCH Förderkonzept, vorgestellt, das sich besonders für Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen eignet. Mit dem Abschnitt folgt die Einbeziehung des Inklusionsbegriffes. Nach einer Definition des Begriffs „Inklusion“ folgen die konkreten Rahmenbedingungen der inklusiven Beschulung. Bevor die Arbeit mit einem Fazit beendet wird, werden zunächst Gelingensfaktoren, Barrieren und Unterstützungsmöglichkeiten genannt, die für die Inklusion von Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen eine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Autismus?
- Welche Förderungen brauchen Menschen mit Autismus im schulischen Bereich?
- Rahmenmodell zur schulischen Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen
- Das TEACCH Förderkonzept für Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen
- Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen
- Definition des Begriffs Inklusion
- Rahmenbedingungen inklusiver Beschulung
- Personelle Bedingungen
- Räumliche und sächliche Bedingungen
- Gelingensfaktoren und Barrieren zur Inklusion bei Autismus-Spektrum-Störungen
- Unterstützungsmöglichkeiten bei Autismus-Spektrum-Störungen in inklusiven Settings
- Ausblick / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der schulischen Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen im gemeinsamen Unterricht. Sie konzentriert sich auf die Beschulung dieser Schüler in Regelschulen und untersucht die Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten, die ihnen eine gelingende Inklusion ermöglichen. Darüber hinaus werden die Herausforderungen für Lehrkräfte im Kontext der Inklusion von Schülern mit ASS beleuchtet.
- Verständnis von Autismus-Spektrum-Störungen und deren Auswirkungen auf den schulischen Alltag
- Analyse relevanter Förderkonzepte und Rahmenbedingungen für die schulische Inklusion von Schülern mit ASS
- Bewertung der Gelingensfaktoren und Herausforderungen der Inklusion von Schülern mit ASS in Regelschulen
- Identifizierung von spezifischen Unterstützungsangeboten und -maßnahmen für Schüler mit ASS im inklusiven Schulsetting
- Betrachtung der Rolle von Lehrkräften bei der erfolgreichen Inklusion von Schülern mit ASS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die aktuelle Situation der schulischen Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen und stellt die Zielsetzung und den Fokus der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel wird der Begriff des Autismus erläutert und es werden die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Autismus im schulischen Bereich beleuchtet. Kapitel drei beschäftigt sich mit der Definition und den Rahmenbedingungen der Inklusion und geht auf die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Inklusion von Schülern mit ASS in Regelschulen ein. Dieses Kapitel analysiert auch Gelingensfaktoren und Barrieren sowie relevante Unterstützungsmöglichkeiten im inklusiven Setting.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störungen, Inklusion, Regelschule, Förderkonzepte, TEACCH, Rahmenbedingungen, Unterstützungsmöglichkeiten, Gelingensfaktoren, Barrieren, Herausforderungen, Lehrkräfte, Integration, Inklusion von Schülern mit ASS, inklusive Beschulung.
Häufig gestellte Fragen
Wie gelingt die Inklusion von Schülern mit Autismus an Regelschulen?
Gelingende Inklusion erfordert spezifische Rahmenbedingungen, personelle Unterstützung und angepasste Förderkonzepte wie den TEACCH-Ansatz.
Was ist das TEACCH-Förderkonzept?
TEACCH bietet Strukturierungshilfen für den Alltag und die Lernumgebung, um Menschen mit Autismus Orientierung und Selbstständigkeit zu ermöglichen.
Welche Barrieren gibt es bei der schulischen Inklusion von Autisten?
Barrieren sind oft starre Schulsysteme, Reizüberflutung in großen Klassen und mangelndes Wissen über die Bedürfnisse von Autisten seitens der Lehrkräfte.
Wie viele Menschen sind von Autismus-Spektrum-Störungen betroffen?
Nach aktuellem Forschungsstand sind etwa sechs bis sieben von 1000 Menschen betroffen, wobei viele keine offizielle Diagnose erhalten.
Welche Rolle spielen Lehrkräfte bei der Inklusion?
Lehrkräfte sind maßgebend für den Erfolg, da sie die sozialen Interaktionen moderieren und die Lerninhalte individuell anpassen müssen.
- Arbeit zitieren
- Maria König (Autor:in), 2018, Schulische Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen im gemeinsamen Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445104