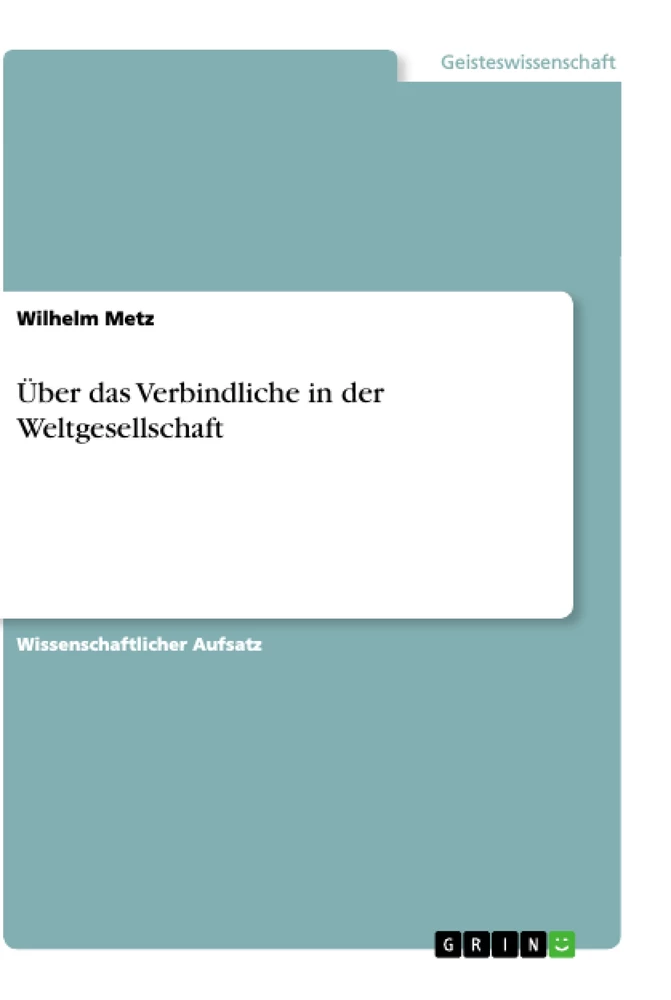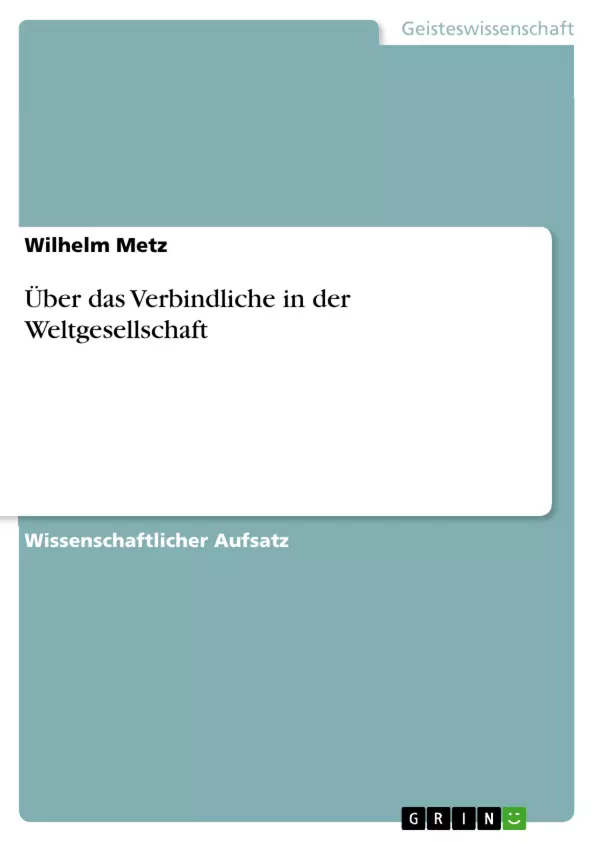Die Epoche der Gegenwart ist durch das Hervortreten der "Weltgesellschaft" (Luhmann) gekennzeichnet. Das Janusköpfige der Moderne besteht darin, einerseits die Pluralität verschiedener Religionen, Kulturen und politischer Systeme zu erleben, andererseits eine Vereinheitlichung der ganzen Menschheit zu vollziehen (>gläserner Mensch<, >Panoptikon<). In der Charta der Vereinten Nationen sind Werte und Ziele formuliert, die eine Normativität für die gesamte Menschheit beanspruchen (Menschenrechte, Frauen- und Kinderrechte, Inklusion, Bewahrung der Bio-Sphäre des Planeten u.a.). Der Vorwurf, es handele sich bei diesen Werten nur um eine westliche Tradition, ist nicht stichhaltig. Näher besehen haben sich die modernen Wertüberzeugungen ebenso gegen >Alteuropa< durchsetzen müssen, wie Gandhi sie über <Altindien< gestellt hat, als er die Sklaverei der Frauen und der Unberührbaren beenden wollte. Von allen Religionen und Kulturen ist daher der Verwandlungsschritt in Richtung Moderne gleichermaßen einzufordern. Dank des Mediums der Kunst (sprachliches Kunstwerk) lässt sich indirekt dartun, dass es keine entgegengesetzten moralischen Intuitionen bei den Menschen gibt, höchstens moralische Abgestumpftheit und Gleichgültigkeit bzw. Verzerrung der moralischen Urteilskraft durch Ideologien, religiöse Fundamentalismen und massive Eigeninteressen.
Der Vortrag versucht in seinem Beschluss, dasjenige zu bestimmen, was für die Menschen (alle Menschen) in kollektiver und individueller Hinsicht verbindlich ist. Die Frage nach der (letzten) Begründung, warum wir moralische Urteile fällen und normative Ansprüche erheben, wird dabei offen gelassen.
Inhaltsverzeichnis
- Über das Verbindliche in der Weltgesellschaft
- Weltgesellschaft
- Moderne und Weltgesellschaft
- Janusköpfigkeit der Moderne
- Moralische und existentielle Überzeugungen
- Beobachter-Perspektive
- Normatives Urteil
- Differenzen und Gemeinsamkeiten
- Vereinte Nationen (UNO)
- Kritik an der UNO
- Westliche Werte und Universalität
- Menschenrechte und westliche Selbstkritik
- Marx und die Kritik an den Menschenrechten
- Kulturell-religiöse Traditionen und Verbindlichkeit
- Französische Revolution und die Abschaffung der christlichen Religion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Möglichkeit eines für alle Menschen verbindlichen Wertesystems in der heutigen Weltgesellschaft. Er stellt zunächst die vielschichtigen Aspekte der Weltgesellschaft in Bezug auf Kommunikation, Kultur und Moderne dar, wobei die Janusköpfigkeit der Moderne mit ihrer gleichzeitigen Pluralität und Vereinheitlichung hervorgehoben wird.
- Das Zusammenspiel von kultureller Diversität und globalen Vernetzungen
- Die Suche nach verbindlichen Werten in einer Welt unterschiedlicher kultureller und religiöser Traditionen
- Die Rolle der Menschenrechte und ihre Kritikfähigkeit
- Die Bedeutung der Vereinten Nationen und ihre Herausforderungen
- Die Ambivalenz des Fortschritts und die Problematik der westlichen Dominanz
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der Definition des Begriffs „Weltgesellschaft“ im Sinne von Niklas Luhmann und beleuchtet die verschiedenen Facetten der modernen Weltgesellschaft, die durch eine zunehmende Vernetzung und Globalisierung gekennzeichnet ist. Es wird auf die Ambivalenz der Moderne hingewiesen, die sowohl Vielfalt als auch Vereinheitlichung hervorbringt.
Im Anschluss daran wird die Frage nach moralischen und existentiellen Überzeugungen in der Weltgesellschaft aufgeworfen. Dabei werden die Vereinten Nationen als ein Beispiel für die Suche nach gemeinsamen Werten und Zielen genannt, obwohl auch deren Grenzen und Kritikpunkte aufgezeigt werden.
Der Text beleuchtet anschließend die Geschichte der Menschenrechte und ihre ambivalente Entwicklung, wobei die Kritik von Karl Marx an der Freiheitsidee des Kapitalismus als ein wichtiges Beispiel angeführt wird. Die Diskussion führt zu der Frage, ob es in einer Welt unterschiedlicher kultureller und religiöser Traditionen überhaupt ein verbindliches Wertesystem für alle Menschen geben kann.
Schließlich wird der Fokus auf die Situation in der westlichen Welt gelegt und die Französische Revolution als Beispiel für die Abschaffung der christlichen Religion und die Einführung einer Vernunftreligion betrachtet. Der Text zeigt, wie unterschiedlich die Vorstellung von verbindlichen Werten in verschiedenen Kulturen und Religionen sein kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind Weltgesellschaft, Moderne, Verbindlichkeit, Werte, Kultur, Religion, Menschenrechte, Vereinte Nationen, Französische Revolution, Kritik, Pluralität, Universalität, Fortschritt, Selbstkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Niklas Luhmann unter "Weltgesellschaft"?
Die Weltgesellschaft ist durch globale Vernetzung gekennzeichnet, die einerseits Pluralität zulässt, andererseits eine Vereinheitlichung der Menschheit vollzieht.
Sind Menschenrechte nur ein westliches Konstrukt?
Der Text argumentiert, dass moderne Werte ebenso gegen "Alteuropa" erkämpft werden mussten und somit einen universellen Anspruch auf Normativität haben.
Welche Rolle spielt die UNO in der Weltgesellschaft?
In der Charta der Vereinten Nationen sind verbindliche Werte wie Frauen-, Kinder- und Menschenrechte formuliert, die für die gesamte Menschheit gelten sollen.
Warum ist moralische Abgestumpftheit ein Problem?
Der Autor postuliert, dass es keine entgegengesetzten moralischen Intuitionen gibt, sondern nur Verzerrungen durch Ideologien oder religiöse Fundamentalismen.
Was war die Kritik von Karl Marx an den Menschenrechten?
Marx kritisierte die Freiheitsidee des Kapitalismus und hinterfragte die bürgerlichen Menschenrechte im Kontext ökonomischer Abhängigkeiten.
- Quote paper
- Wilhelm Metz (Author), 2018, Über das Verbindliche in der Weltgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452224