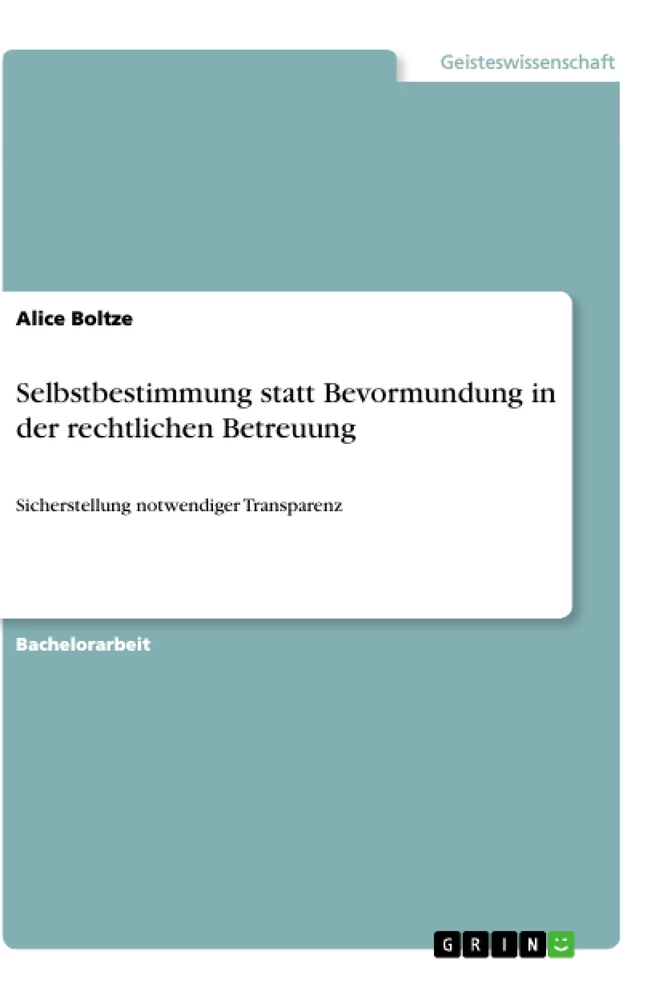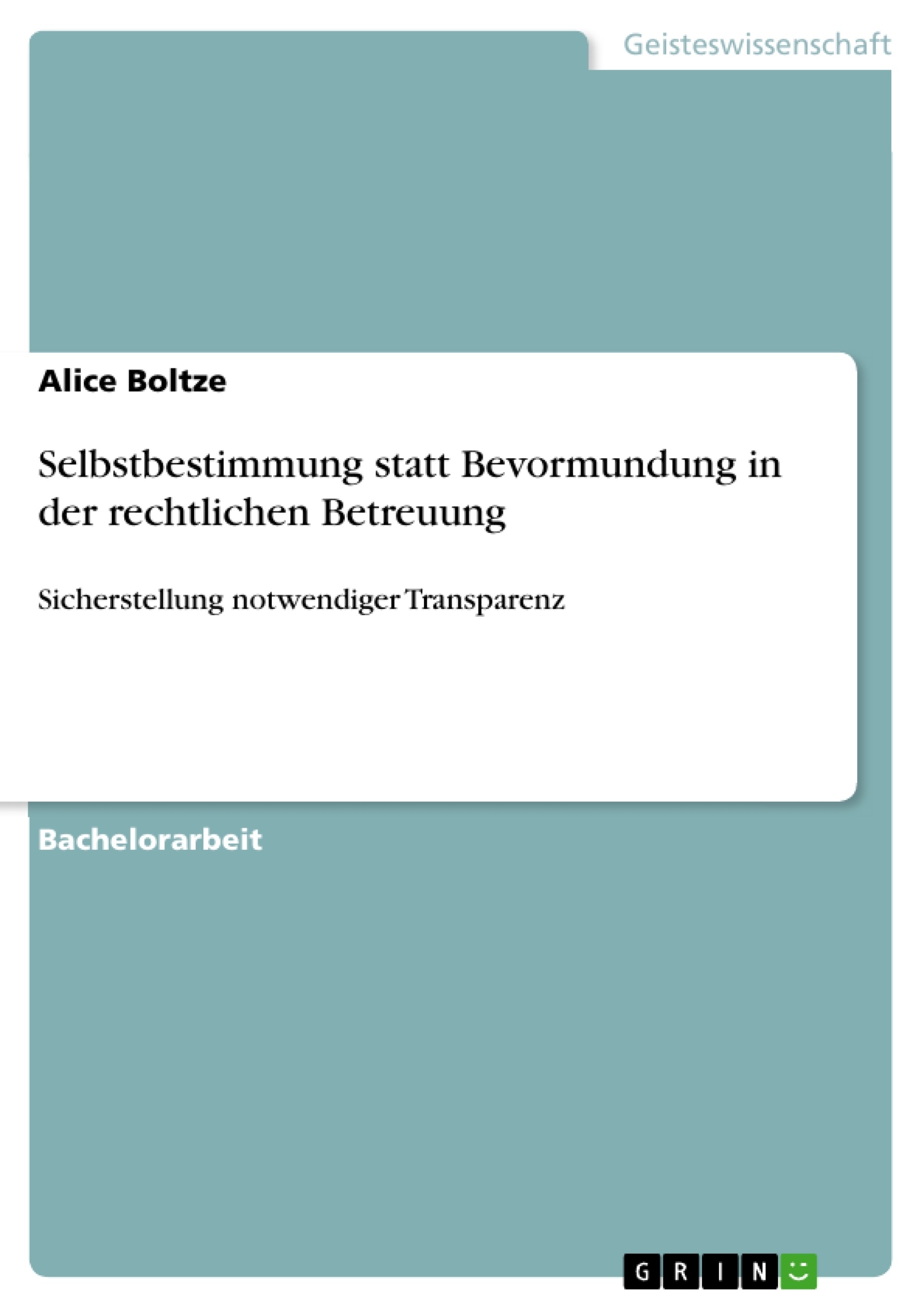Im Rahmen der deutschen Rechtsordnung ist erst einmal davon auszugehen, dass jeder Bürger in der Regel für sich selbstständig und eigenverantwortlich handelt, denn grundsätzlich ist das soziale sowie das gesellschaftliche Leben eines Menschen frei von gesetzlichen Reglementierungen und staatlichen Kontrollen.
Doch im Leben von älteren oder kranken Menschen können Situationen eintreten, in denen dann Hilfe durch andere benötigt wird, weil die Bewerkstelligung der eigenen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr möglich ist. Die Angelegenheiten können jedoch von Person zu Person variieren. Einerseits können es Angelegenheiten sein, bei denen Personen nicht mehr dazu in der Lage sind, sich selbst aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung mit Essen zu versorgen. Andererseits kann es Personen aufgrund von kognitiven Einschränkungen nicht mehr möglich sein, sich z.B. bei der Abwicklung eines oder mehrerer Rechtsgeschäfte darüber im Klaren zu sein, welche Auswirkungen und Konsequenzen diese Rechtsgeschäfte letztendlich für sie haben. Um diese Menschen dahingehend zu unterstützen, ihre Angelegenheiten wieder besser zu regeln, erfolgt eine Hilfe meist durch Familienangehörige oder bekannte Personen wie Verwandte, Freunde, Nachbarn oder auch Kollegen. Doch wenn Familienangehörige oder andere bekannte Personen diesen Unterstützungsbedarf aufgrund von unzureichenden Möglichkeiten oder Kompetenzen nicht leisten können, besteht die Option einer rechtlichen Betreuung. Die rechtliche Betreuung bezieht sich bei der Besorgung und Unterstützung des Hilfebedürftigen allerdings ausschließlich auf die rechtlichen Angelegenheiten der zu betreuenden Person. Der rechtliche Betreuer handelt sozusagen als gesetzlicher Stellvertreter für den Betreuten. Dieser soll in der Funktion als Stellvertreter des Betreuten stets zu dessen Wohl und unter der Wahrung seiner Selbstbestimmung im Rahmen der ihm zugetragenen Aufgaben durch das Betreuungsgericht handeln. Doch kann den Wünschen des Betreuten in vollem Umfang immer entsprochen werden, wenn dieser aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen frei zu bestimmen?
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. DAS RECHT AUF SELBSTBESTIMMUNG
- 2. Die Selbstbestimmung
- 2.1 Die Ursprünge des Gedankens nach selbstbestimmtem Leben
- 2.2 Die Selbstbestimmung als rechtlicher Begriff
- 2.3 Die Selbstbestimmung als soziologischer Begriff
- 3. Die Bevormundung
- 4. Zusammenfassung
- III. VERSTÄNDNISWEISEN DER RECHTLICHEN BETREUUNG
- 5. Die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Betreuungsrechts und deren Änderungen kraft Gesetzes
- 6. Die rechtliche Betreuung
- 6.1 Begriffsklärung
- 6.2 Die rechtliche Betreuung als interdisziplinäres Berufsfeld
- 6.3 Voraussetzung einer Betreuung im Allgemeinen
- 6.4 Der Grundsatz der Erforderlichkeit einer Betreuung
- 6.5 Die Anordnung einer Betreuung
- 6.5.1 Die Auswahl des Betreuers
- 6.6 Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen i.S.d. § 1906 BGB
- 6.7 Die Vorsorgevollmacht
- 6.8 Die Betreuungsverfügung
- IV. DEMOGRAFISCHER WANDEL UND RECHTLICHE BETREUUNG
- 7. Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die rechtliche Betreuung
- V. RECHTLICHE BETREUUNG VS. SELBSTBESTIMMUNG
- 8. Die rechtliche Betreuung im Spannungsfeld der Selbstbestimmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und rechtlicher Betreuung. Ziel ist es, die notwendigen Transparenzmaßnahmen im Betreuungsrecht zu beleuchten und zu analysieren, wie die Selbstbestimmung Betreuter besser gewährleistet werden kann.
- Das Recht auf Selbstbestimmung und seine rechtlichen und soziologischen Grundlagen
- Die rechtliche Betreuung und ihre historischen Entwicklung
- Die Herausforderungen der rechtlichen Betreuung im Kontext des demografischen Wandels
- Konflikte zwischen Selbstbestimmung und rechtlicher Betreuung
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Transparenz und Stärkung der Selbstbestimmung im Betreuungsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der rechtlichen Betreuung und deren Auswirkungen auf die Selbstbestimmung ein. Sie skizziert die Problematik der Bevormundung und die Notwendigkeit, Transparenz im Betreuungsrecht zu gewährleisten. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Sicherstellung notwendiger Transparenz im Kontext der rechtlichen Betreuung und deren Auswirkungen auf die Selbstbestimmung der Betroffenen vor.
II. Das Recht auf Selbstbestimmung: Dieses Kapitel behandelt das Recht auf Selbstbestimmung aus verschiedenen Perspektiven. Es erörtert die historischen Ursprünge des Gedankens der Selbstbestimmung, seine rechtliche Definition im Bürgerlichen Gesetzbuch und seine soziologische Relevanz. Im Gegensatz dazu wird der Begriff der Bevormundung beleuchtet und die potenziellen Konflikte mit der Selbstbestimmung herausgearbeitet. Die Zusammenfassung des Kapitels fasst die unterschiedlichen Perspektiven auf Selbstbestimmung zusammen und betont deren Bedeutung für ein würdevolles Leben.
III. Verständnisse der rechtlichen Betreuung: Dieses Kapitel befasst sich mit der rechtlichen Betreuung. Es beschreibt die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Betreuungsrechts und dessen Änderungen durch Gesetzgebung. Es wird die rechtliche Betreuung als interdisziplinäres Berufsfeld erläutert und die Voraussetzungen sowie die Anordnung einer Betreuung detailliert beschrieben. Die verschiedenen Aspekte der Betreuung, wie die Auswahl des Betreuers, Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen, sowie die Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung werden umfassend behandelt. Zusammenfassend wird das komplexe und vielschichtige System der rechtlichen Betreuung erläutert, mit seinen gesetzlichen Grundlagen und seinen praktischen Implikationen.
IV. Demografischer Wandel und rechtliche Betreuung: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die rechtliche Betreuung. Es untersucht, wie der steigende Anteil älterer Menschen und die Zunahme von Demenzerkrankungen die Nachfrage nach rechtlicher Betreuung beeinflussen und welche Herausforderungen dies für das System mit sich bringt. Die Kapitelzusammenfassung wird die zukünftigen Anforderungen an das Betreuungsrecht aufgrund des demografischen Wandels diskutieren.
V. Rechtliche Betreuung vs. Selbstbestimmung: Dieses Kapitel untersucht den zentralen Konflikt zwischen rechtlicher Betreuung und Selbstbestimmung. Es analysiert, wie die rechtliche Betreuung die Selbstbestimmung von Betroffenen einschränken kann und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um dieses Spannungsfeld zu bewältigen. Die Zusammenfassung des Kapitels wird die wichtigsten Konflikte zwischen beiden Konzepten aufzeigen und mögliche Lösungsansätze diskutieren.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmung, rechtliche Betreuung, Bevormundung, Transparenz, Betreuungsrecht, demografischer Wandel, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, §1906 BGB, Würde, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Selbstbestimmung vs. Rechtliche Betreuung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und rechtlicher Betreuung. Sie analysiert die notwendigen Transparenzmaßnahmen im Betreuungsrecht und Wege zur besseren Gewährleistung der Selbstbestimmung Betreuter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Recht auf Selbstbestimmung (rechtliche und soziologische Grundlagen), die rechtliche Betreuung (historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen), den Einfluss des demografischen Wandels auf die rechtliche Betreuung, Konflikte zwischen Selbstbestimmung und rechtlicher Betreuung sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der Transparenz und Stärkung der Selbstbestimmung im Betreuungsrecht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Recht auf Selbstbestimmung, Verständnisse der rechtlichen Betreuung, Demografischer Wandel und rechtliche Betreuung, sowie Rechtliche Betreuung vs. Selbstbestimmung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Was wird im Kapitel "Das Recht auf Selbstbestimmung" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet das Recht auf Selbstbestimmung aus historischen, rechtlichen (Bürgerliches Gesetzbuch) und soziologischen Perspektiven. Es setzt sich mit dem Begriff der Bevormundung auseinander und zeigt potenzielle Konflikte mit der Selbstbestimmung auf.
Was wird im Kapitel "Verständnisse der rechtlichen Betreuung" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Betreuungsrechts, die rechtliche Betreuung als interdisziplinäres Berufsfeld, die Voraussetzungen und die Anordnung einer Betreuung. Es behandelt Aspekte wie die Betreuerwahl, Unterbringung, freiheitsentziehende Maßnahmen (§ 1906 BGB), Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.
Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die rechtliche Betreuung aus?
Das Kapitel "Demografischer Wandel und rechtliche Betreuung" analysiert den Einfluss des steigenden Anteils älterer Menschen und der Zunahme von Demenzerkrankungen auf die Nachfrage nach rechtlicher Betreuung und die damit verbundenen Herausforderungen für das System.
Wie werden Konflikte zwischen Selbstbestimmung und rechtlicher Betreuung behandelt?
Das letzte Kapitel untersucht den zentralen Konflikt zwischen rechtlicher Betreuung und Selbstbestimmung. Es analysiert, wie die rechtliche Betreuung die Selbstbestimmung einschränken kann und welche Maßnahmen zur Bewältigung dieses Spannungsfelds ergriffen werden können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstbestimmung, rechtliche Betreuung, Bevormundung, Transparenz, Betreuungsrecht, demografischer Wandel, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, §1906 BGB, Würde, Menschenrechte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die notwendigen Transparenzmaßnahmen im Betreuungsrecht zu beleuchten und zu analysieren, wie die Selbstbestimmung Betreuter besser gewährleistet werden kann.
- Citar trabajo
- Alice Boltze (Autor), 2018, Selbstbestimmung statt Bevormundung in der rechtlichen Betreuung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464391