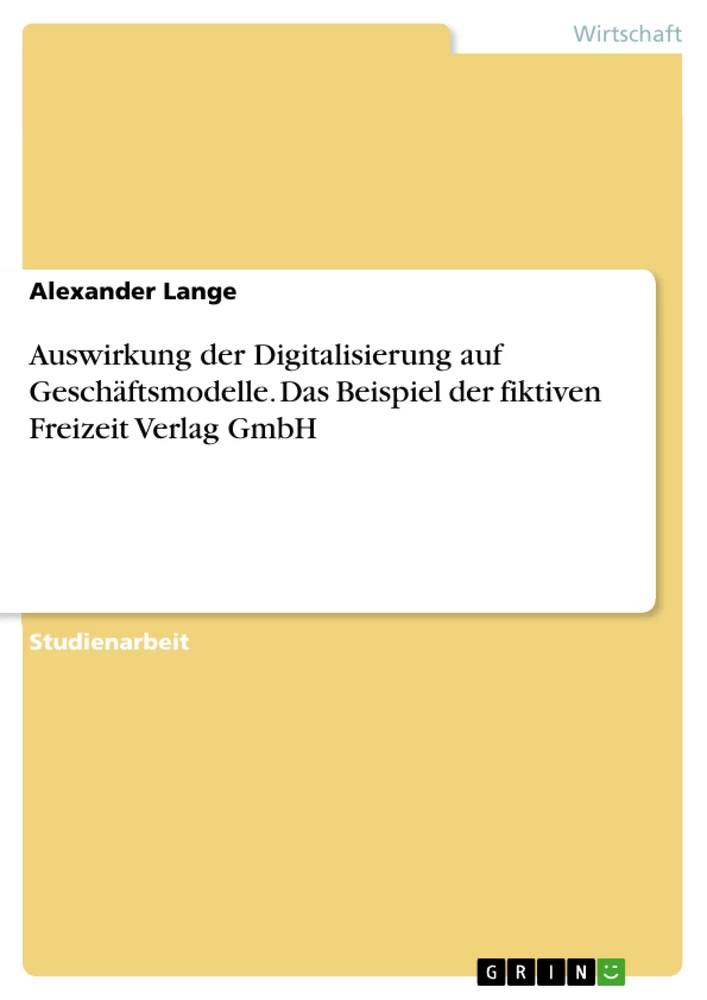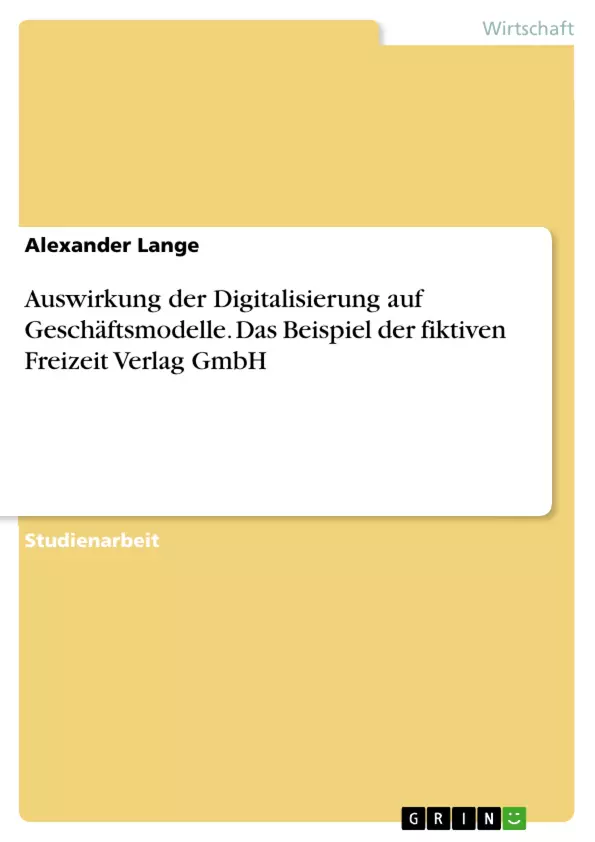Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf das wirtschaftliche Handeln, die bestehenden Geschäftsmodelle sowie die Marktpositionierungen. Am fiktiven Beispiel eines Unternehmens aus der Verlagsbranche erläutert sie, wie der Begriff des Geschäftsmodells in Form des sogenannten "Business Model Canvas" für diese Organisation angewandt werden kann. Darauf aufbauend werden Hypothesen zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf das bestehende Geschäftsmodell des Unternehmens entwickelt, wobei diejenigen im Vordergrund stehen sollen, die die vermeintlich größten Veränderungen hervorrufen könnten. Abschließend wird auf der Basis einer Theorie zur Entstehung von Wettbewerbsvorteilen untersucht, ob von einer essentiellen Bedrohung des Geschäftsmodells des Unternehmens durch die Digitalisierung auszugehen ist.
Die Digitalisierung gehört, neben Themen wie der Globalisierung, dem Demographischen Wandel oder der Urbanisierung, zu den prägenden Megatrends unseres Zeitalters. Betrachtet man allein die Entwicklung der weltweiten Internetnutzer zwischen 2016 und 2021, so wird deutlich, welches Tempo der Megatrend Digitalisierung in diesem Bereich innehat. Waren laut eMarketer (2017) im Jahre 2016 erst etwa 44,6 % (ca. 3,26 Mrd. Menschen) der Weltbevölkerung online, so werden es im Jahr 2021 bereits 53,7 % (ca. 4,14 Mrd. Menschen) sein (Prognose) - mehr als die Hälfte der weltweiten Population.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau und Gliederung der Arbeit
- 2 Wichtige Begriffe, Modelle und Theorien in der digitalen Ökonomie
- 2.1 Der Begriff Geschäftsmodell
- 2.2 Das Geschäftsmodell im Business Model Canvas
- 2.3 Der Begriff Digitalisierung
- 2.4 Grundsätzlich mögliche Auswirkungen der Digitalisierung auf bestehende Geschäftsmodelle
- 2.5 Der Begriff Wettbewerbsvorteil
- 2.6 Drei Theorien zur Entstehung von Wettbewerbsvorteilen
- 2.6.1 Die Positionierungsschule
- 2.6.2 Die Ressourcen-, Fähigkeiten- und Wissenorientierung
- 2.6.3 Die Transaktionskostentheorie
- 3 Die Freizeit Verlag GmbH unter dem Einfluss der Digitalisierung
- 3.1 Das bisherige Geschäftsmodell der FVG im BMC
- 3.2 Fünf Hypothesen zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Geschäftsmodell der FVG
- 3.3 Ist das Geschäftsmodell der FVG essentiell bedroht?
- 4 Kritische Diskussion
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf ein fiktives Unternehmen aus der Verlagsbranche, die Freizeit Verlag GmbH (FVG). Sie zeigt auf, wie der Begriff des Geschäftsmodells im Business Model Canvas (BMC) angewendet werden kann, um die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Unternehmen zu analysieren.
- Anwendung des Business Model Canvas zur Analyse des Geschäftsmodells der FVG
- Identifizierung von fünf Hypothesen zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Geschäftsmodell der FVG
- Bewertung der möglichen Bedrohung des Geschäftsmodells der FVG durch die Digitalisierung
- Diskussion der kritischen Aspekte der Digitalisierung für das Unternehmen
- Abschließende Betrachtung der Chancen und Herausforderungen, die sich für die FVG durch die Digitalisierung ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Digitalisierung als Megatrend hervorhebt und die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit definiert.
Kapitel 2 legt wichtige Begriffe, Modelle und Theorien der digitalen Ökonomie dar. Dabei werden der Begriff des Geschäftsmodells, der Business Model Canvas, die Digitalisierung, Wettbewerbsvorteile und drei Theorien zur Entstehung von Wettbewerbsvorteilen erläutert.
Kapitel 3 widmet sich der Freizeit Verlag GmbH und untersucht das bisherige Geschäftsmodell im BMC. Es werden fünf Hypothesen zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Geschäftsmodell der FVG formuliert und die Frage diskutiert, ob das Geschäftsmodell der FVG durch die Digitalisierung essentiell bedroht ist.
Kapitel 4 bietet eine kritische Diskussion der Ergebnisse der Arbeit und schließlich liefert Kapitel 5 ein Fazit sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Digitalisierung, Geschäftsmodell, Business Model Canvas, Freizeit Verlag GmbH, Wettbewerbsvorteile, Auswirkungen der Digitalisierung, Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Welches fiktive Beispiel wird zur Analyse der Digitalisierung genutzt?
Die Arbeit nutzt die fiktive "Freizeit Verlag GmbH" (FVG), um die Auswirkungen der Digitalisierung auf ein klassisches Verlagsmodell zu untersuchen.
Was ist der "Business Model Canvas" (BMC)?
Der BMC ist ein strategisches Management-Tool, mit dem Geschäftsmodelle visualisiert, analysiert und auf ihre Zukunftsfähigkeit hin geprüft werden können.
Welche Hypothesen werden zur Digitalisierung im Verlagswesen aufgestellt?
Es werden fünf Hypothesen entwickelt, die die gravierendsten Veränderungen durch digitale Kanäle, verändertes Nutzerverhalten und neue Wettbewerber beschreiben.
Ist das Geschäftsmodell klassischer Verlage essentiell bedroht?
Die Arbeit bewertet dies auf Basis von Wettbewerbstheorien und untersucht, ob bestehende Ressourcen und Marktpositionen ausreichen, um gegen digitale Disruption zu bestehen.
Welche Rolle spielt die Transaktionskostentheorie in dieser Arbeit?
Sie dient als eine von drei Theorien zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen und analysiert, wie Digitalisierung Kostenstrukturen im Austausch mit Kunden beeinflusst.
Warum wird Digitalisierung als "Megatrend" bezeichnet?
Weil sie neben Globalisierung und demographischem Wandel die gesamte Weltbevölkerung und Wirtschaft nachhaltig und in hohem Tempo verändert.
- Quote paper
- Alexander Lange (Author), 2019, Auswirkung der Digitalisierung auf Geschäftsmodelle. Das Beispiel der fiktiven Freizeit Verlag GmbH, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498088