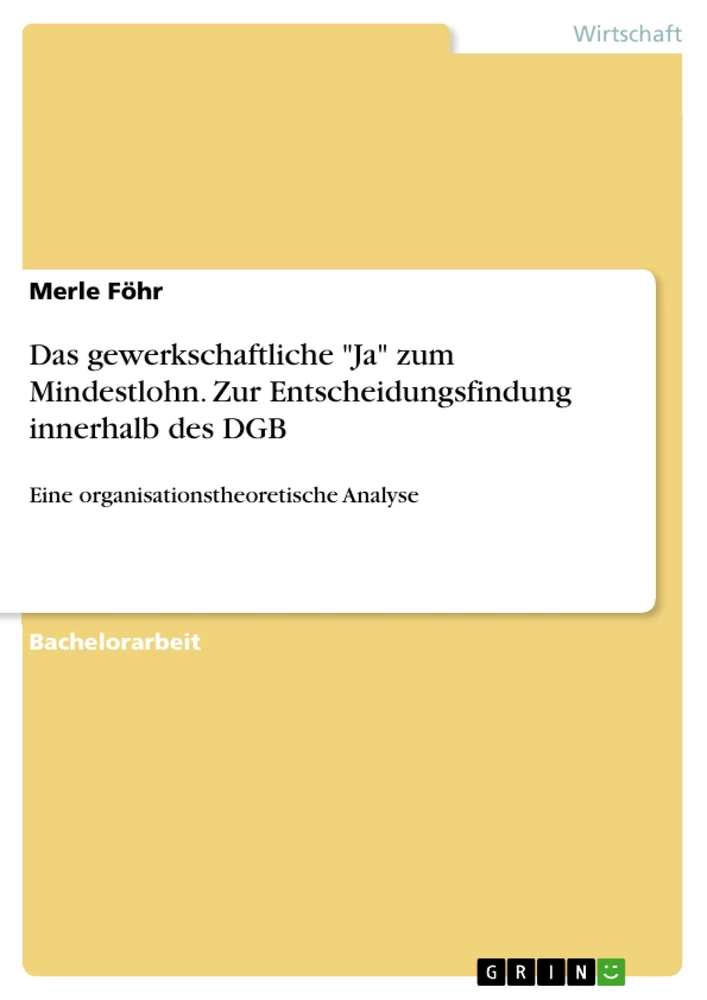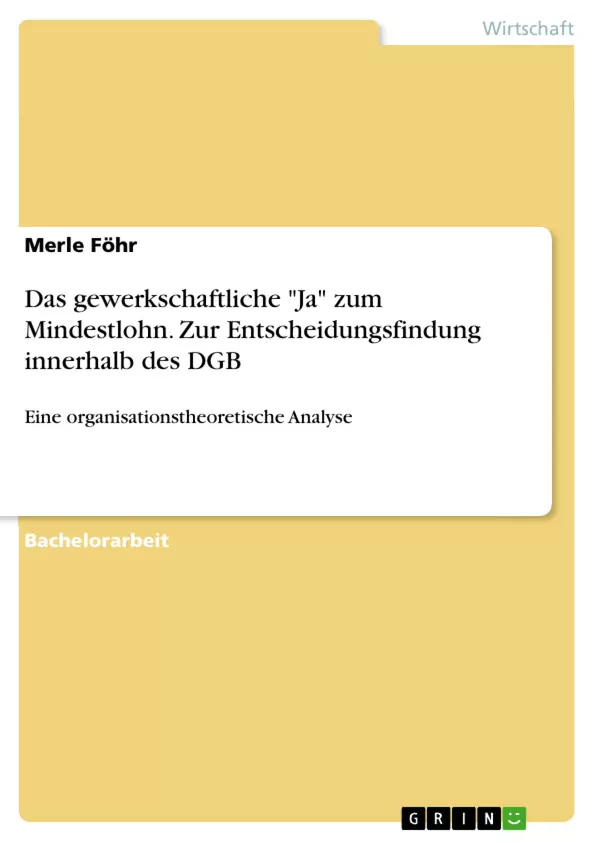Die handlungsleitenden Fragen für die vorliegende Untersuchung sind demnach:
Welche Rahmenbedingungen beeinflussten die jeweilige Haltung der beiden Lager?
Wie konnten die innergewerkschaftlichen Kontroversen zumindest so weit aufgelöst werden, dass eine verbandsweit getragene Forderung nach einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn aufgestellt werden konnte?
Im Januar 2019 jährt sich die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland zum vierten Mal. In den langwierigen und kontroversen Diskussionen im Vorfeld dieser Einführung wurde oft auf die 1918 im Stinnes-Legien-Abkommen festgeschriebeneTarifautonomie Bezug genommen und sie war wohl das am häufigsten bemühte Argument. Interessanterweise diente dieses Argument beiden Lagern: Während seine Befürworter in einem gesetzlichen Mindestlohn eine Stärkung der Tarifautonomie sahen, stellte er für seine Gegner einen eklatanten, nicht hinzunehmenden staatlichen Eingriff in das Tarifsystem dar, der das Prinzip der Tarifautonomie gänzlich unterlaufe. Diese unterschiedliche Lesart war unter anderem verantwortlich für eine etwa ein Jahrzehnt andauernde innergewerkschaftliche Debatte , die erst 2006 auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit dem Beschluss, einen gesetzlichen Mindestlohn zu fordern, eine verbandsweit gemeinsame Richtung einschlug und in die 2007 begonnene Mindestlohn-Kampagne des DGB mündete.
Bei der innergewerkschaftlichen Debatte zeichneten sich schnell zwei Lager ab: Dienstleistungs- vs. Industriegewerkschaften, wobei die Dienstleistungsgewerkschaften (Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)) als Befürworter und die Industriegewerkschaften (IG Metall und IG BCE) als Gegner eines gesetzlichen Mindestlohnes auftraten. Doch wie kam es dann zu dem Beschluss, einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland zu fordern?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung des deutschen Modells der Industriellen Beziehungen
- Konzeptioneller Rahmen
- Die Arena ,,Tarifautonomie\" und ihre Akteure
- Instrumente der Arbeitsmarktpolitik
- Entwicklung der Rahmenbedingungen des deutschen Tarifsystems
- Arbeitsmarkt: Erosion des Flächentarifvertragssystems / Ausweitung des Niedriglohnsektors
- Wissenschaft: Allgemeiner Mindestlohn als probates Mittel gegen,,Armut trotz Arbeit“
- Gesellschaft: Steigende plebiszitäre Zustimmung
- Politik: Handlungsdruck aufgrund der negativen Arbeitsmarktentwicklung seit der deutschen Wiedervereinigung 1990
- Organisation: Sinkende Organisationsstärke der Einzelgewerkschaften
- Wie reagieren die gewerkschaftlichen Akteure auf die veränderten sozioökonomischen Einflussfaktoren?
- Dienstleistungsgewerkschaften
- Positionsentwicklung der NGG
- Positionsentwicklung von ver.di
- Industriegewerkschaften
- Positionsentwicklung der IG Metall
- Positionsentwicklung der IG BCE
- Der DGB auf dem Weg zum gesetzlichen Mindestlohn
- Der DGB-Bundeskongress 2002
- Die,, Initiative Mindestlohn“
- Der DGB-Bundeskongress 2006
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entscheidungsfindung innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hinsichtlich der Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn. Sie untersucht die verschiedenen Positionen der einzelnen Gewerkschaften, insbesondere der Dienstleistungs- und Industriegewerkschaften, sowie die Faktoren, die zu der letztendlichen Zustimmung des DGB zum gesetzlichen Mindestlohn geführt haben.
- Einfluss von Niedriglohnsektoren und Tariferosion auf die Positionen der Gewerkschaften
- Die Rolle der Tarifautonomie im Kontext der Mindestlohndebatte
- Die Entwicklung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen des deutschen Tarifsystems
- Der Einfluss politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf die innergewerkschaftliche Debatte
- Die Bedeutung der Organisationsstärke der Gewerkschaften im Prozess der Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Entwicklung der deutschen Industriellen Beziehungen und die Bedeutung der Tarifautonomie dar. Sie führt die Forschungsfrage ein, wie die innergewerkschaftliche Debatte zum Mindestlohn innerhalb des DGB geführt wurde und welche Rahmenbedingungen diese Debatte beeinflusst haben.
Kapitel 2 analysiert die Veränderungen des deutschen Tarifsystems, insbesondere die Ausweitung des Niedriglohnsektors und die Erosion des Flächentarifvertragssystems. Es untersucht die wissenschaftlichen Argumente für einen gesetzlichen Mindestlohn sowie die gesellschaftliche und politische Stimmung zu dieser Frage.
Kapitel 3 untersucht die Reaktionen der gewerkschaftlichen Akteure, insbesondere der Dienstleistungs- und Industriegewerkschaften, auf die veränderten sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Die Positionsentwicklungen der einzelnen Gewerkschaften werden im Detail betrachtet und die Hypothese, dass Dienstleistungsgewerkschaften aufgrund ihrer stärkeren Betroffenheit von Niedriglohnsektoren für einen gesetzlichen Mindestlohn waren, überprüft.
Kapitel 4 zeichnet den Weg des DGB zur Forderung eines gesetzlichen Mindestlohnes nach, indem es die Entwicklung der Positionen des DGB in den 2000er Jahren beleuchtet. Die innergewerkschaftlichen Konflikte und deren Auflösung im Laufe der Debatte werden untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themengebiete Tarifautonomie, Mindestlohn, Industrielle Beziehungen, Gewerkschaften, Dienstleistungsgewerkschaften, Industriegewerkschaften, DGB, Niedriglohnsektor, Tariferosion und Arbeitsmarktpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum war der Mindestlohn innerhalb des DGB so lange umstritten?
Es gab einen Konflikt zwischen Dienstleistungsgewerkschaften (Befürworter) und Industriegewerkschaften (Gegner). Letztere fürchteten einen staatlichen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Tarifautonomie.
Welche Gewerkschaften trieben die Forderung nach einem Mindestlohn voran?
Vor allem die NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten) und ver.di setzten sich früh dafür ein, da ihre Branchen besonders stark von Tariferosion und Niedriglöhnen betroffen waren.
Wann kam es zur endgültigen Entscheidung des DGB für den Mindestlohn?
Der Durchbruch gelang auf dem DGB-Bundeskongress 2006, wo eine gemeinsame Richtung beschlossen wurde, die 2007 in eine bundesweite Kampagne mündete.
Welche Rolle spielte das Stinnes-Legien-Abkommen von 1918?
Dieses Abkommen legte den Grundstein für die Tarifautonomie in Deutschland. In der Debatte diente es beiden Seiten als Argument für oder gegen staatliche Lohnuntergrenzen.
Wie beeinflusste der Niedriglohnsektor die gewerkschaftliche Haltung?
Die Ausweitung des Niedriglohnsektors und die schwindende Bindungskraft von Flächentarifverträgen erhöhten den Druck auf die Gewerkschaften, staatliche Hilfe zur Sicherung des Existenzminimums zu akzeptieren.
- Quote paper
- Merle Föhr (Author), 2018, Das gewerkschaftliche "Ja" zum Mindestlohn. Zur Entscheidungsfindung innerhalb des DGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501308