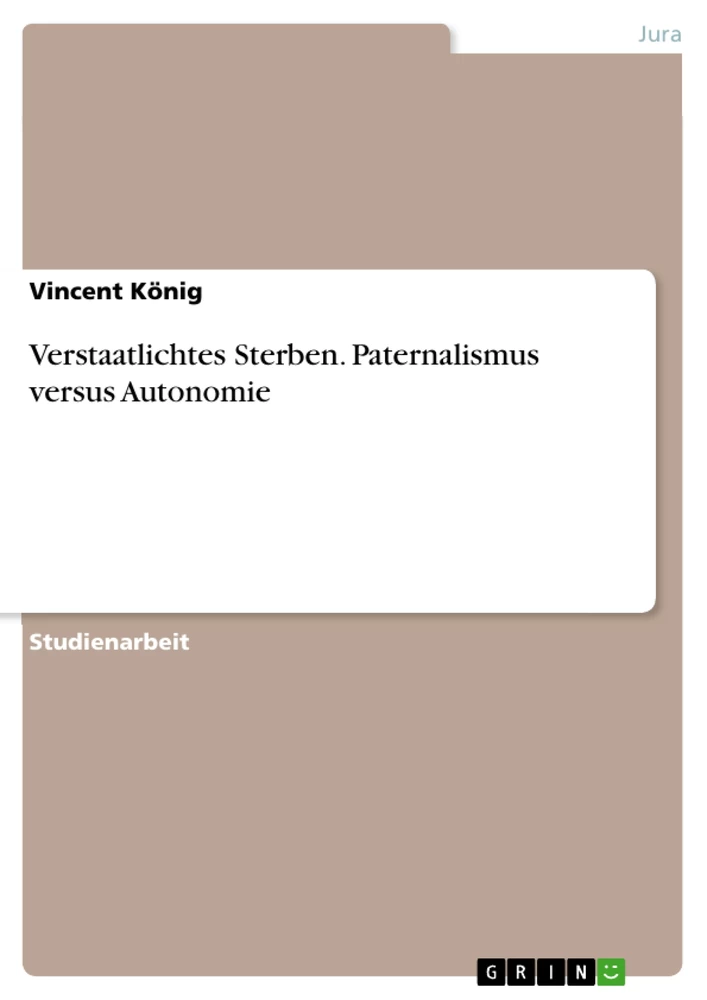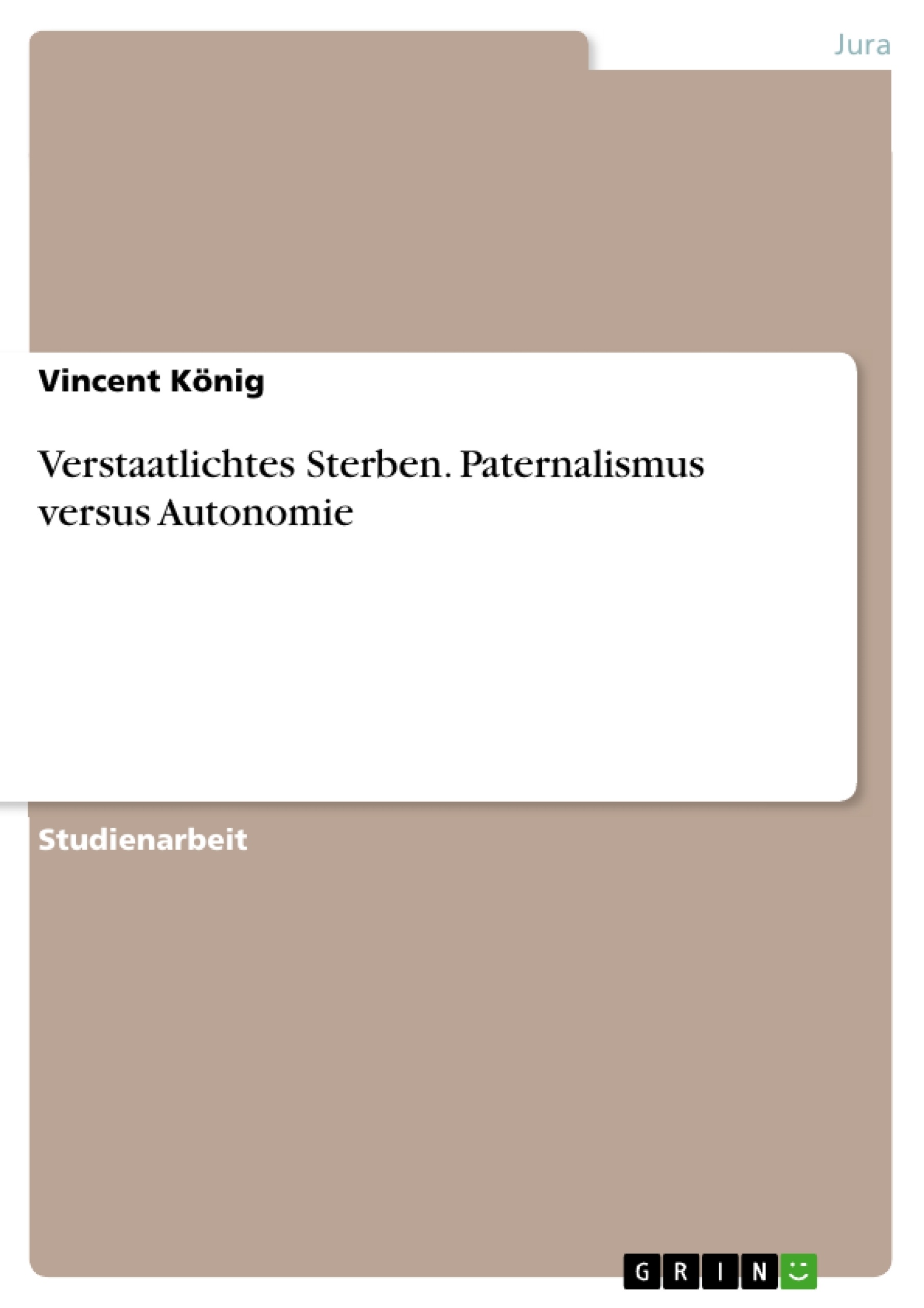In diesem Beitrag geht es um die Frage, ob der Staat aus rechtsphilosophischer Sicht Bestimmungen zum Sterben treffen und somit in die höchstpersönliche Sphäre der Entscheidung über den eigenen Tod eingreifen darf. Das in § 216 StGB normierte Verbot der aktiven Sterbehilfe als Verstaatlichung des Sterbens im Sinne eines An-sich-ziehens der Entscheidungskompetenz ist dabei Anknüpfungspunkt der Überlegungen an die real existierende Rechtsordnung.
Primäres Ziel der modernen Rechtsordnung ist es, dem Menschen die freie Entfaltung zu ermöglichen. Hierbei steht die staatliche Schutzpflicht im Spannungsfeld von Paternalismus und Autonomie: Wie gewährleistet der Staat einerseits die Autonomie des Einzelnen, wird aber seinem Auftrag als oberster Schutzherr gerecht? Der Schutz des Menschen vor sich selbst als mögliche Aufgabe des modernen Rechtsstaates ist heftigen Diskussionen ausgesetzt, welche auf moraltheoretische und staatstheoretische Grundlagen zurückführen; eine Erörterung zu Paternalismus muss also einen solchen Ausgangspunkt haben. Daher wird im ersten Teil der Arbeit anhand des konsequentialistischen Konzepts John Stuart Mills ein Antipaternalismus skizziert und anschließend soll deontologische Ansatz Kants ausgeleuchtet werden.
Im zweiten Abschnitt setzt sich diese Arbeit mit dem sogenannten weichen Paternalismus auseinander, einem aktuellen Ansatz, der zwischen staatlicher Schutzpflicht und Selbstbestimmg des Individuums vermitteln will. Dabei interessieren insbesondere die Schwächen des Menschen bei der Bildung eines autonomen Willens (Stichwort bounded rationality) sowie aktuelle neurophilosophische Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- A. Sterben zwischen Paternalismus und Autonomie
- B. Antipaternalismus und Wahrung der Autonomie
- I. Die Begründung eines Antipaternalismus
- 1. Paternalismuskritik aus konsequentialistischer Sicht
- (a) Nichtmillsche Ansätze
- aa) Kommunitaristische Theorien
- bb) Paternalismus als Scheinproblem
- cc) Radikaler Utilitarismus gegen sich selbst
- dd) Zusammenfassung
- (b) Millscher Konsequentialismus
- aa) Der Mensch als bester Verwalter seiner selbst
- bb) Exzentriker für den Fortschritt
- cc) Die Kosten des Lebens
- (c) Maximierung der Freiheit als utilitaristisches Ziel
- (d) Ein moderner konsequentialistischer Ansatz
- (e) Fazit: Konsequentialismus und Antipaternalismus
- 2. Deontologischer Antipaternalismus
- II. Bedeutung und Grenzen der Selbstverfügungsfreiheit
- 1. Einführung in den weichen Paternalismus
- 2. Autonomie und Ihre Grenzen
- 3. Eine Anmerkung zur Existenz weichen Paternalismus
- 4. Modelle des weichen Paternalismus
- (a) Die Pflicht gegen sich selbst
- (b) Die self- sovereignity
- (c) Die,,bounded rationality”
- (d) Die Möglichkeit der defizitären Entscheidung
- (e) Die hypothetische Zustimmung des rational Handelnden
- (f) Die Autonomie als Schwellenkonzept
- 5. Fazit zu II: Kritik am weichen Paternalismus
- C. Conlusio: Anti- Antipaternalismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Staat in die höchstpersönliche Entscheidung des Einzelnen über den eigenen Tod eingreifen darf, insbesondere im Hinblick auf das Verbot der aktiven Sterbehilfe in § 216 StGB. Die Arbeit beleuchtet die Spannungen zwischen staatlicher Paternalismus und dem Recht auf Autonomie des Einzelnen, indem sie verschiedene moralphilosophische und rechtsphilosophische Ansätze untersucht.
- Paternalismus und Autonomie im Kontext des Sterbens
- Kritik am Paternalismus aus konsequentialistischer und deontologischer Perspektive
- Der "weiche Paternalismus" und seine Grenzen
- Die Rolle der Selbstverfügungsfreiheit in Bezug auf Entscheidungen über den eigenen Tod
- Kompatibilität der Argumentation mit der bestehenden Rechtsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Problematik des staatlichen Eingriffs in die Entscheidung des Einzelnen über den eigenen Tod im Kontext von Paternalismus und Autonomie beleuchtet. Dabei wird auf die aktuelle Rechtsordnung in Deutschland und das Verbot der aktiven Sterbehilfe in § 216 StGB eingegangen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit der Staat in die höchstpersönliche Sphäre der Entscheidung über den eigenen Tod eingreifen darf.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Kritik am Paternalismus aus konsequentialistischer und deontologischer Sicht. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Ansätze, die die Idee des Individuums als autonomes Wesen mit eigenem Entscheidungsspielraum unterstützen. Insbesondere wird der "harm-principle" von John Stuart Mill diskutiert, der argumentiert, dass staatliche Eingriffe nur zum Schutz anderer vor Schaden gerechtfertigt sind.
Im dritten Kapitel wird der "weiche Paternalismus" vorgestellt, ein Ansatz, der zwischen staatlicher Schutzpflicht und der Selbstbestimmung des Individuums zu vermitteln versucht. Die Arbeit analysiert die Schwächen des Menschen bei der Bildung eines autonomen Willens, insbesondere im Kontext der "bounded rationality", und untersucht aktuelle neurophilosophische Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Paternalismus, Autonomie, Sterbehilfe, § 216 StGB, konsequentialistische Philosophie, deontologische Philosophie, John Stuart Mill, "harm-principle", weicher Paternalismus, Selbstverfügungsfreiheit, bounded rationality.
Häufig gestellte Fragen
Darf der Staat das Sterben reglementieren?
Die Arbeit untersucht dieses Spannungsfeld zwischen der staatlichen Schutzpflicht und dem Recht des Einzelnen auf eine autonome Entscheidung über den eigenen Tod.
Was besagt § 216 StGB?
Dieser Paragraph regelt das Verbot der Tötung auf Verlangen, was oft als Ausdruck staatlichen Paternalismus kritisiert wird, da er die Entscheidungskompetenz über das Sterben an den Staat zieht.
Was versteht man unter "weichem Paternalismus"?
Ein Ansatz, der staatliche Eingriffe rechtfertigt, wenn die Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen eingeschränkt ist (z.B. durch mangelnde Information oder irrationale Impulse), um dessen eigentliche Autonomie zu schützen.
Wie argumentierte John Stuart Mill gegen Paternalismus?
Mill vertrat das "Schadensprinzip", wonach der Staat nur dann in die Freiheit eines Einzelnen eingreifen darf, wenn dieser anderen Schaden zufügt, nicht aber um ihn vor sich selbst zu schützen.
Was bedeutet "bounded rationality" in diesem Kontext?
Es beschreibt die begrenzte Rationalität des Menschen bei komplexen Entscheidungen, die als Argument für schützende staatliche Regelungen im Bereich der Sterbehilfe herangezogen wird.
- Quote paper
- Vincent König (Author), 2019, Verstaatlichtes Sterben. Paternalismus versus Autonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501518