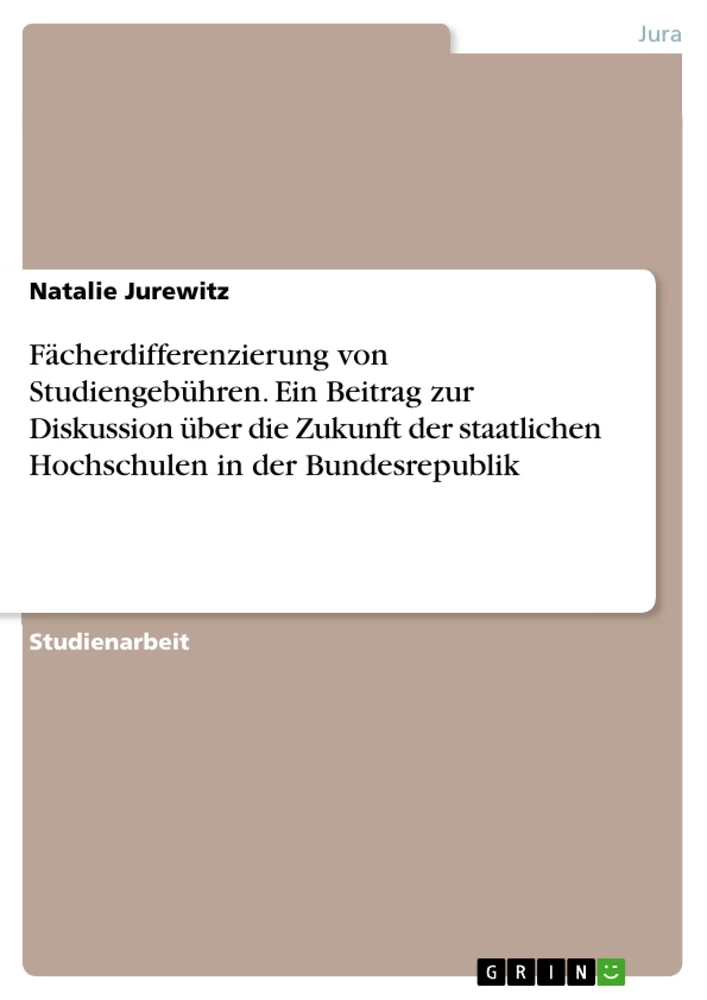Einleitung
Die öffentliche Auseinandersetzung über die Leistungsfähigkeit des deutschen Hochschulwesens wird von der Überzeugung getragen, dass gerade der Qualität und der Zukunftsfähigkeit akademischer Ausbildungseinrichtungen eine Indikatorfunktion für die Innovationskraft von Staat und Gesellschaft im Allgemeinen zukomme1. Wie auch im Rahmen des – originär politischen – Ringens um Konzepte, die das Gemeinwesen den Anforderungen einer globalisierten Welt gemäß umzugestalten vermögen, Finanzierungsgerechtigkeit zum Leitmotiv erhoben wird, so wird auch mit den Überlegungen in elf Bundesländern2 über eine mögliche Einführung von Studiengebühren die Forderung nach einer gerechten Verteilung der Finanzierungslast verknüpft. Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen3, der nach der zustimmenden Kenntnisnahme des nordrhein-westfälischen Regierungskabinetts am 6. September 2005 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, offenbart jedenfalls seinem Titel nach, dass sich auch die nordrhein-westfälische Landesregierung – im Rahmen der bislang jüngsten Initiative unter den Bundesländern in Sachen Studiengebühren - diesem Leitprinzip verpflichtet fühlte.
Die Vorschrift des Art. 2 4§ 2 I HFGG impliziert in ihrer Begründung5 die Möglichkeit, dass die jeweilige Hochschule für verschiedene Studiengänge unterschiedlich hohe sog. „Studienbeiträge“ festsetzt....
---
1 Vgl. Einleitung und Problemerörterung (S.1) sowie Begründung zum Allgemeinen Teil im Referentenentwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen in Nordrhein-Westfalen (S. 21).
2 In sieben Bundesländern bestehen bereits konkrete Pläne zur Einführung von Studiengebühren, in vier Bundesländern wird zunächst die Entwicklung in den anderen Ländern verfolgt bzw. die Rechtslage noch überprüft. Vgl. http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/berufstudium/special (Stand: 30.10.2005).
3 Im Folgenden wird das Gesetz – der Nomenklatur des Entwurfes entsprechend - als HFGG abgekürzt. Vorgesehen ist das Inkrafttreten für den 1. April 2006. Vgl. Art. 4 HFGG, S. 20.
4 Die Vorschrift impliziert das sog. Gesetz zur Erhebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben, im folgenden als StBAG abgekürzt. Das HFGG umfasst unter Art. 1 auch das Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Einführung von Studienkonten und zur Erhebung von Hochschulgebühren (Abkürzung: StKFG-AufhG).
5 Vgl. HFGG, S. 26.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Fächerdifferenzierung von Studiengebühren im Lichte des Verfassungsrechts
- Fächerdifferenzierte Gebührenerhebung als Element hochschulischer Selbstverwaltung
- Die verfassungsrechtliche Vorgabe des Art. 3 I GG
- Die Fächerdifferenzierung von Studiengebühren im Lichte der nationalökonomischen Betrachtung
- Der Kostenaspekt
- Kosten für die öffentliche Hand
- Kosten für die Studierenden
- Der Renditeaspekt
- Persönliche Einkommensaussichten der Studierenden
- Bildungsrendite zugunsten der Volkswirtschaft
- Präferenzen für bestimmte Studienfächer als Nachfrageindikator
- Lenkungswirkung von Studiengebühren im wirtschaftswissenschaftlichen Modell
- Preisbildung auf dem Markt für Hochschulbildung
- Modellkritik: Prämissen und Reichweite
- Der Kostenaspekt
- Beispiele aus der Praxis
- Private Universität Witten/Herdecke
- Australien
- Auswirkungen auf die Hochschule als soziales System
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Fächerdifferenzierung von Studiengebühren, einer viel diskutierten Reformmaßnahme im deutschen Hochschulwesen. Sie analysiert die rechtlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Implikationen dieser Idee, die im Kontext der Debatte um die Zukunft der Finanzierung staatlicher Hochschulen in Deutschland eine zentrale Rolle spielt.
- Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Fächerdifferenzierung von Studiengebühren
- Ökonomische Aspekte der Fächerdifferenzierung, einschließlich Kostenaspekte, Renditeaspekte und Lenkungswirkungen
- Beispiele aus der Praxis, wie die Private Universität Witten/Herdecke und Australien
- Auswirkungen der Fächerdifferenzierung von Studiengebühren auf die Hochschule als soziales System
- Zusammenhang zwischen der Fächerdifferenzierung und der Forderung nach einer gerechten Verteilung der Finanzierungslast
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Diskussion über die Leistungsfähigkeit des deutschen Hochschulwesens und die wachsende Bedeutung der Finanzierungsgerechtigkeit. Das zweite Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen der Fächerdifferenzierung von Studiengebühren, insbesondere im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das dritte Kapitel befasst sich mit den ökonomischen Aspekten der Fächerdifferenzierung, wobei insbesondere Kosten, Rendite und Lenkungswirkungen untersucht werden. Das vierte Kapitel präsentiert Beispiele aus der Praxis, die die Anwendung der Fächerdifferenzierung in der privaten Universität Witten/Herdecke und in Australien beleuchten. Das fünfte Kapitel untersucht die Auswirkungen der Fächerdifferenzierung auf die Hochschule als soziales System.
Schlüsselwörter
Fächerdifferenzierung, Studiengebühren, Hochschulfinanzierung, Verfassungsrecht, Nationalökonomie, Kosten, Rendite, Lenkungswirkung, Soziales System, Selbstverwaltung, Finanzierungsgerechtigkeit, Studienbeiträge, Hochschulgebühren.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Fächerdifferenzierung" bei Studiengebühren?
Es bedeutet, dass die Höhe der Studiengebühren je nach Studiengang unterschiedlich festgesetzt wird, beispielsweise basierend auf den tatsächlichen Kosten des Fachs oder den späteren Einkommenserwartungen.
Ist eine Fächerdifferenzierung mit dem Grundgesetz vereinbar?
Die Arbeit analysiert dies im Hinblick auf den Gleichheitssatz nach Art. 3 I GG und prüft, ob sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung der Studierenden rechtfertigen.
Welche ökonomischen Argumente sprechen für unterschiedliche Gebühren?
Diskutiert werden der Kostenaspekt (teure vs. günstige Studiengänge) sowie der Renditeaspekt (persönliche Einkommensaussichten der Absolventen).
Welche Praxisbeispiele für differenzierte Gebühren werden genannt?
Die Arbeit zieht die Private Universität Witten/Herdecke in Deutschland sowie das Hochschulsystem in Australien als Beispiele heran.
Welche Lenkungswirkung wird von solchen Gebühren erwartet?
In wirtschaftswissenschaftlichen Modellen wird untersucht, ob Gebühren die Nachfrage nach bestimmten Studienfächern steuern und so den Arbeitsmarkt besser bedienen können.
- Quote paper
- Natalie Jurewitz (Author), 2006, Fächerdifferenzierung von Studiengebühren. Ein Beitrag zur Diskussion über die Zukunft der staatlichen Hochschulen in der Bundesrepublik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51328