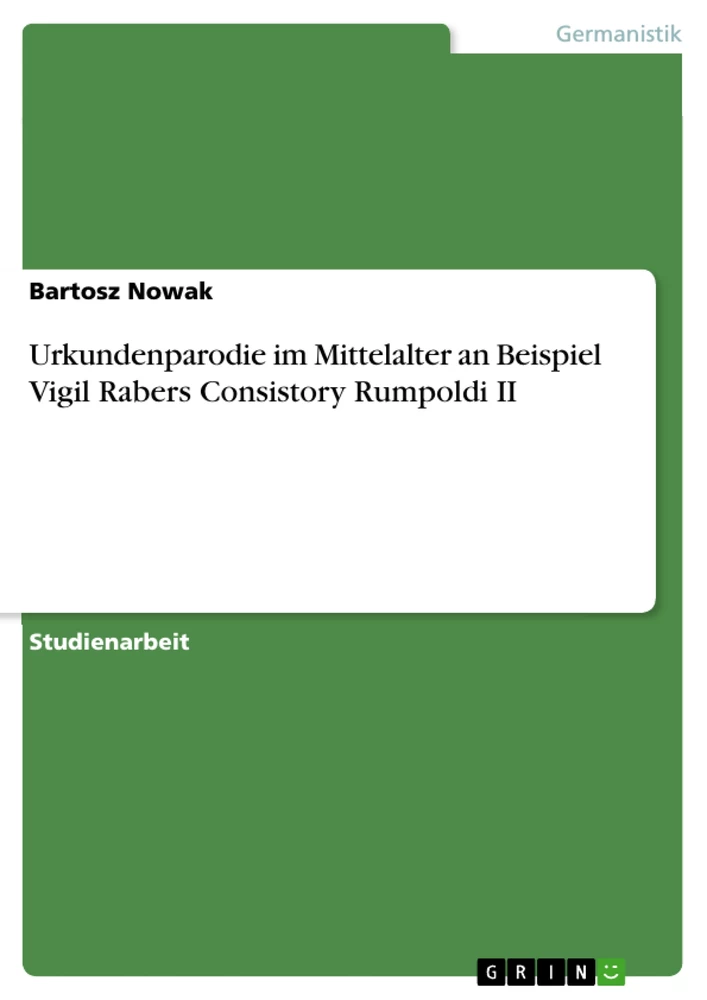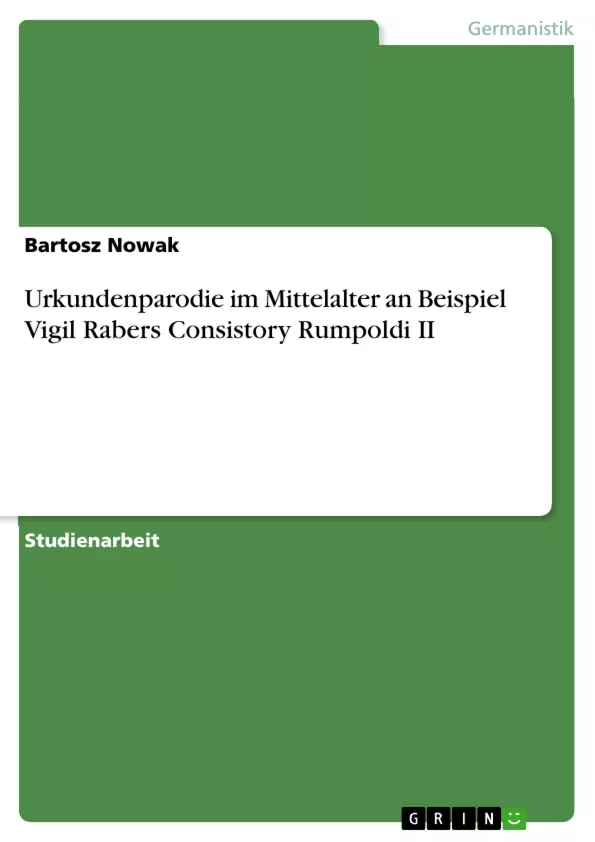Parodie – In der Literatur die verspottende, verzerrende oder übertreibende Nachahmung eines schon vorhandenen ernst gemeinten Werkes (auch eines Stils, einer Gattung) oder
einzelner Teile daraus unter Beibehaltung der äußeren Form (Stil und Struktur), doch mit anderem, nicht dazu passendem Inhalt. (von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur; 7 Auflage – Stuttgart: Kröner, 1989)
Aus der Literatur des Mittelalters sind nur wenige Überlieferungen parodistischer Texte in deutscher Sprache erhalten. Das Parodieren ist die Sache gebildeter Stände, und die Sprache der Gebildeten des Mittelalter war das Latein. Das heißt, dass das Parodieren zunächst in der Hand von niederen Klerikern und Vaganten lag. Die letzten propagierten diese Gattung meist auf der Landstraße oder im Wirtshause, d.h. überwiegend nicht in dem Medium der Schriftlichkeit. Dies führte zu dem heutigem Mangel von schriftlichen Aufzeichnungen dieser Dichtung. Die Texte jedoch, die uns heute vorliegen geben uns ein Bild davon, welcher Witz und Geist in dem mittelalterlichem Menschen steckte. Die Parodien haben zu der Zeit meist zwei Ziele: zum einen die Bibel und Liturgie, zum anderen die Minnedichtung ins Lächerliche zu ziehen. Dabei scheuen sie weder Anstößigkeit noch Skrupel vor dem Heiligen.
Ein weiterer Bereich der mittelalterlichen Parodie war die Urkundenparodie. Die Urkunde war im Mittelalter eine Textsorte die von dem heutigen Sprachgebrauch der Juristen nicht sehr abwich. Sie wurde unter Beachtung (und strikter Beibehaltung) bestimmter Formen geschrieben und diente als eine beglaubigte Erklärung bestimmter rechtlicher Vorgänge. In den parodistischen Texten wurde überwiegend das automatisierte, formelhafte Schreiben und die rechtliche Bedeutung ins Lächerliche gezogen. Es wurden also die formalen Strukturen zum großen Teil beibehalten, das Sprachniveau sank allerdings fast unter das Niveau der Gosse, und die Sachverhalte die beschrieben wurden, wurden sehr stark verändert und in andere (meist bäuerliche) Bereiche transponiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung - Hauptthemen der Parodie im Mittelalter
- Minne
- Bibel und Liturgie
- Astrologische und prophetische Schriften
- Urkundenparodie
- Die Urkundenparodie am Beispiel eines Morgenbriefes
- Die Textsorte „Urkunde“ im Mittelalter
- Die Urkundenparodie eines Morgengabebriefes
- Bau und Formelhaftigkeit
- Kontext
- Literatur
- Form und Sprache
- Publikum und Geschichte
- Fazit
- Quellentexte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Urkundenparodie im Mittelalter, insbesondere anhand eines Morgengabebriefes. Sie beleuchtet die Textsorte „Urkunde“ und die spezifischen Merkmale der Urkundenparodie. Darüber hinaus werden die Form, die Sprache und der Kontext dieser Parodie analysiert, um die Bedeutung und die Funktion der Urkundenparodie in der mittelalterlichen Gesellschaft zu verstehen.
- Die Textsorte "Urkunde" im Mittelalter
- Die Urkundenparodie als literarische Gattung
- Form und Sprache der Urkundenparodie
- Kontext und Funktion der Urkundenparodie
- Das Beispiel eines Morgengabebriefes
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung - Hauptthemen der Parodie im Mittelalter
Das Kapitel führt in das Thema der Parodie im Mittelalter ein. Es erläutert die wichtigsten Gattungen, die parodiert wurden, wie die Minnedichtung, die Bibel und Liturgie sowie astrologische und prophetische Schriften. Zudem wird die Entstehung der Urkundenparodie als eigene Gattung thematisiert.
Die Urkundenparodie am Beispiel eines Morgenbriefes
Das Kapitel behandelt die Urkundenparodie am Beispiel eines Morgengabebriefes. Es analysiert die Textsorte „Urkunde“ im Mittelalter und untersucht die spezifischen Merkmale der Urkundenparodie. Darüber hinaus werden die Form, die Sprache und der Kontext dieser Parodie betrachtet.
Schlüsselwörter
Urkundenparodie, Mittelalter, Morgengabebrief, Textsorte „Urkunde“, Form, Sprache, Kontext, Funktion, Literatur, Minne, Bibel, Liturgie, Parodie, Satire, Humor, Mittelalterliche Gesellschaft.
- Citar trabajo
- Bartosz Nowak (Autor), 2000, Urkundenparodie im Mittelalter an Beispiel Vigil Rabers Consistory Rumpoldi II , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52752