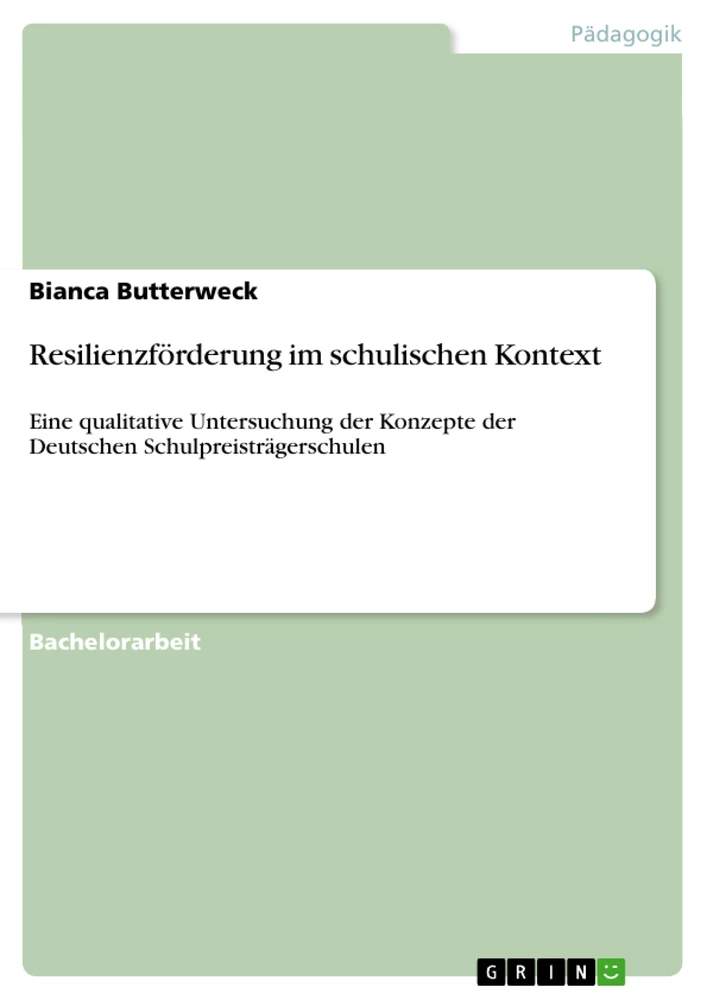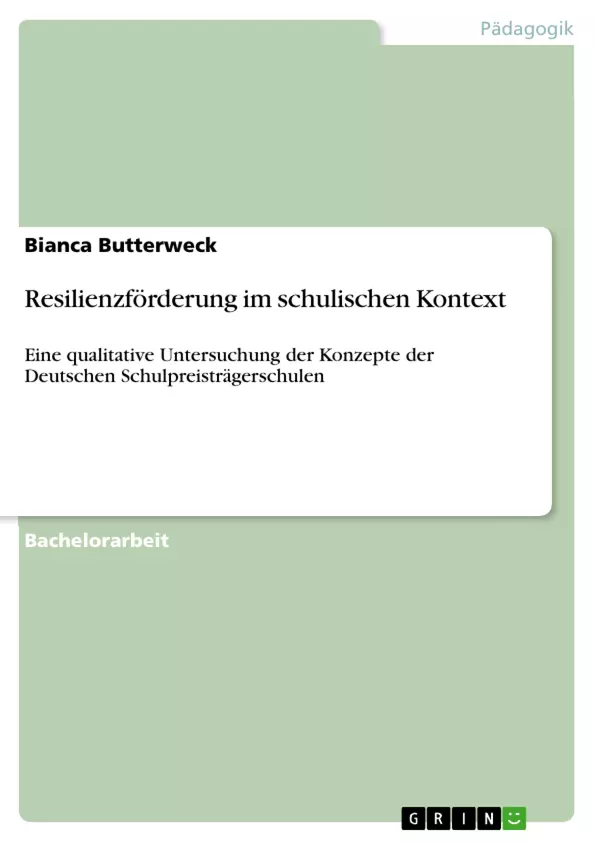Das Phänomen der Resilienz kann auf eine sechzigjährige Forschungstradition zurückblicken, erfährt im Kontext von Schule jedoch vergleichsweise wenig Berücksichtigung. Dabei ist es bedeutsam, dass gerade die jüngste Generation unserer Gesellschaft, die Kinder und Jugendlichen, resiliente Denk- und Handlungsmuster vermittelt bekommen, um zu lernen, wie sie aktuellen Widrigkeiten und Belastungen des Erwachsenenlebens standhalten können. Der Schule kommt dabei als einzige verpflichtende Bildungsinstitution eine tragende Rolle zu. Sie stellt eine Konstante im Leben der Kinder dar und hat dadurch die Möglichkeit kontinuierlich das Leben der Kinder, neben ihrem näheren Umfeld, mitbeeinflussen zu können. Aus diesem Grund ist es von Relevanz, die Resilienz mehr in das Zentrum der Schulforschung zu rücken.
In dieser Bachelorarbeit sollen die Möglichkeiten der Resilienzförderung in Schule und Unterricht am Beispiel der deutschen Schulpreisträgerschulen untersucht werden. Für die Untersuchung wurden die Schulkonzepte der Hauptpreisträgerschulen der Jahre 2014, 2015 und 2016 auf Resilienz fördernde Aspekte untersucht. Die Bedeutsamkeit einer Untersuchung dieser Schulen liegt darin begründet, dass sie einen Orientierungsrahmen für andere Schulen bilden. Weisen die Schulpreisträgerschulen Resilienz fördernde Möglichkeiten auf, so ist es wahrscheinlich, dass andere Schulen diese künftig auch für sich nutzbar machen werden.
Im Folgenden wird das Phänomen der Resilienz, mit dem Risiko- und Schutzfaktorenkonzept, sowie die Befunde aus der Resilienzforschung und verschiedene Resilienzansätze umfassend dargestellt. Auf dieser Grundlage wird Resilienz mit der Institution Schule in Bezug gesetzt und untersucht, welche Schutz- und Risikofaktoren in diesem Zusammenhang zugrunde liegen. Im Anschluss wird die Zielsetzung und Funktion des Deutsche Schulpreises beschrieben, sowie ein besonderes Augenmerk auf die Auswahlkriterien gerichtet. Abschließend werden die Schulprofile und -programme der einzelnen skizziert und ihre Konzepte auf Resilienz fördernde Möglichkeiten hin untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Resilienz
- 2.1. Annäherung an eine Definition
- 2.2. Klassifizierung der Belastungen
- 2.3. Anlage und Umwelt
- 2.4. Variabilität
- 3. Risiko- und Schutzfaktoren
- 3.1. Risikofaktoren
- 3.1.1. Definition
- 3.1.2. Kategorisierung
- 3.1.3. Einflussfaktoren
- 3.2. Schutzfaktoren
- 3.2.1. Definition
- 3.2.2. Kategorisierung
- 3.2.3. Einflussfaktoren
- 3.3. Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren
- 3.4. Kritik am Risiko- und Schutzfaktorenkonzept
- 3.1. Risikofaktoren
- 4. Der Begriff Coping und Coping-Strategien
- 4.1. Coping
- 4.2. Coping-Strategien
- 5. Resilienzmodelle
- 5.1. Vorstellung verschiedener Ansätze und Modelle
- 5.2. Das Kompensationsmodell
- 5.3. Das Herausforderungsmodell
- 5.4. Das Interaktionsmodell
- 5.5. Das Kumulationsmodell
- 6. Relevante Studien der Resilienzforschung
- 6.1. Die Salutogenese
- 6.2. Die Kauai-Längstschnittstudie
- 6.3. Die Mannheimer Risikokinderstudie
- 6.4. Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- 6.5. Gemeinsamkeiten der Forschungsbefunde
- 7. Schule - ein Schutz- oder Risikofaktor
- 7.1. Schule als Schutz- und Risikofaktor
- 7.2. Schule als Risikofaktor
- 7.3. Schule als Schutzfaktor
- 7.4. Schlussfolgerungen
- 8. Schulische Resilienzförderung
- 8.1. Gemeinsamkeiten der Begriffe Bildung und Resilienz
- 8.2. Kriterien schulischer Resilienzförderung
- 9. Der Deutsche Schulpreis
- 9.1.1. Weiteres Vorgehen
- 9.1.2. Zielvorstellungen
- 9.1.3. Entstehung
- 9.1.4. Auswahlkriterien
- 9.1.5. Auswahlverfahren
- 9.1.6. Vorjury und Jury
- 9.2. Qualitätsbereiche guter Schulen
- 9.2.1. Bedeutsamkeit für diese Arbeit
- 9.2.2. Leistung
- 9.2.3. Umgang mit Vielfalt
- 9.2.4. Unterrichtsqualität
- 9.2.5. Verantwortung
- 9.2.6. Schulleben, Schulklima und außerschulische Partner
- 9.2.7. Schule als Lernende Institution
- 10. Resilienz fördernde Möglichkeiten der Hauptpreisträgerschulen des Deutschen Schulpreises
- 11. Grundschule auf dem Süsteresch
- 12. Gesamtschule Barmen
- 13. Anne-Frank Realschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Resilienzförderung an deutschen Schulpreisträgerschulen. Ziel ist es, Resilienz fördernde Maßnahmen an ausgezeichneten Schulen zu identifizieren und deren Übertragbarkeit auf andere Schulen zu evaluieren. Die Analyse basiert auf einer Dokumentenanalyse der Schulkonzepte.
- Resilienz als Konzept und dessen Bedeutung im schulischen Kontext
- Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Resilienz
- Der Deutsche Schulpreis als Qualitätsmerkmal und seine Auswahlkriterien
- Analyse resilienzfördernder Maßnahmen an ausgewählten Schulpreisträgerschulen
- Übertragbarkeit der identifizierten Maßnahmen auf andere Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung begründet die Wahl des Themas Resilienzförderung im schulischen Kontext und beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung von Resilienz für Kinder und Jugendliche hervor und betont die Rolle der Schule als zentrale Bildungsinstitution. Die Methode der Dokumentenanalyse wird erläutert, und der Aufbau der Arbeit wird skizziert.
2. Resilienz: Dieses Kapitel definiert den Begriff Resilienz und klassifiziert Belastungen, die Kinder und Jugendliche erfahren. Es beleuchtet die Interaktion von Anlage und Umwelt sowie die Variabilität von Resilienz. Es liefert eine fundierte Basis für das Verständnis des Kernkonzepts der Arbeit.
3. Risiko- und Schutzfaktoren: Dieses Kapitel differenziert zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Resilienz. Es kategorisiert diese Faktoren und analysiert deren Einfluss auf die Resilienzentwicklung. Die Wechselwirkung zwischen Risiko- und Schutzfaktoren wird ebenso behandelt wie die Kritik am Konzept selbst, was ein kritisches und umfassendes Verständnis ermöglicht.
4. Der Begriff Coping und Coping-Strategien: Dieses Kapitel definiert "Coping" und verschiedene Coping-Strategien. Es bildet eine wichtige Ergänzung zum Verständnis der Bewältigungsmechanismen, die resilienten Personen einsetzen.
5. Resilienzmodelle: Hier werden verschiedene Resilienzmodelle vorgestellt und miteinander verglichen (Kompensations-, Herausforderungs-, Interaktions- und Kumulationsmodell). Der Vergleich der Modelle verdeutlicht die verschiedenen Perspektiven auf die Entwicklung von Resilienz.
6. Relevante Studien der Resilienzforschung: Dieses Kapitel präsentiert wichtige Studien der Resilienzforschung (Salutogenese, Kauai-Längstschnittstudie, Mannheimer Risikokinderstudie, Bielefelder Invulnerabilitätsstudie) und vergleicht ihre Ergebnisse. Die Zusammenfassung der Forschungsbefunde liefert wichtige Erkenntnisse für die weitere Analyse.
7. Schule - ein Schutz- oder Risikofaktor: Dieses Kapitel untersucht die Schule als potenziellen Schutz- oder Risikofaktor für die Entwicklung von Resilienz. Es analysiert die Bedingungen, unter denen die Schule jeweils als Schutz- oder Risikofaktor wirkt.
8. Schulische Resilienzförderung: Das Kapitel beleuchtet Gemeinsamkeiten von Bildung und Resilienz und definiert Kriterien für eine erfolgreiche schulische Resilienzförderung. Es legt den Grundstein für die spätere Analyse der Schulkonzepte.
9. Der Deutsche Schulpreis: Dieses Kapitel beschreibt den Deutschen Schulpreis, seine Zielsetzung, Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren. Es analysiert die Qualitätsbereiche guter Schulen, die für diese Arbeit relevant sind. Das Kapitel liefert wichtige Kontextinformationen für die anschließende Fallstudienanalyse.
Schlüsselwörter
Resilienz, Resilienzförderung, Schule, Schulentwicklung, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Coping, Deutscher Schulpreis, Qualitative Forschung, Dokumentenanalyse, Bildung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Resilienzförderung an deutschen Schulpreisträgerschulen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Resilienzförderung an deutschen Schulen, die mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurden. Das Ziel ist, resilienzfördernde Maßnahmen an diesen Schulen zu identifizieren und deren Übertragbarkeit auf andere Schulen zu evaluieren.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Analyse basiert auf einer Dokumentenanalyse der Schulkonzepte der ausgezeichneten Schulen. Es handelt sich also um eine qualitative Forschungsarbeit.
Was ist Resilienz und wie wird sie in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff Resilienz und klassifiziert Belastungen, die Kinder und Jugendliche erfahren. Sie beleuchtet die Interaktion von Anlage und Umwelt und die Variabilität von Resilienz. Verschiedene Resilienzmodelle (Kompensations-, Herausforderungs-, Interaktions- und Kumulationsmodell) werden vorgestellt und verglichen.
Welche Rolle spielen Risiko- und Schutzfaktoren?
Die Arbeit differenziert zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Resilienz, kategorisiert diese und analysiert ihren Einfluss. Die Wechselwirkung zwischen beiden wird ebenso betrachtet wie die Kritik am Konzept selbst.
Was ist Coping und wie wird es im Kontext von Resilienz betrachtet?
Der Begriff "Coping" und verschiedene Coping-Strategien werden definiert und als wichtige Bewältigungsmechanismen resilienter Personen erläutert.
Welche Studien der Resilienzforschung werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf wichtige Studien wie die Salutogenese, die Kauai-Längstschnittstudie, die Mannheimer Risikokinderstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie. Die Ergebnisse dieser Studien werden zusammengefasst und verglichen.
Welche Rolle spielt die Schule als Schutz- oder Risikofaktor?
Die Arbeit untersucht die Schule als potenziellen Schutz- oder Risikofaktor für die Entwicklung von Resilienz und analysiert die Bedingungen, unter denen sie jeweils so wirkt.
Wie wird schulische Resilienzförderung definiert?
Die Arbeit beleuchtet Gemeinsamkeiten von Bildung und Resilienz und definiert Kriterien für eine erfolgreiche schulische Resilienzförderung.
Welche Bedeutung hat der Deutsche Schulpreis für die Arbeit?
Der Deutsche Schulpreis dient als Qualitätsmerkmal. Die Arbeit beschreibt seine Zielsetzung, Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren und analysiert die für die Arbeit relevanten Qualitätsbereiche guter Schulen.
Welche Schulen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert im Detail resilienzfördernde Maßnahmen an ausgewählten Schulpreisträgerschulen, darunter die Grundschule auf dem Süsteresch, die Gesamtschule Barmen und die Anne-Frank-Realschule (genaue Namen könnten leicht abweichen).
Welche konkreten Maßnahmen zur Resilienzförderung werden identifiziert?
Die konkreten Maßnahmen werden durch die Analyse der Schulkonzepte der ausgezeichneten Schulen ermittelt und im Detail im Hauptteil der Arbeit beschrieben. Die FAQ liefern hier nur einen Überblick.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu Resilienz, Risiko- und Schutzfaktoren, Coping, Resilienzmodellen, relevanten Studien, der Schule als Schutz- oder Risikofaktor, schulischer Resilienzförderung, dem Deutschen Schulpreis und Fallstudien zu einzelnen ausgezeichneten Schulen. Ein Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
- Citation du texte
- Bianca Butterweck (Auteur), 2017, Resilienzförderung im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539461