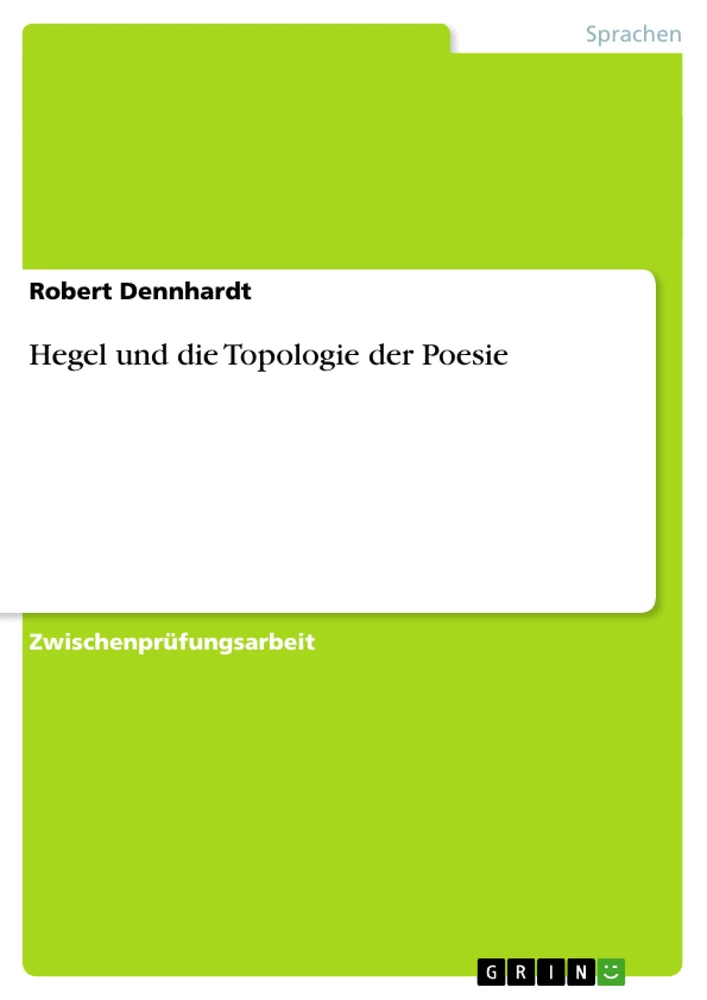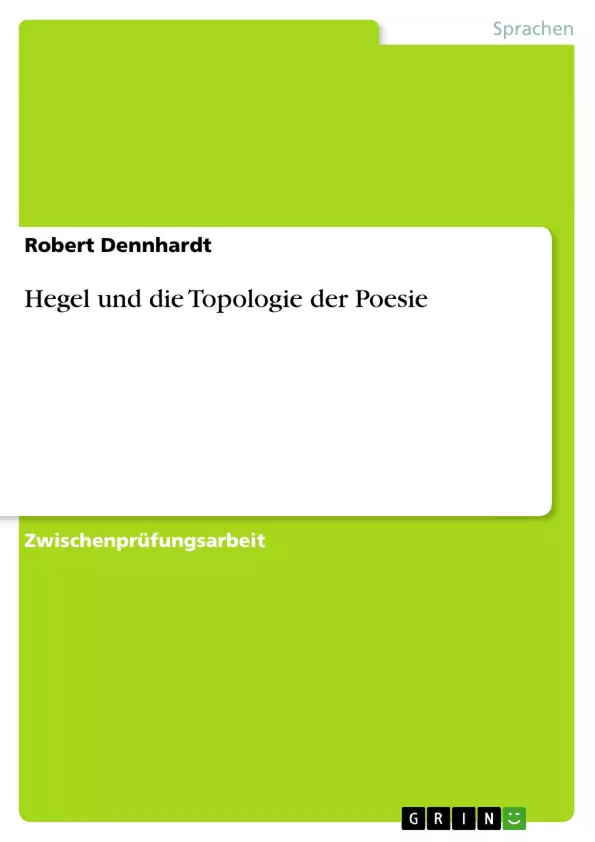Seine 1801 erschienene Differenzschrift beginnt Hegel mit einer typischen Geste des Absetzens oder besser Abhebens von allen eigentümlichen Ansichten seiner Vorgänger und Nachgänger, die es natürlich essentiell in der Philosophie nicht gibt, um sogleich auf die Eigentümlichkeit der Form des Schelling-Fichteschen Systems der Philosophie hinzuweisen. In Bezug auf den literarischen Stil ist Hegels Hinweis sicher berechtigt. (Vgl. Hegel 1979, Bd. 2, 13f.) Schreiben Fichte und besonders Schelling in wichtigen Passagen eher mystisch-verschleiert, ist bei Hegel ein starker Einfluß der Poesie seines Studienfreundes Hölderlins zu erkennen, auf den im zweiten Teil dieser Untersuchung einzugehen sein wird.
Ein Verständnis für Hegels zentrale Metapher der Heimkunft oder Heimkehr ermöglicht ein biographischer Blick auf seinen Zeitgenossen Hölderlin sowie auf Heideggers 1947 entstandenen Humanismusbrief. 1790 immatrikulieren sich Hölderlin und Schelling gemeinsam am Tübinger Stift für Philosophie und Theologie und beziehen gemeinsam mit Hegel, der sich schon zwei Jahre früher am Stift einschrieb, dasselbe Zimmer. Die Drei schließen Freundschaft und begeistern sich gleichermaßen für die Französische Revolution, insbesondere für die philosophischen Schriften Rousseaus. Neben dessen Hauptwerk Der Gesellschaftsvertrag erlangte vor allem Rousseaus 1762 beendetes Werk Émil, oder über die Erziehung große Bedeutung. Auf einer der letzten Seiten findet sich folgender Satz, der Hölderlins Poesie offensichtlich nachhaltig beeinflußt haben muß: „Die Reisen bieten einen Anstoß, seinen Neigungen nachzusehen, und vollenden den Menschen im Guten wie im Bösen. Bei der Heimkehr ist jeder so, wie er sein ganzes Leben hindurch bleiben wird.“ (Rousseau 1910, Bd. 2, 536.)
Inhaltsverzeichnis
- Differenz(en) nach Hegel
- Die Topologie der Poesie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Hegels Verhältnis zur Poesie und untersucht die Bedeutung von Differenz und Topologie in seiner Philosophie.
- Hegels Verhältnis zur Identitätsphilosophie von Fichte und Schelling
- Die Rolle der Differenz und des Bruchs in der Philosophie und Poesie
- Die topologische Struktur der Poesie und ihre Beziehung zum Denken
- Der Einfluss von Hölderlin auf Hegels Schreibstil
- Die Verbindung von Gnosis und Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Differenz(en) nach Hegel: Dieses Kapitel stellt Hegels philosophische Position im Kontext der Identitätsphilosophie von Fichte und Schelling dar. Es werden die zentralen Konzepte der Differenz, des Bruchs und des Netzes zwischen Philosophie und Poesie beleuchtet, wobei Beispiele aus der Literatur von Proust und Musil herangezogen werden. Die Ausführungen beziehen sich auf Gilles Deleuzes Theorie der Materialität des Gedankens und zeigen Hegels Holismus des Bewusstseins auf.
- Die Topologie der Poesie: Dieses Kapitel erörtert die Topologie der Poesie im Kontext von Hegels Philosophie. Es werden Schellings Konzept der Identitätsphilosophie und seine Beziehungen zu Fichte und Hegel beleuchtet. Weiterhin wird die Rolle von Gnosis und Erkenntnis im Diskurs der Theodizee analysiert, wobei Bezug auf den Einfluss von Jacob Burckhardt auf Schellings Werk genommen wird.
Schlüsselwörter
Hegel, Identitätsphilosophie, Differenz, Topologie, Poesie, Gnosis, Hölderlin, Schelling, Fichte, Deleuze, Proust, Musil, Burckhardt, Theodizee.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Hölderlin auf Hegels Philosophie?
Hegel und Hölderlin waren Studienfreunde. Hölderlins Poesie beeinflusste Hegels literarischen Stil und seine zentralen Metaphern, wie etwa die der „Heimkunft“ oder „Heimkehr“.
Was bedeutet die Metapher der „Heimkehr“ bei Hegel?
Die Metapher ist eng mit biographischen Einflüssen von Hölderlin und Rousseau verknüpft. Sie beschreibt einen Prozess der Selbstwerdung und Vollendung des Menschen, der nach äußeren Erfahrungen zu sich selbst zurückfindet.
Wie grenzt sich Hegel von Fichte und Schelling ab?
In seiner „Differenzschrift“ von 1801 setzt sich Hegel kritisch mit der Identitätsphilosophie seiner Vorgänger auseinander und weist auf die Eigentümlichkeit der Form ihrer Systeme hin.
Was versteht man unter der „Topologie der Poesie“?
Die Topologie der Poesie untersucht die räumliche und strukturelle Anordnung von Sprache und Denken. Sie analysiert das Netz zwischen Philosophie und Poesie und wie Brüche in der Sprache Sinn stiften.
Welche Rolle spielt die Gnosis in diesem philosophischen Diskurs?
Die Arbeit untersucht die Verbindung von Gnosis und Erkenntnis im Kontext der Theodizee und der Identitätsphilosophie, insbesondere im Hinblick auf Schellings Werk.
- Citation du texte
- Dr. des. Robert Dennhardt (Auteur), 2001, Hegel und die Topologie der Poesie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68373