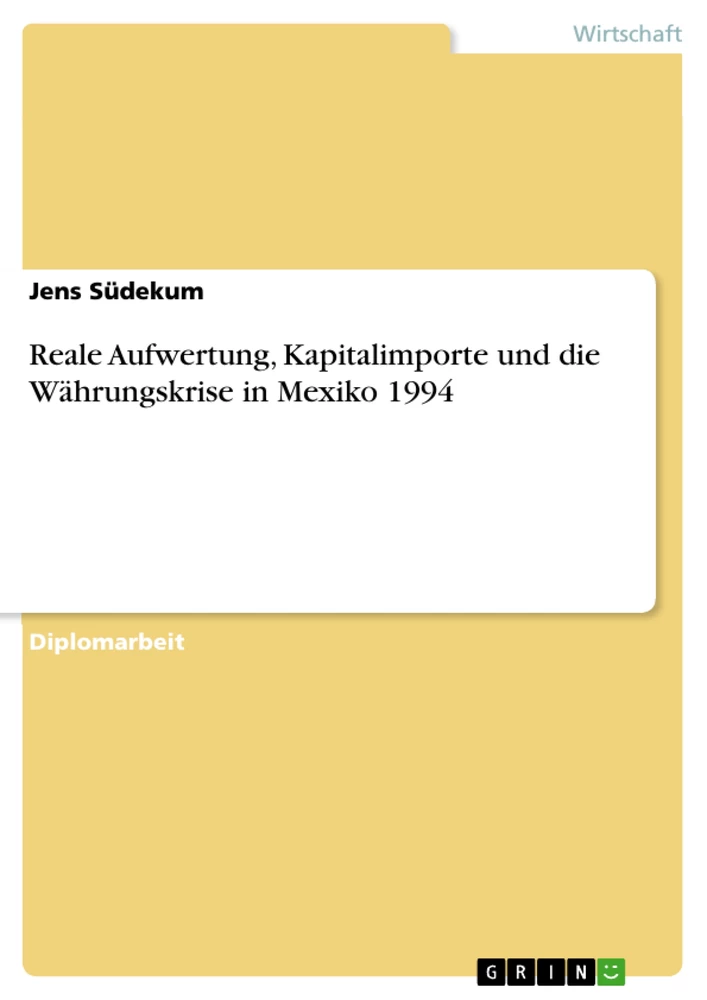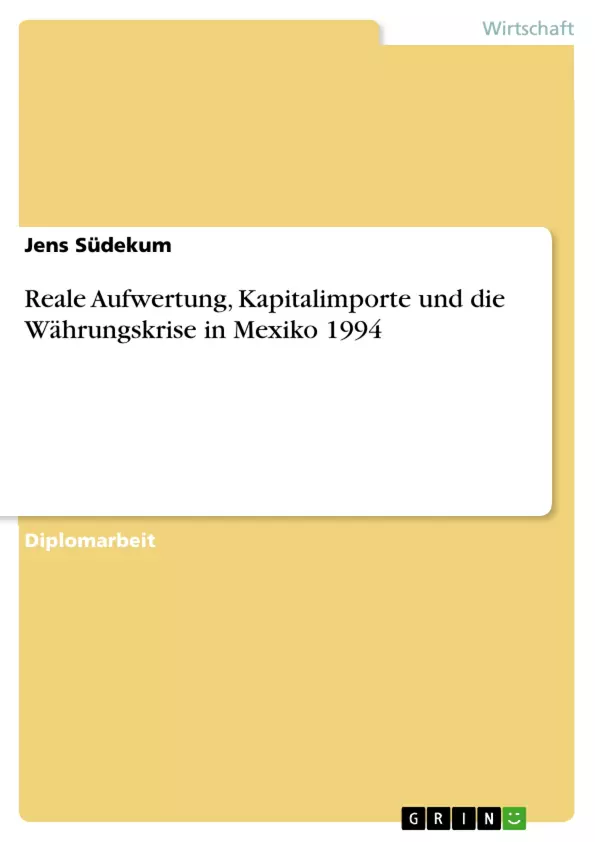- Einleitung -
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den makroökonomischen Auswirkungen von Kapitalimporten in kleine, offene Volkswirtschaften. Diese sollen durch ein Modell aus dem Bereich des intertemporalen Ansatzes zur Zahlungsbilanzanalyse untersucht
werden, das auf dynamischer Maximierung eines repräsentativen Konsumenten beruht.
Konkretes Anschauungsobjekt und Motivation dieser theoretischen Analyse sind die massiven Kapitalzuflüssen nach Mexiko in der Zeit von 1989 bis 1993. Diese zogen gesamtwirtschaftliche Folgen nach sich, die als empirischer Bezugspunkt der entwickelten theoretischen Erkenntnisse dienen. Als prägnanteste Folgeerscheinungen ergaben
sich ein starkes Leistungsbilanzdefizit und eine Realaufwertung des Peso. Diese wurden zunächst wirtschaftspolitisch als wenig problematisch eingestuft. Auch in der präsentierten Modellanalyse ergeben sich eine Realaufwertung und ein Leistungsbilanzdefizit
als Gleichgewichtsphänome im Fall von Kapitalimporten. Sie implizieren also keine makroökonomische Fehlentwicklung.
Dennoch erlitt Mexiko 1994 eine schwere Währungs- und Finanzkrise, die so genannte Tequila-Krise. Bei der Analyse der Krisenursachen wurde den makroökonomischen Prozessen, die im Zusammenhang mit den Kapitalimporten standen, eine besondere Beachtung gewidmet. Insbesondere die Realaufwertung wurde oftmals als wesentliche
Krisenursache gesehen. Dies impliziert, daß die ab einem gewissen Zeitpunkt eine ungleichgewichtige Realaufwertung, eine Überbewertung, stattgefunden haben muß. Um die Rolle des realen Wechselkurses im Zusammenhang mit der Währungskrise näher
untersuchen zu können, wird die präsentierte theoretische Analyse entsprechend erweitert.
Die These von der Überbewertung wird theoretisch fundiert und die Ursachen der Ungleichgewichtigkeit werden präzisiert.
Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Kapitel 1 bietet einen Überblick der makroökonomischen Entwicklung Mexikos bis 1994. In Kapitel 2 wird der Begriff Kapitalimporte definitorisch geklärt. Es werden Ursachen von Kapitalimporte in kleine, offene Volkswirtschaften erläutert und kathegorisiert. Theoretische Überlegungen zu den makroökonomischen Auswirkungen von Kapitalimporten werden angestellt. Deren Ergebnisse werden mit den empirischen Daten Mexikos von 1989-1993 verglichen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Überblick der makroökonomischen Entwicklung Mexikos bis 1994
- Kapitalimporte in kleine offene Volkswirtschaften
- Definition und Konzept des Begriffs Kapitalimport
- Ursachen von Kapitalimporten: Interne versus externe Faktoren
- Makroökonomische Auswirkungen von Kapitalimporten
- Struktur und Folgen der Kapitalimporte nach Mexiko 1989-1993
- Das Grundmodell des intertemporalen Ansatzes zur Zahlungsbilanzanalyse
- Einführung und Modellannahmen
- Das dynamische Maximierungsproblem des Haushaltes
- Die Lösungsinterpretation
- Ein stationäres dynamisches Gleichgewicht
- Unantizipierte Schocks: Rückgang des Outputs
- Ein permanenter Rückgang des Outputs
- Ein temporärer Rückgang des Outputs
- Das Grundmodell im Überblick
- Ein Modell der makroökonomische Folgen von Kapitalimporten
- Einführung und Modellannahmen
- Das dynamische Maximierungsproblem des Haushaltes
- Die Geldnachfragefunktion
- Die Lösung des dynamischen Maximierungsproblems
- Der Staat in diesem Modell
- Exkurs: Die Politikvariablen und deren konsistente Setzung
- Die Gleichgewichtsbedingungen des Modells
- Ein stationäres dynamischen Gleichgewicht bei festen Wechselkursen
- Ein nominaler Schock: Fall des ausländischen Zinsniveaus i*
- Permanenter Fall des ausländischen Zinsniveaus i*
- Temporärer Fall des ausländischen Zinsniveaus i*
- Lösungsinterpretation und Überblick des Modells
- Der Weg in die Währungskrise
- Der Ausgangspunkt 1994 und die These von der Peso-Überbewertung
- Die Realaufwertung als Gleichgewichtsphänomen
- Die Realaufwertung als Ungleichgewichtsphänomen
- Das Krisenjahr 1994
- Politische Krisen des Jahres 1994
- Ökonomische Krisenanzeichen des Jahres 1994
- Die letzten Monate vor Ausbruch der Währungskrise
- Der Ausbruch der Währungskrise
- Rezeption der Währungskrise
- Der Ausgangspunkt 1994 und die These von der Peso-Überbewertung
- Beurteilung und kritische Würdigung des Modells
- Vergleich mit dem Mundell-Fleming-Modell (MFM)
- Vergleich der grundsätzlichen Modellstrukturen
- Unterbeschäftigungs- versus Vollbeschäftigungsmodell
- Behaviouristisches versus maximierendes Modell
- Die Berücksichtigung intertemporaler Zusammenhänge
- Ein sinkendes ausländisches Zinsniveau ia im MFM
- Vergleich der Modellergebnisse
- Vergleich der grundsätzlichen Modellstrukturen
- Methodologie-Kritik des dynamischen Modells
- Restriktivität und Realitätsferne der Annahmen
- Überlegungen zur Methodologie-Kritik
- Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit des Modells
- Schlüssigkeit des Modells und Vertretbarkeit der Annahmen
- Vereinfachende Annahmen
- Kritische Annahmen
- Die Rechtfertigung des Modells durch seine Hypothesen
- Eine Gesamtbeurteilung der beiden Modelle im Vergleich
- Vergleich mit dem Mundell-Fleming-Modell (MFM)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mexikanische Währungskrise von 1994 aus der Perspektive eines intertemporalen Ansatzes zur Zahlungsbilanzanalyse. Sie analysiert die Rolle von Kapitalimporten und Realaufwertung als Ursachen der Krise und untersucht die Auswirkungen dieser Faktoren auf die makroökonomische Entwicklung Mexikos.
- Die Ursachen und Auswirkungen von Kapitalimporten auf kleine offene Volkswirtschaften
- Die Rolle der Realaufwertung in der mexikanischen Währungskrise
- Die Analyse der Währungskrise im Kontext des intertemporalen Ansatzes zur Zahlungsbilanzanalyse
- Ein Vergleich des intertemporalen Modells mit dem Mundell-Fleming-Modell
- Eine kritische Würdigung des Modells hinsichtlich seiner Annahmen und seiner Fähigkeit, die mexikanische Währungskrise zu erklären
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel bietet einen Überblick über die makroökonomische Entwicklung Mexikos bis 1994 und stellt die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Faktoren vor, die den Kontext für die Währungskrise bilden.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit Kapitalimporten in kleine offene Volkswirtschaften. Es definiert den Begriff des Kapitalimports, untersucht die Ursachen von Kapitalimporten und analysiert die makroökonomischen Auswirkungen von Kapitalimporten auf Volkswirtschaften.
- Das dritte Kapitel stellt das Grundmodell des intertemporalen Ansatzes zur Zahlungsbilanzanalyse vor. Es beschreibt die Modellannahmen, die dynamische Maximierung des Haushalts und die Interpretation der Lösung des Modells.
- Das vierte Kapitel erweitert das Modell aus dem vorherigen Kapitel und analysiert die makroökonomischen Folgen von Kapitalimporten. Es untersucht das dynamische Maximierungsproblem des Haushaltes unter Berücksichtigung der Geldnachfrage, der Rolle des Staates und der Gleichgewichtsbedingungen des Modells.
- Das fünfte Kapitel untersucht den Weg in die mexikanische Währungskrise von 1994. Es analysiert den Ausgangspunkt der Krise, die These von der Peso-Überbewertung und die wichtigsten politischen und ökonomischen Krisenanzeichen des Jahres 1994.
- Das sechste Kapitel befasst sich mit der Beurteilung und kritischen Würdigung des Modells. Es vergleicht das intertemporale Modell mit dem Mundell-Fleming-Modell und diskutiert die Methodologie-Kritik des Modells hinsichtlich seiner Restriktivität, Realitätsferne und Schlüssigkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Kapitalimporte, Realaufwertung, intertemporaler Ansatz, Zahlungsbilanzanalyse, Währungskrise, Mexiko, Mundell-Fleming-Modell, makroökonomische Modellierung und kritische Modellanalyse. Darüber hinaus werden Themen wie Wirtschaftswachstum, Inflation, Staatsverschuldung, Leistungsbilanzdefizit und Zinsniveau behandelt. Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen der mexikanischen Währungskrise von 1994 im Kontext dieser Themen.
Häufig gestellte Fragen
Was verursachte die mexikanische Tequila-Krise 1994?
Wesentliche Ursachen waren massive Kapitalimporte, eine darauffolgende Überbewertung des Peso sowie politische Instabilität im Jahr 1994.
Warum führen Kapitalimporte oft zu einer Realaufwertung?
Durch den Zufluss von ausländischem Kapital steigt die Nachfrage nach inländischen Gütern und Währung, was den realen Wechselkurs nach oben treibt.
Was ist der intertemporale Ansatz zur Zahlungsbilanzanalyse?
Dieser Ansatz betrachtet Leistungsbilanzsalden als Ergebnis von Konsum- und Investitionsentscheidungen über verschiedene Zeitperioden hinweg, basierend auf dynamischer Maximierung.
Wie unterscheidet sich das Modell vom Mundell-Fleming-Modell?
Während Mundell-Fleming ein Verhalten-basiertes Unterbeschäftigungsmodell ist, nutzt der intertemporale Ansatz Vollbeschäftigungsannahmen und mikroökonomische Fundierung.
War die Peso-Aufwertung ein Gleichgewichtsphänomen?
Anfänglich ja. Ab einem gewissen Punkt wurde sie jedoch zum Ungleichgewichtsphänomen (Überbewertung), was die Wettbewerbsfähigkeit Mexikos schwächte und zur Krise beitrug.
- Citar trabajo
- Jens Südekum (Autor), 2000, Reale Aufwertung, Kapitalimporte und die Währungskrise in Mexiko 1994, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79