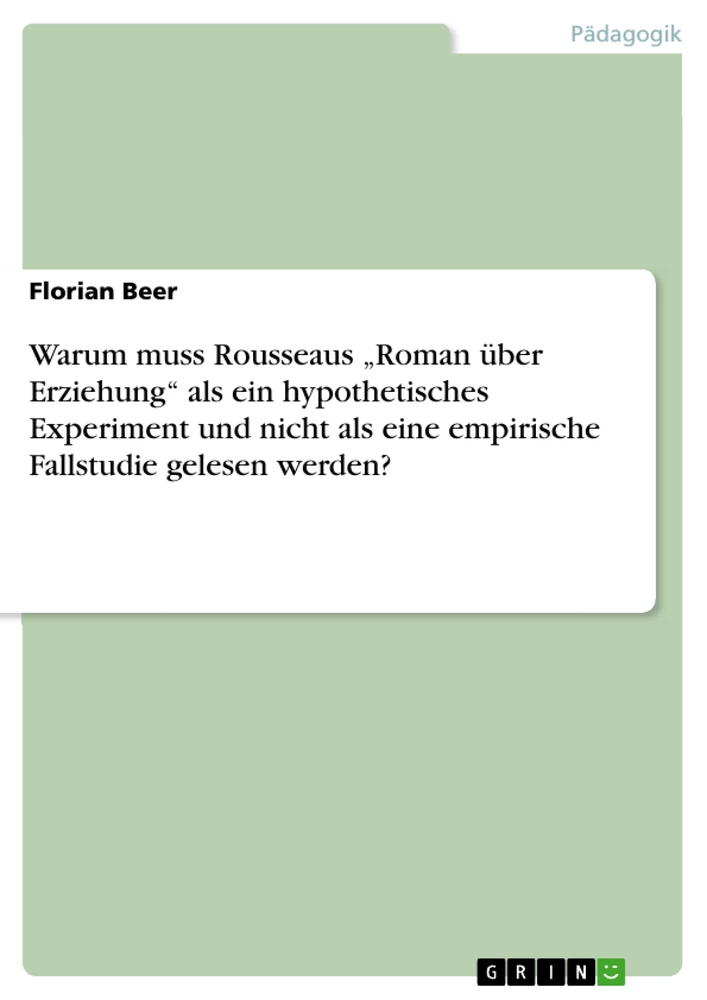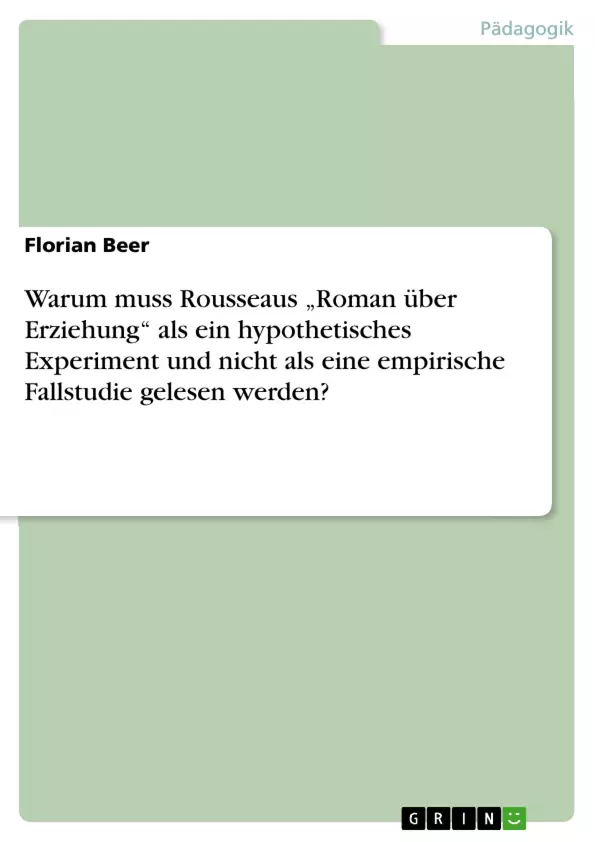„Emil oder über die Erziehung“ schildert eine Erziehungssituation, in der der Erzieher einen einzigen Zögling über 25 Jahre lang ununterbrochen begleitet und ihm dabei seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmet. Eine solche Erziehungssituation scheint so nicht oder nur als „Modell für privilegierte aristokratische Kinder“ realisierbar zu sein. Dass Rousseau jedoch nicht im Sinn hatte, mit dem „Emil“ einen Ratgeber für Hauslehrer des Adels und vermögenden Bürgertums zu schreiben, erhellt sich durch die Einordnung der Schrift in das Gesamtwerk des Autors.
Inhaltsverzeichnis
- Warum muss Rousseaus „Roman über Erziehung“ als ein hypothetisches Experiment und nicht als eine empirische Fallstudie gelesen werden?
- „Emil oder über die Erziehung“ schildert eine Erziehungssituation, in der der Erzieher einen einzigen Zögling über 25 Jahre lang ununterbrochen begleitet und ihm dabei seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmet.
- Rousseau fragt: „Aber wo gibt es noch diesen Menschen der Natur, der ein wahrhaft-menschliches Leben lebt; der die Meinung der anderen für nichts achtet, und der sich lediglich von seinen Neigungen und seiner Vernunft leiten lässt, ohne Rücksicht darauf, was die Gesellschaft, was das Publikum billigt oder tadelt? Man sucht ihn vergebens unter uns.
- Die bestehende Gesellschaftsordnung wird als „Ursache aller Verderbnis und alles [sic] Unglücks der Menschheit“³ kritisiert, in dem sie es dem Menschen unmöglich mache, seine natürliche Ursprünglichkeit und Freiheit zu bewahren und ihn in Abhängigkeit von „fremdem Gebot und fremder Willkür“ halte.
- Selbst die Philosophie unterliege dem Zwang bloßer Konventionen. „In unseren Sitten wie im Denken [...] herrscht eine niedrige und betrügerische Gleichförmigkeit. [...] Ohne Unterlaß fordert die Höflichkeit, befiehlt der Anstand bestimmte Dinge; immer folgt man dem Gebrauch, nie dem eigenen Genius.\"
- Wenn dann noch festgestellt wird, dass „alles [...] unter den Händen der Menschen [entartet]“7, wird deutlich, dass eine Gesellschaftsform, die der Natur des Menschen angemessen ist, nicht durch eine Analyse bestehender Verhältnisse oder das Vertrauen auf schrittweises Reformieren derselben etabliert werden kann.
- Ebensowenig bietet der Fortschritt der Wissenschaften Anlass zur Hoffnung auf eine zukünftige bessere Gesellschaft. Vielmehr sind die „Wissenschaften […] unnütz durch das, was sie erstreben, und noch viel gefährlicher durch die Wirkungen, die sie hervorbringen“.
- Dieses Ergebnis stimmt pessimistisch, scheint sich doch zu zeigen, dass eine dem Menschen angemessene Gesellschaft auf der Grundlage der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft nicht erschaffen, streng genommen nicht einmal gedacht werden kann.
- Rousseau löst das Dilemma durch die hypothetische Rekonstruktion des Naturzustandes.
- Über die Quelle der Selbsterkenntnis und der Selbstbesinnung, nicht unter Zuhilfenahme historischer oder ethnologischer Überlegungen¹⁰, will er das „eigentliche Urbild [des Menschen] [...] unter seinen künstlichen Umhüllungen, unter all den willkürlichen und konventionellen Zutaten [...] entdecken und ans Licht [...] ziehen“¹¹.
- Der natürliche, d. h. von allen gesellschaftlichen Bindungen entkleidete Mensch verfügt nach Rousseau über einen freien Willen, ein Selbsterhaltungsinteresse, das sein Korrektiv in einem natürlichen Mitleid findet sowie über die Gabe der Perfektibilität im Sinne einer unbestimmten Bildsamkeit.
- Die Tatsache, dass „die Menschen böse [werden], während der Mensch gut war“12 erklärt sich für Rousseau aus dem dialektischen Charakter dieser Bildsamkeit und der Tatsache konkurrierender Interessen.
- ,,[W]enn sie auch Laster haben, so geschieht es, weil ihre Interessen sich kreuzen und ihr Ehrgeiz in dem Maße erwacht, in dem ihre Einsichten sich ausbreiten.“13 ,,Der erste, der, nachdem er ein Stück Land eingezäunt hatte, kühn behauptete: `Das ist mein!' und der Leute fand, die so einfältig waren, ihm dies zu glauben, wurde zum wahren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft.\"
- Die Bildsamkeit und die Vernunft als „,wichtigste[s] Instrument der Perfektionierung“¹5 mögen zwar um der Eigenliebe und des eigenen Vorteils willen missbraucht worden sein und der Entwicklung einer den Menschen unnatürlichen Gesellschaft gedient haben und Rousseau mag „in der Entwicklung des Menschen zum Vernunftwesen eine Art von 'Sündenfall'❝16 gesehen haben.
- Dennoch ist er zugleich überzeugt, dass nur in der Perfektibilität der Menschen die Bedingung ihrer Möglichkeit liegt, sich in einer „politisch-ethischen Gemeinschaft“17 zusammenzuschließen, „in der jeder, statt der Willkür anderer unterworfen zu sein, nur dem allgemeinen Willen, den er als seinen erkennt und anerkennt, gehorcht“18.
- Eine solche Gesellschaft, die die Freiheit und Würde des Einzelnen gerade dadurch sichert, dass der Einzelne sich aus eigener Überzeugung unter das gemeinschaftliche, alle Willkür überwindende Gesetz stellt, ist für Rousseau die dem Menschen einzig angemessene.
- Über die hypothetische Rekonstruktion des Naturzustandes gelingt es Rousseau, dem empirisch vorgefundenen und als der menschlichen Natur unangemessen erkannten Gesellschaftsmodell ein ideales gegenüberzustellen.
- Und erst von hier lässt sich die Funktion des Emil erschließen.
- Denn das Buch ist ebenfalls als hypothetische Konstruktion zu verstehen, die verdeutlichen soll, dass der Menschheit der Weg zu dieser idealen Gesellschaft nicht versperrt ist.
- Indem Rousseau Emile eine idealisierte Erziehung durchlaufen lässt, stellt er den „kultur- und gesellschaftskritischen Diagnosen der Diskurse einen konstruktiven Entwurf an die Seite [...], der Wege kenntlich werden läßt, mit denen Entfremdung und moralischer Verfall umgangen werden können“20.
- Die vielfach geäußerte Kritik am Emil, der Versuch, dem Zögling die bestehende Ordnung der Dinge zu verbergen sei nicht nur wider seine Natur, sondern von vornherein zum Scheitern verurteilt, verkennt daher die Intention des Buches.²¹
- Rousseau kann eben gerade deshalb eine „Art sozialer Phantasmagorie “22 entwerfen und die Erziehungsbedingungen scheinbar willkürlich konstruieren, weil es eben nicht seine Absicht ist, ein pädagogisches Regelwerk zur Verfügung zu stellen.
- Stattdessen bietet er mit dem Emil ein hypothetisches Experiment an, dessen Vorteil gerade in seiner Modellierbarkeit liegt und mit dem gezeigt werden soll, dass eine Bildung zum echten Staatsbürger, der nur unter dem „Joch der naturgewollten Notwendigkeit“ stehen und nicht dem Willen anderer, sondern nur dem Willen aller verpflichtet ist, prinzipiell möglich ist.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Frage, warum Rousseaus „Emil oder über die Erziehung“ als ein hypothetisches Experiment und nicht als eine empirische Fallstudie verstanden werden muss. Er analysiert Rousseaus Argumentation, dass die bestehende Gesellschaftsordnung den Menschen in Abhängigkeit von „fremdem Gebot und fremder Willkür“ hält und ihm die Entwicklung seiner natürlichen Ursprünglichkeit und Freiheit verwehrt.
- Die Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung und ihren Auswirkungen auf die menschliche Natur.
- Die hypothetische Rekonstruktion des Naturzustandes als Mittel zur Erhellung der menschlichen Natur und des Wertes von Freiheit und Autonomie.
- Die Bedeutung der Perfektibilität des Menschen und ihre Rolle bei der Bildung einer idealen, gerechten Gesellschaft.
- Die Funktion des „Emil“ als hypothetisches Experiment, das Möglichkeiten für eine Bildung zum echten Staatsbürger aufzeigt.
- Die Unterscheidung zwischen empirischen Fallstudien und hypothetischen Experimenten im Kontext von Erziehungswissenschaften.
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit der Darstellung der Situation in Rousseaus „Emil oder über die Erziehung“, in der ein Erzieher einen einzigen Zögling über 25 Jahre lang begleitet.
- Es wird deutlich, dass Rousseau mit dem „Emil“ kein Ratgeber für Hauslehrer des Adels und vermögenden Bürgertums schreiben wollte, sondern eine kritische Analyse der bestehenden Gesellschaftsordnung und ihren negativen Folgen für die menschliche Entwicklung.
- Rousseau kritisiert die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse als „Ursache aller Verderbnis und alles [sic] Unglücks der Menschheit“ und zeigt, dass sie den Menschen von seiner natürlichen Freiheit und Ursprünglichkeit entfremden.
- Er argumentiert, dass die Gesellschaft den Menschen zu einer „niedrigen und betrügerischen Gleichförmigkeit“ zwingt und ihn von seinem eigenen Genius trennt.
- Rousseau stellt fest, dass eine Gesellschaft, die der Natur des Menschen entspricht, nicht durch Analyse bestehender Verhältnisse oder durch schrittweise Reformen zu erreichen ist.
- Der Autor stellt fest, dass die Wissenschaften nicht zu einer besseren Gesellschaft beitragen, sondern eher zu weiterer Entfremdung und moralischem Verfall führen.
- Rousseau löst das Dilemma, dass eine dem Menschen angemessene Gesellschaft in der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft nicht denkbar ist, durch die hypothetische Rekonstruktion des Naturzustandes.
- Er beschreibt den Menschen im Naturzustand als frei, mit einem Selbsterhaltungsinteresse, das durch natürliches Mitleid begrenzt wird, und mit der Fähigkeit zur Perfektibilität.
- Rousseau erklärt die Entwicklung des Menschen zum „bösen“ Wesen durch den dialektischen Charakter der Perfektibilität und die Konkurrenz von Interessen.
- Er beschreibt den Ursprung der bürgerlichen Gesellschaft als Ergebnis von Eigenliebe und dem Streben nach Macht, das zu Missbrauch der Perfektibilität und der Vernunft führt.
- Trotz der negativen Folgen der gesellschaftlichen Entwicklung ist Rousseau überzeugt, dass nur in der Perfektibilität des Menschen die Möglichkeit zur Bildung einer „politisch-ethischen Gemeinschaft“ liegt, in der jeder dem allgemeinen Willen gehorcht.
- Die hypothetische Rekonstruktion des Naturzustandes ermöglicht es Rousseau, dem empirisch vorgefundenen Gesellschaftsmodell ein ideales gegenüberzustellen.
- Der „Emil“ wird ebenfalls als eine hypothetische Konstruktion verstanden, die verdeutlichen soll, dass der Menschheit der Weg zu dieser idealen Gesellschaft nicht versperrt ist.
- Durch die idealisierte Erziehung, die Emile durchläuft, zeigt Rousseau, dass es Wege gibt, um Entfremdung und moralischem Verfall zu begegnen.
- Die Kritik am „Emil“, die besagt, dass der Versuch, dem Zögling die bestehende Ordnung der Dinge zu verbergen, zum Scheitern verurteilt sei, verkennt die Intention des Buches.
- Rousseau möchte mit dem „Emil“ kein pädagogisches Regelwerk erstellen, sondern ein hypothetisches Experiment anbieten, das zeigt, dass eine Bildung zum echten Staatsbürger prinzipiell möglich ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes umfassen die Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung, die hypothetische Rekonstruktion des Naturzustandes, die Perfektibilität des Menschen, die Bildung zum echten Staatsbürger, hypothetische Experimente in der Erziehungswissenschaft und die Unterscheidung zwischen empirischen Fallstudien und hypothetischen Experimenten.
Häufig gestellte Fragen
Warum bezeichnet Rousseau den „Emil“ als hypothetisches Experiment?
Weil er kein praktisches Regelwerk für Hauslehrer sein will, sondern ein Gedankenmodell entwirft, um zu zeigen, wie eine Erziehung zum freien Staatsbürger prinzipiell möglich ist.
Was kritisiert Rousseau an der bestehenden Gesellschaft?
Er sieht sie als Ursache für die Entfremdung und den moralischen Verfall des Menschen, da sie ihn in Abhängigkeit von fremder Willkür hält.
Was versteht Rousseau unter „Perfektibilität“?
Es ist die menschliche Fähigkeit zur unbestimmten Bildsamkeit, die sowohl zum moralischen Fortschritt als auch zum „Sündenfall“ durch Missbrauch führen kann.
Wie definiert Rousseau den Naturzustand?
Als eine hypothetische Rekonstruktion des Menschen, der frei von gesellschaftlichen Zwängen ist und über einen freien Willen sowie natürliches Mitleid verfügt.
Was ist das Ziel der idealen politischen Gemeinschaft bei Rousseau?
Eine Gemeinschaft, in der jeder nur dem allgemeinen Willen gehorcht, den er selbst als seinen eigenen Willen anerkennt, um Freiheit und Würde zu wahren.
- Quote paper
- Florian Beer (Author), 2006, Warum muss Rousseaus „Roman über Erziehung“ als ein hypothetisches Experiment und nicht als eine empirische Fallstudie gelesen werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84910