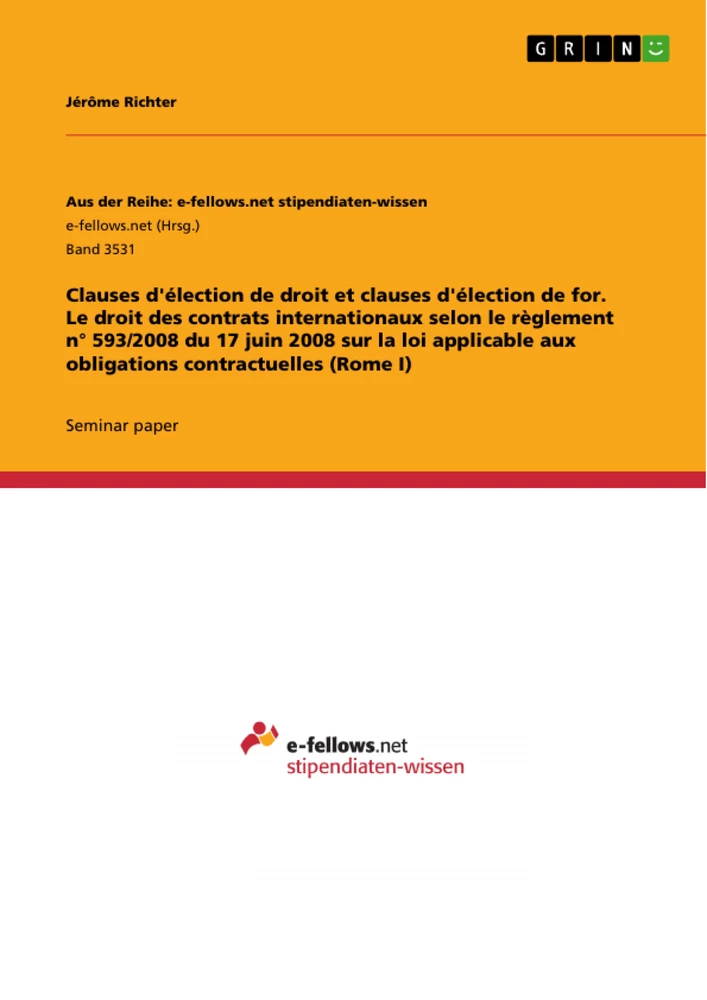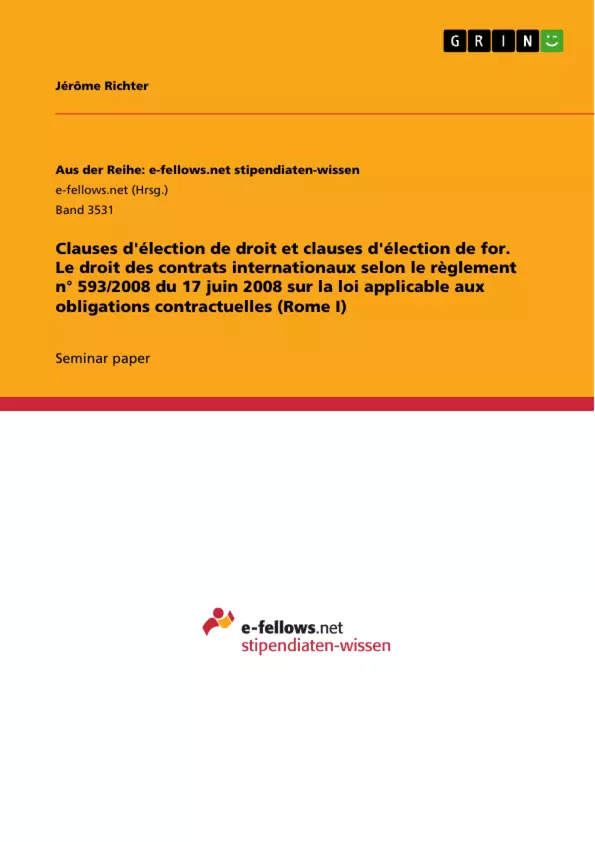"Dire qu’un tribunal est compétent pour connaître d’un litige est autre chose que déterminer la loi qui sera appliquée à ce litige." Alors qu’il est exact de faire cette distinction de base en théorie, il ne faut pas négliger l’articulation importante en pratique de la détermination du droit applicable et du for compétent. Pour la solution d’un litige, la totalité de la réponse aux questions "Qui va décider ?" et "Sur quelle base légale la décision va-t-elle être rendue ?" est plus (ou à tout le moins : autre chose) que la somme des réponses partielles à chacune des questions. Heureusement, les parties à un contrat international ont un certain pouvoir de déterminer à la fois la loi applicable à leur contrat et le tribunal compétent pour trancher d’éventuels litiges provoqués par les relations contractuelles, de sorte qu’elles ont la possibilité de façonner largement l’application effective de ce qu’elles ont voulu. Notamment, les parties peuvent décider d’insérer dans leur contrat une clause d’élection de droit et une clause d’élection for.
Une clause d’élection de droit est une stipulation par laquelle les parties désignent la loi applicable à une partie ou à l’intégralité du contrat principal. L’élection de droit signifie que les parties n’incorporent pas seulement quelques règles spéciales issues d’un droit étatique donné dans leur contrat, mais qu’elles décident de soumettre le contrat ou une partie de celui-ci, à un droit étatique en tant que tel, à l’exclusion des règles de conflit de lois du droit international privé de l’Etat concerné. On ne désigne que le droit substantiel d’un ordre juridique, le renvoi est exclu, pour éviter le risque de déjouer les prévisions des parties. Une clause d’élection de for, aussi appelée clause attributive de juridiction, est une stipulation par laquelle les parties déterminent que d’éventuels litiges résultant du contrat principal seront portés devant les tribunaux d’un certain Etat. Elle doit être distinguée d’une clause d’arbitrage, dans la mesure où cette dernière vise à soustraire la compétence juridictionnelle à tout Etat et à l’attribuer à des arbitres non-étatiques. La clause d’arbitrage ne fera donc pas l’objet principal de ce devoir, mais il conviendra quand même d’en parler, le cas échéant, pour illustrer et souligner la différence avec la clause d’élection de for, notamment dans les rapports avec la clause d’élection de droit.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- I. L'emploi à la fois des clauses d'élection de droit et des clauses d'élection de for
- A. La liberté limitée de la rédaction simultanée des deux types de clauses
- B. Les effets de synergie variables en pratique de la combinaison des clauses
- II. L'emploi soit des clauses d'élection de droit soit des clauses d'élection de for
- A. L'importance controversée de l'élection de for pour la détermination du droit applicable
- B. L'insignifiance en principe de l'élection de droit pour la détermination du tribunal compétent
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Interaktion zwischen Rechtswahlklauseln und Gerichtsstandsklauseln in internationalen Verträgen. Sie analysiert die Auswirkungen der gleichzeitigen oder getrennten Verwendung dieser Klauseln auf die Bestimmung des anwendbaren Rechts und des zuständigen Gerichts. Der Fokus liegt auf der Auslegung und den praktischen Folgen dieser Vertragsklauseln im Kontext des römischen I-Verordnung.
- Die Interaktion zwischen Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln
- Die Auswirkungen der gleichzeitigen Verwendung beider Klauseln
- Die Bedeutung der Gerichtsstandsklausel für die Rechtswahl
- Die Grenzen der Autonomie der Vertragsfreiheit
- Die Rolle des römischen I-Verordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung stellt die grundlegende Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Bestimmung des anwendbaren Rechts und der Zuständigkeit des Gerichts in internationalen Vertragsstreitigkeiten. Sie hebt die Bedeutung der Autonomie der Vertragsparteien hervor, sowohl das anwendbare Recht als auch den Gerichtsstand zu bestimmen, und kündigt die Analyse der Rechtswahlklauseln und Gerichtsstandsklauseln an. Die Einführung betont, dass die Gesamtlösung nicht nur die Summe der Einzelantworten auf die Fragen "Wer entscheidet?" und "Auf welcher Rechtsgrundlage?" darstellt. Sie unterstreicht die Möglichkeit der Parteien, durch die Einbeziehung von Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln die effektive Anwendung ihrer vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich zu gestalten.
I. L'emploi à la fois des clauses d'élection de droit et des clauses d'élection de for: Dieses Kapitel befasst sich mit der gleichzeitigen Verwendung von Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln in internationalen Verträgen. Es analysiert die eingeschränkte Freiheit der Parteien bei der Formulierung dieser Klauseln und untersucht die unterschiedlichen praktischen Auswirkungen dieser Kombination. Der Abschnitt A erörtert die strengeren formalen und materiellen Anforderungen an Gerichtsstandsklauseln im Vergleich zu Rechtswahlklauseln. Abschnitt B konzentriert sich auf die synergetischen Effekte der Kombination beider Klauseln, wobei sowohl der Fall des regelmäßigen Respekts als auch der Ausnahmefall des Nichtrespekts durch den Richter behandelt werden.
II. L'emploi soit des clauses d'élection de droit soit des clauses d'élection de for: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verwendung entweder von Rechtswahl- oder Gerichtsstandsklauseln. Abschnitt A analysiert die umstrittene Bedeutung der Gerichtsstandsklausel für die Bestimmung des anwendbaren Rechts, sowohl bei der Wahl eines ausschließlichen als auch eines nicht-ausschließlichen Gerichtsstands. Es beleuchtet dabei die unterschiedlichen Positionen nationaler Gerichte und die Unfähigkeit der Erwägung 12 des römischen I-Verordnung, diese Divergenzen zu lösen. Abschnitt B hingegen widmet sich der grundsätzlich unbedeutenden Rolle der Rechtswahlklausel für die Bestimmung der Gerichtszuständigkeit und analysiert nur die indirekten Auswirkungen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Lokalisierung der strittigen Verpflichtung und der subjektiven Auslegung einer Rechtswahlklausel als Gerichtsstandsklausel.
Schlüsselwörter
Rechtswahlklausel, Gerichtsstandsklausel, internationales Vertragsrecht, Rom I-Verordnung, Autonomie der Vertragsparteien, Gerichtszuständigkeit, anwendbares Recht, Rechtswahl, Gerichtsstandwahl, Synergieeffekte, Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interaktion zwischen Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln in internationalen Verträgen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Interaktion zwischen Rechtswahlklauseln und Gerichtsstandsklauseln in internationalen Verträgen. Sie analysiert die Auswirkungen der gleichzeitigen oder getrennten Verwendung dieser Klauseln auf die Bestimmung des anwendbaren Rechts und des zuständigen Gerichts, insbesondere im Kontext der Rom I-Verordnung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Interaktion zwischen Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln, die Auswirkungen ihrer gleichzeitigen Verwendung, die Bedeutung der Gerichtsstandsklausel für die Rechtswahl, die Grenzen der Autonomie der Vertragsfreiheit und die Rolle der Rom I-Verordnung. Sie untersucht sowohl den Fall der gleichzeitigen Verwendung beider Klauseln als auch den Fall, in dem nur eine der Klauseln verwendet wird.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, zwei Hauptkapiteln und einer Schlussfolgerung. Kapitel I behandelt die gleichzeitige Verwendung von Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln, während Kapitel II sich mit der Verwendung von nur einer dieser Klauseln befasst. Jedes Kapitel ist in Unterabschnitte unterteilt, die spezifische Aspekte der Thematik analysieren.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die Arbeit zeigt die komplexe Interaktion zwischen Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln auf. Sie hebt die eingeschränkte Freiheit der Parteien bei der Formulierung dieser Klauseln hervor und analysiert die unterschiedlichen praktischen Auswirkungen der verschiedenen Kombinationen. Besonders relevant ist die Untersuchung der umstrittenen Bedeutung der Gerichtsstandsklausel für die Bestimmung des anwendbaren Rechts und der grundsätzlich unbedeutenden Rolle der Rechtswahlklausel für die Bestimmung der Gerichtszuständigkeit.
Welche Rolle spielt die Rom I-Verordnung?
Die Rom I-Verordnung spielt eine zentrale Rolle in der Analyse, da sie den rechtlichen Rahmen für die Bestimmung des anwendbaren Rechts in internationalen Vertragsstreitigkeiten vorgibt. Die Arbeit untersucht, wie die Verordnung die Interaktion zwischen Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln beeinflusst und wie die Verordnung mit den unterschiedlichen Auslegungen nationaler Gerichte umgeht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Rechtswahlklausel, Gerichtsstandsklausel, internationales Vertragsrecht, Rom I-Verordnung, Autonomie der Vertragsparteien, Gerichtszuständigkeit, anwendbares Recht, Rechtswahl, Gerichtsstandwahl, Synergieeffekte, Konfliktlösung.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und hebt die Bedeutung der Autonomie der Vertragsparteien hervor. Kapitel I analysiert die gleichzeitige Verwendung von Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln, einschließlich der eingeschränkten Freiheit der Parteien bei deren Formulierung und der unterschiedlichen praktischen Auswirkungen. Kapitel II befasst sich mit der Verwendung von nur einer der Klauseln, analysiert die umstrittene Bedeutung der Gerichtsstandsklausel für die Rechtswahl und die unbedeutende Rolle der Rechtswahlklausel für die Gerichtszuständigkeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Juristen, Wissenschaftler und alle, die sich mit internationalem Vertragsrecht, insbesondere mit der Bestimmung des anwendbaren Rechts und der Gerichtszuständigkeit, befassen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Interaktion zwischen Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln und deren praktische Auswirkungen.
- Quote paper
- Jérôme Richter (Author), 2017, Clauses d'élection de droit et clauses d'élection de for. Le droit des contrats internationaux selon le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899462