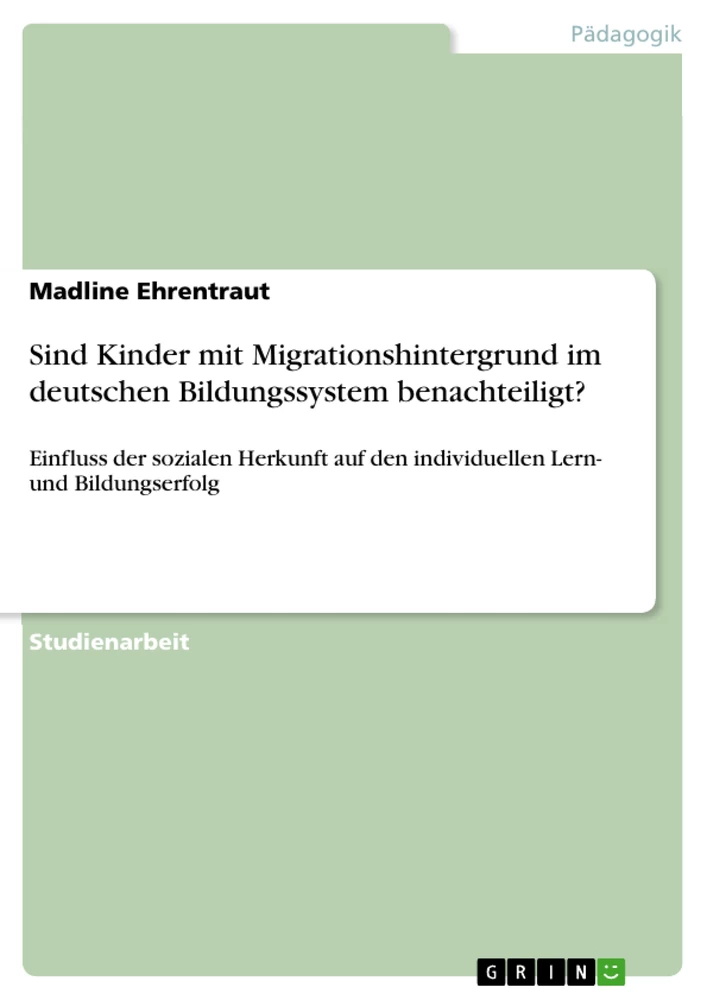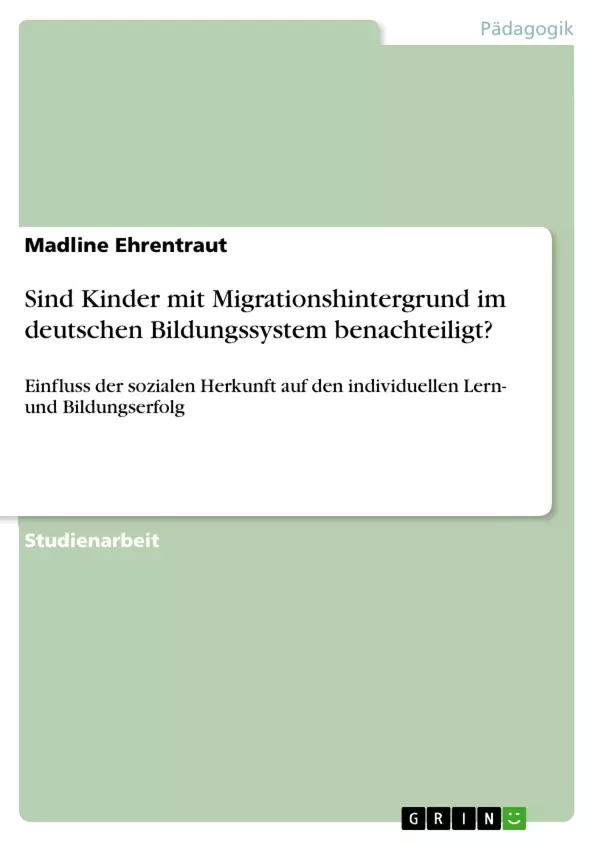Die Arbeit setzt sich mit dem Thema der Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund auseinander. Ziel der Arbeit ist es zu klären, ob Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem benachteiligt sind und inwieweit ihre soziale Herkunft den individuellen Lern- und Bildungserfolg beeinflusst.
Dabei bezieht sich der Autor auf die Theorie der kulturellen Reproduktion von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Zunächst wird der Begriff "Migration" erläutert, wobei auch darauf eingegangen wird, welche Formen von Migration es gibt und wer in Deutschland als Migrant bezeichnet wird. Anschließend stellt der Autor die Theorie der kulturellen Reproduktion von Pierre Bourdieu vor, um im späteren Verlauf darauf stützen und Bildungsbenachteiligung von diesem Hintergrund betrachten zu können. Danach werden die wesentlichen Begriffe seiner Theorie erläutert: Habitus, sozialer Raum und Klasse, soziale Felder und Kapitalarten. Anschließend folgt eine allgemeine Erläuterung der Bildungsbenachteiligung durch einen Migrationshintergrund, die in einem weiteren Unterpunkt mit Betrachtung der Theorie der kulturellen Reproduktion unterstützt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migration - Eine begriffliche Erläuterung
- Die Theorie der kulturellen Reproduktion nach Pierre Bourdieu
- Habitustheorie
- Sozialer Raum und Soziale Klasse
- Soziale Felder
- Kapital und Kapitalarten
- Schule und Migration
- Bildungsbenachteiligung durch Migrationshintergrund
- Bildungsbenachteiligung durch Migrationshintergrund vor dem Hintergrund der Theorie der kulturellen Reproduktion nach Pierre Bourdieu
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Sie untersucht, ob Kinder mit Migrationshintergrund im schulischen Bereich benachteiligt sind und inwieweit ihre soziale Herkunft ihren Bildungserfolg beeinflusst. Dabei wird die Theorie der kulturellen Reproduktion von Pierre Bourdieu herangezogen.
- Begriffliche Klärung von Migration und Migrationshintergrund
- Vorstellung der Theorie der kulturellen Reproduktion von Pierre Bourdieu
- Analyse der Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund
- Beziehung zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Anwendung der Theorie der kulturellen Reproduktion auf die Bildungsbenachteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund vor und erläutert die Zielsetzung und den methodischen Ansatz.
- Migration - Eine begriffliche Erläuterung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Migration und beschreibt die verschiedenen Formen von Migration. Es werden die Ursachen für Migrationsbewegungen, sowie die Auswirkungen auf Individuen und Gesellschaften erläutert.
- Die Theorie der kulturellen Reproduktion nach Pierre Bourdieu: Dieses Kapitel stellt die Theorie der kulturellen Reproduktion von Pierre Bourdieu vor. Es werden die wichtigsten Konzepte wie Habitus, sozialer Raum, soziale Felder und Kapitalarten erläutert.
- Schule und Migration: Dieses Kapitel untersucht die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund und analysiert die Ursachen dieser Benachteiligung im Kontext der Theorie der kulturellen Reproduktion.
Schlüsselwörter
Migration, Migrationshintergrund, Bildungsbenachteiligung, Pierre Bourdieu, Theorie der kulturellen Reproduktion, Habitus, sozialer Raum, soziale Felder, Kapital, Kapitalarten, Schule, Bildungserfolg, Integration, soziale Ungleichheit
Häufig gestellte Fragen
Sind Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem benachteiligt?
Die Arbeit untersucht diese These und analysiert, inwieweit die soziale Herkunft und der Migrationshintergrund den Bildungserfolg negativ beeinflussen.
Welche Theorie dient als Grundlage für die Analyse?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der kulturellen Reproduktion des französischen Soziologen Pierre Bourdieu.
Was versteht Bourdieu unter dem Begriff "Habitus"?
Der Habitus beschreibt die Gesamtheit der Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster eines Individuums, die durch die soziale Herkunft geprägt sind.
Welche Kapitalarten unterscheidet Bourdieu?
Er unterscheidet vor allem ökonomisches Kapital (Besitz), kulturelles Kapital (Bildung/Wissen) und soziales Kapital (Beziehungen/Netzwerke).
Wie führt kulturelles Kapital zu Bildungsbenachteiligung?
Wenn die Schule primär das kulturelle Kapital der herrschenden Klasse voraussetzt, haben Kinder aus Familien mit anderem Hintergrund (z. B. Migranten) schlechtere Startchancen.
Was wird unter "sozialer Ungleichheit" im Bildungssystem verstanden?
Es beschreibt den Umstand, dass der Bildungserfolg in Deutschland stark von der sozialen Schicht der Eltern und weniger von der individuellen Begabung abhängt.
- Quote paper
- Madline Ehrentraut (Author), 2020, Sind Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem benachteiligt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/906586