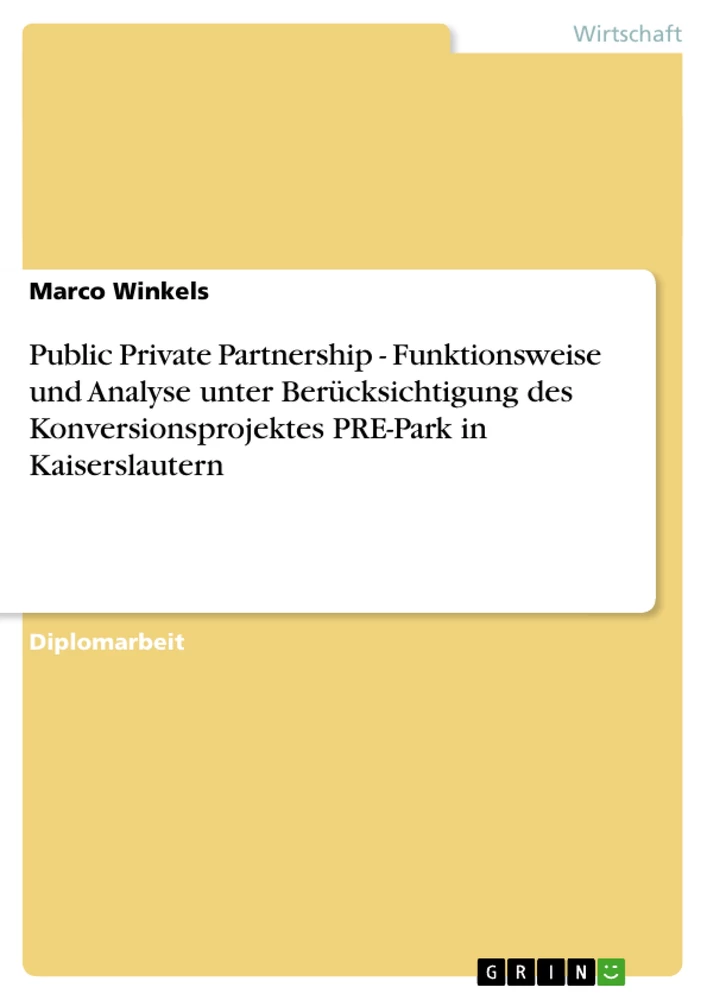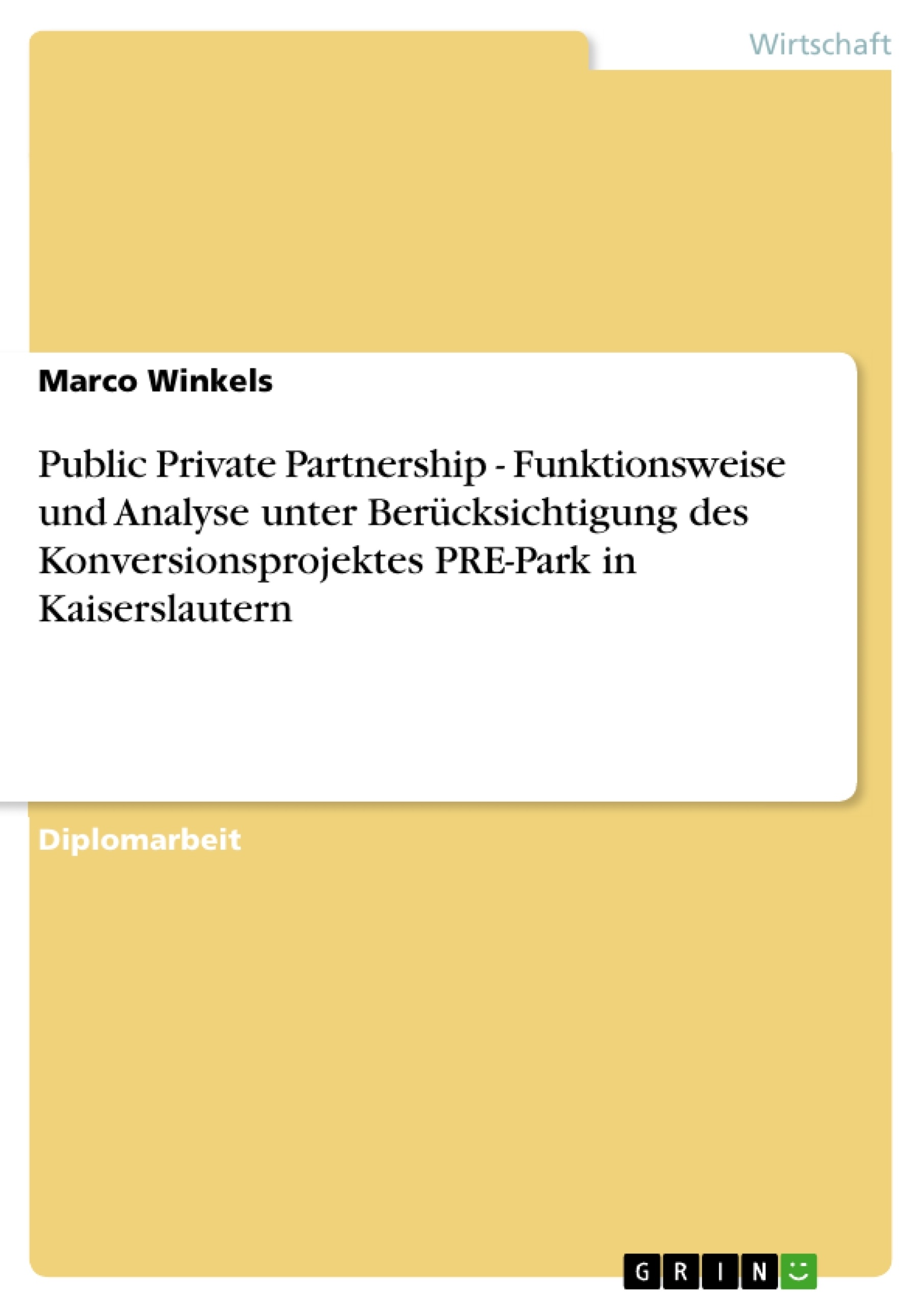L’ État, c’est moi.“ – Der Staat bin ich; soll einst Ludwig der XIV, König von Frank-reich gesagt haben. In der heutigen Zeit ist diese Aussage für die Menschen im modernen Europa und im sozial-demokratischen Deutschland wohl kaum noch nachvollziehbar. Der Fortschritt hat die Menschen und die geschichtlichen Zustände in Europa positiv verändert. Gerade der Begriff des technischen Fortschritts ist heute in Europa fest verankert. Die Staatsstruktur in Deutschland ist gegenwärtig föderalistisch und basiert vereinfacht auf zwei Pfeilern. Dabei bildet der Bund den Oberstaat und die Länder fungieren als Gliedstaaten. Die Kompetenzen und Auf-gaben zwischen dem Bund und den derzeit 16 Bundesländern sind im Grundgesetz klar gegliedert. Der Verwaltungsaufbau in Deutschland basiert hingegen auf drei Ebenen und beginnt hierarchisch mit der Bundesverwaltung, als höchste Ebene, über die Landesverwaltung, bis hin zur Kommunalverwaltung. Der Begriff der Kommunalverwaltung stellt einen Sammelbegriff dar, der u. a. die Gemeinden und die Landkreise in den einzelnen Ländern einschließt. Doch evaluiert man die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland, wird eine prekäre Verschuldungssituation der öffentlichen Haushalte erkennbar. Es ergeben sich leichte Parallelen zur damaligen Zeit, zumindest beim Aspekt zur Erreichung eines konsolidierten öffentlichen Haushalts. Auch Ludwig der XIV hatte zu Beginn seiner Herrschaft mit einem defizitären Staatshaushalt zu kämpfen. Doch die damaligen Gründe, im Vergleich zu den heutigen Problemen bei den öffentlichen Haushalten in Deutschland, können disparativer nicht sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Ziel der Arbeit und Vorgehensweise
- 2 Bedeutung und Grundlagen von Public Private Partnership (PPP)
- 2.1 Begriff und konstitutive Merkmale von PPP
- 2.2 Geschichte und Entwicklung von PPP
- 2.2.1 Entstehung in den USA
- 2.2.2 Verbreitung in Europa
- 2.2.3 Potential in Deutschland
- 2.3 Privatisierung und PPP
- 2.3.1 Formelle Privatisierung
- 2.3.2 Funktionelle Privatisierung
- 2.3.3 Materielle Privatisierung
- 2.3.4 Privatisierung in Abgrenzung zu PPP
- 3 Kooperationen als Lösungsansatz staatlicher Probleme
- 3.1 Beteiligte Akteure bei PPP
- 3.1.1 Der öffentliche Sektor
- 3.1.1.1 Aufgaben
- 3.1.1.2 Motive und Interessen für eine Partnerschaft
- 3.1.2 Der private Sektor
- 3.1.2.1 Aufgaben
- 3.1.2.2 Motive und Interessen für eine Partnerschaft
- 3.1.1 Der öffentliche Sektor
- 3.2 PPP-Übersicht und Funktionsweise von Vertrags- und Kombinationsmodellen
- 3.2.1 PPP-Erwerbermodell
- 3.2.2 PPP-FM-Leasingmodell
- 3.2.3 PPP-Vermietungsmodell
- 3.2.4 PPP-Inhabermodell
- 3.2.5 PPP-Contractingmodell
- 3.2.6 PPP-Konzessionsmodell
- 3.2.7 PPP-Gesellschaftsmodell
- 3.2.8 Differente Relevanz der Modellverwirklichung bei Bund, Ländern und Kommunen
- 3.2.8.1 PPP-Projekte im weiteren Sinne
- 3.2.8.2 PPP-Projekte im engeren Sinne
- 3.3 Nachteile und Risiken bei PPP
- 3.3.1 Vertragliche Implementierung unter Einbezug des Beispiels Toll Collect
- 3.3.2 Prinzipal-Agenten-Theorie
- 3.3.3 Transaktionskosten
- 3.3.4 Rechtliche Aspekte
- 3.3.5 Politisches Umfeld und steuerliche Gesichtspunkte
- 3.1 Beteiligte Akteure bei PPP
- 4 Praxisbeispiel: Analyse und Rahmenbedingungen des PRE-Parks in Kaiserslautern
- 4.1 Überblick und Struktur der Stadt Kaiserslautern sowie Einordnung in die Region
- 4.1.1 Lage
- 4.1.2 Historie
- 4.1.3 Wirtschaftsstandort
- 4.2 Herausforderung Konversion
- 4.3 Bewältigung der Konversion
- 4.4 Umwandlung der Holtzendorff-Kaserne Kaiserslautern
- 4.4.1 Ausgangslage
- 4.4.2 Verwirklichung durch PPP
- 4.4.3 Konzept des PRE-Parks
- 4.4.4 Erfolgsfaktoren des PRE-Parks
- 4.4.5 Zukunft
- 4.1 Überblick und Struktur der Stadt Kaiserslautern sowie Einordnung in die Region
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktionsweise von Public Private Partnerships (PPP) und analysiert deren Anwendung anhand des Konversionsprojekts PRE-Park in Kaiserslautern. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile von PPP aufzuzeigen und die Erfolgsfaktoren des PRE-Parks zu identifizieren.
- Begriff und Funktionsweise von PPP
- Vorteile und Risiken von PPP-Modellen
- Analyse des Konversionsprojekts PRE-Park
- Bedeutung von PPP für die Bewältigung staatlicher Herausforderungen
- Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte von PPP
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Public Private Partnerships (PPP) ein und beschreibt die Motivation der Arbeit sowie die gewählte Vorgehensweise. Es legt den Fokus auf die Untersuchung der Funktionsweise von PPP und deren Anwendung im Praxisbeispiel des PRE-Parks in Kaiserslautern. Die Einleitung dient als Grundlage für die nachfolgenden Kapitel und skizziert den methodischen Ansatz der Analyse.
2 Bedeutung und Grundlagen von Public Private Partnership (PPP): Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff und die konstitutiven Merkmale von PPP. Es zeichnet die historische Entwicklung von PPP in den USA und Europa nach und untersucht das Potential von PPP in Deutschland. Die verschiedenen Arten der Privatisierung werden im Kontext von PPP diskutiert, um die spezifischen Eigenschaften und Abgrenzungen von PPP herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Klärung grundlegender Konzepte, die für das Verständnis des restlichen Textes unabdingbar sind.
3 Kooperationen als Lösungsansatz staatlicher Probleme: Dieses Kapitel analysiert die beteiligten Akteure im öffentlichen und privaten Sektor innerhalb von PPP-Projekten, untersucht deren Motive und Interessen und beschreibt die Funktionsweise verschiedener PPP-Modelle, z.B. Erwerber-, Leasing- und Konzessionsmodelle. Der Abschnitt zu den Nachteilen und Risiken von PPP beleuchtet kritische Aspekte wie Vertragsgestaltung, Transaktionskosten und rechtliche Implikationen. Das Kapitel vermittelt ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Facetten und Herausforderungen im Zusammenhang mit PPP-Kooperationen.
4 Praxisbeispiel: Analyse und Rahmenbedingungen des PRE-Parks in Kaiserslautern: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse des PRE-Parks in Kaiserslautern als konkretes Beispiel für ein erfolgreiches PPP-Projekt. Es beschreibt die Ausgangslage, den Konversionsprozess und die Umsetzung des Projekts mittels PPP. Die Erfolgsfaktoren des PRE-Parks werden herausgestellt und dessen zukünftige Entwicklung perspektivisch betrachtet. Das Kapitel verdeutlicht die Anwendung der zuvor beschriebenen theoretischen Konzepte in einem realen Kontext.
Schlüsselwörter
Public Private Partnership (PPP), Privatisierung, Konversion, PRE-Park Kaiserslautern, Vertragsmodelle, Risiken, Transaktionskosten, Prinzipal-Agenten-Theorie, öffentlicher Sektor, privater Sektor, Kooperationen, wirtschaftliche Effizienz, rechtliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Public Private Partnerships (PPP) am Beispiel des PRE-Parks Kaiserslautern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Public Private Partnerships (PPP), insbesondere deren Funktionsweise und Anwendung am Beispiel des Konversionsprojekts PRE-Park in Kaiserslautern. Sie analysiert die Vor- und Nachteile von PPP und identifiziert die Erfolgsfaktoren des PRE-Parks.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriff und Funktionsweise von PPP, Vorteile und Risiken von PPP-Modellen, eine detaillierte Analyse des Konversionsprojekts PRE-Park, die Bedeutung von PPP für die Bewältigung staatlicher Herausforderungen sowie rechtliche und wirtschaftliche Aspekte von PPP.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Bedeutung und Grundlagen von PPP, Kooperationen als Lösungsansatz staatlicher Probleme, Praxisbeispiel: Analyse und Rahmenbedingungen des PRE-Parks in Kaiserslautern, und Fazit. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und vertieft die Thematik schrittweise.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema PPP ein, beschreibt die Motivation der Arbeit und die gewählte Vorgehensweise. Sie legt den Fokus auf die Untersuchung der Funktionsweise von PPP und deren Anwendung im Praxisbeispiel des PRE-Parks.
Was sind die zentralen Inhalte des Kapitels "Bedeutung und Grundlagen von PPP"?
Dieses Kapitel definiert PPP, beschreibt dessen konstitutive Merkmale und zeichnet die historische Entwicklung von PPP in den USA und Europa nach. Es analysiert das Potential in Deutschland und diskutiert verschiedene Privatisierungsarten im Kontext von PPP.
Worüber informiert das Kapitel "Kooperationen als Lösungsansatz staatlicher Probleme"?
Dieses Kapitel analysiert die beteiligten Akteure im öffentlichen und privaten Sektor, deren Motive und Interessen, sowie die Funktionsweise verschiedener PPP-Modelle (z.B. Erwerber-, Leasing- und Konzessionsmodelle). Es beleuchtet auch Nachteile und Risiken wie Vertragsgestaltung, Transaktionskosten und rechtliche Implikationen.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels zum PRE-Park Kaiserslautern?
Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des PRE-Parks als konkretes Beispiel für ein erfolgreiches PPP-Projekt. Es beschreibt die Ausgangslage, den Konversionsprozess, die Umsetzung mittels PPP, die Erfolgsfaktoren und die zukünftige Entwicklung.
Welche Arten von PPP-Modellen werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene PPP-Modelle, darunter Erwerbermodell, FM-Leasingmodell, Vermietungsmodell, Inhabermodell, Contractingmodell, Konzessionsmodell und Gesellschaftsmodell. Die unterschiedliche Relevanz der Modelle für Bund, Länder und Kommunen wird ebenfalls betrachtet.
Welche Risiken und Nachteile von PPP werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Risiken und Nachteile von PPP, darunter die vertragliche Implementierung (am Beispiel Toll Collect), die Prinzipal-Agenten-Theorie, Transaktionskosten, rechtliche Aspekte und das politische Umfeld sowie steuerliche Gesichtspunkte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Public Private Partnership (PPP), Privatisierung, Konversion, PRE-Park Kaiserslautern, Vertragsmodelle, Risiken, Transaktionskosten, Prinzipal-Agenten-Theorie, öffentlicher Sektor, privater Sektor, Kooperationen, wirtschaftliche Effizienz, rechtliche Aspekte.
- Citation du texte
- Dipl.-Kfm. (FH) Marco Winkels (Auteur), 2007, Public Private Partnership - Funktionsweise und Analyse unter Berücksichtigung des Konversionsprojektes PRE-Park in Kaiserslautern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92627