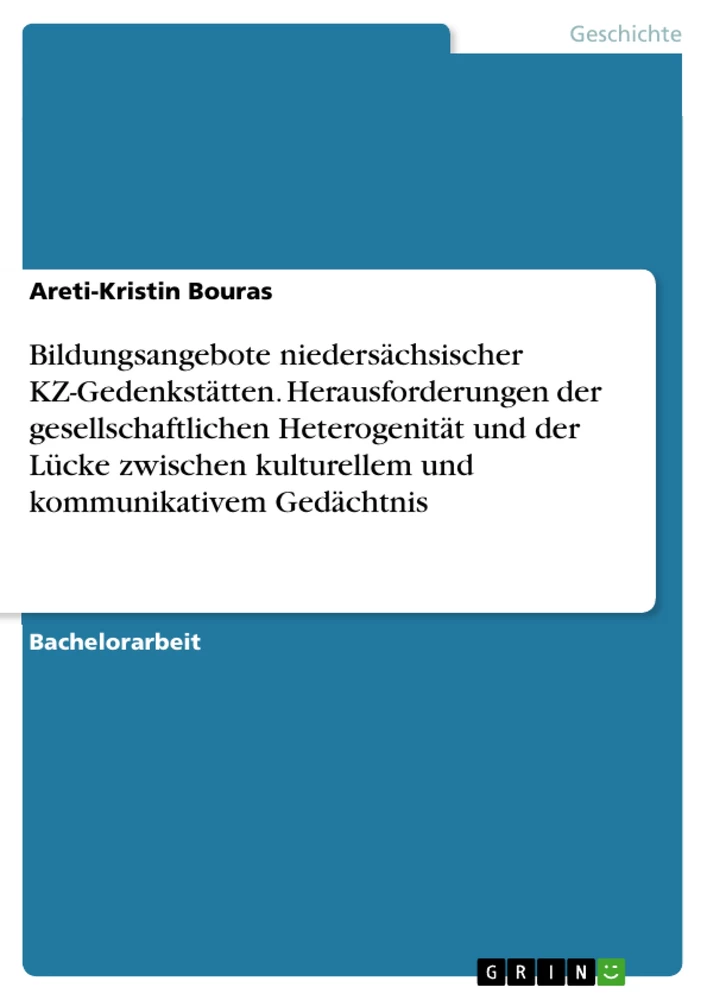In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern aktuelle Bildungsangebote ausgewählter niedersächsischer KZ-Gedenkstätten auf Herausforderungen der gesellschaftlichen Heterogenität und der größer werdenden Lücke zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis eingehen. Der Begriff Gedenkstätten beziehe sich fast ausschließlich auf den Nationalsozialismus und seine Opfer. Sie würden sich „an jenen historischen Orten (vor allem Lagern), an denen die Taten stattgefunden haben“ befinden. Darüber hinaus würden heutzutage in den meisten Einrichtungen auch einschlägige Informationsangebote zur Verfügung gestellt werden.
Um die Fragestellung zu beantworten, soll zunächst ein definitorischer Teil folgen, in dem Begriffe wie Erinnerungskultur und die verschiedenen Gedächtnisarten erklärt werden. In diesem Zusammenhang soll auch die historische Genese von Gedenkstätten in Deutschland nachvollzogen werden. Anschließend soll der aktuelle Forschungsstand bezüglich Gedenkstättenbildung und den aktuellen Herausforderungen herausgearbeitet werden. Im empirischen Teil der Arbeit geht es darum, aktuelle Bildungskonzepte ausgewählter KZ-Gedenkstätten aus Niedersachsen zu analysieren. Dafür sollen aus den Theorietexten vom Anfang Kriterien herausgearbeitet werden, mittels derer überprüft werden soll, ob und inwiefern sie auf die Herausforderungen von gesellschaftlicher Heterogenität und der größer werdenden Lücke zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis eingehen.
Als Quellenmaterial sollen dabei alle öffentlich zugänglichen Materialien und Texte, die auf den jeweiligen Websites der Gedenkstätten zu finden sind, dienen. Dies umfasst sowohl die konkreten Bildungsangebote als auch Informationen zu Zielsetzungen und der Philosophie der Einrichtungen.
Die Gedenkstätten wurden jeweils auf Grund spezifischer Faktoren ausgewählt, deren Einfluss überprüft werden soll. Das Ziel der Arbeit ist es, herauszuarbeiten, welche Faktoren einen stärkeren und welche einen schwächeren Einfluss darauf haben, inwiefern die Einrichtungen auf die aktuellen Herausforderungen reagieren und einen Überblick darüber zu geben, wie die ausgewählten Gedenkstätten generell mit ihnen umgehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gedenkstättenbildung in Deutschland
- 2.1 Geschichte
- 2.2 Erinnerungskultur
- 3. Aktuelle Herausforderungen von Gedenkstättenarbeit
- 3.1 Geschichtsbewusstsein und historisch-politische Bildung
- 3.2 Gesellschaftliche Heterogenität
- 3.3 Die Lücke zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis
- 3.4 Zugänge und Methoden der Gedenkstättenbildung
- 4. Gedenkstätten in Niedersachsen
- 4.1 Auswahl des Samplings
- 4.2 Methodisches Vorgehen
- 4.3 Analyse
- 4.4 Grenzen und Chancen der Analyse
- 5. Einordnung der Bildungskonzepte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern aktuelle Bildungsangebote ausgewählter niedersächsischer KZ-Gedenkstätten auf Herausforderungen der gesellschaftlichen Heterogenität und der größer werdenden Lücke zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis eingehen. Sie untersucht dazu die Geschichte der Gedenkstättenbildung in Deutschland, die verschiedenen Gedächtnisformen und die aktuellen Herausforderungen der Gedenkstättenarbeit. Im Mittelpunkt der Analyse stehen aktuelle Bildungskonzepte ausgewählter KZ-Gedenkstätten aus Niedersachsen, wobei die Arbeit auf öffentlich zugängliche Materialien und Texte der jeweiligen Einrichtungen zurückgreift.
- Die Geschichte der Gedenkstättenbildung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg
- Der Begriff der Erinnerungskultur und die verschiedenen Gedächtnisformen
- Aktuelle Herausforderungen der Gedenkstättenarbeit, insbesondere hinsichtlich der gesellschaftlichen Heterogenität und der Lücke zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis
- Analyse von Bildungskonzepten ausgewählter KZ-Gedenkstätten in Niedersachsen
- Bewertung des Einflusses verschiedener Faktoren auf die Reaktion der Einrichtungen auf die aktuellen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung der Gedenkstättenarbeit im Kontext der Herausforderungen der Erinnerungskultur im heutigen Deutschland. Kapitel 2 verfolgt die Entwicklung der Gedenkstättenbildung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und definiert den Begriff der Erinnerungskultur. Kapitel 3 analysiert die aktuellen Herausforderungen von Gedenkstättenarbeit, insbesondere die zunehmende gesellschaftliche Heterogenität und die Lücke zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis. Es diskutiert verschiedene Zugänge und Methoden der Gedenkstättenbildung. Kapitel 4 fokussiert auf Gedenkstätten in Niedersachsen. Es beschreibt die Auswahl der Einrichtungen, das methodische Vorgehen der Analyse und die Ergebnisse. Kapitel 5 ordnet die Bildungskonzepte der untersuchten Gedenkstätten ein und bewertet ihren Einfluss auf die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Gedenkstättenbildung, Erinnerungskultur, gesellschaftliche Heterogenität, kommunikatives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis, KZ-Gedenkstätten, Niedersachsen, Bildungskonzepte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen untersuchen niedersächsische KZ-Gedenkstätten?
Die Arbeit untersucht, wie Bildungsangebote auf die gesellschaftliche Heterogenität und die Lücke zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis reagieren.
Was ist der Unterschied zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis?
Das kommunikative Gedächtnis basiert auf Zeitzeugenschaft und persönlichem Austausch, während das kulturelle Gedächtnis durch Institutionen und Monumente verstetigt wird.
Welche Region steht im Fokus der Analyse?
Die Untersuchung konzentriert sich spezifisch auf KZ-Gedenkstätten im Bundesland Niedersachsen.
Welche Materialien wurden für die Studie analysiert?
Es wurden öffentlich zugängliche Materialien, Webseiten-Texte, Bildungsangebote und Informationen zur Philosophie der jeweiligen Gedenkstätten herangezogen.
Was ist das Ziel der Gedenkstättenbildung?
Ziel ist die Förderung des Geschichtsbewusstseins und die historisch-politische Bildung im Kontext der Verbrechen des Nationalsozialismus.
Welche Rolle spielt die gesellschaftliche Heterogenität?
Sie stellt eine Herausforderung dar, da Bildungsangebote für eine immer vielfältigere Zielgruppe mit unterschiedlichen Vorwissen und Hintergründen konzipiert werden müssen.
- Quote paper
- Areti-Kristin Bouras (Author), 2020, Bildungsangebote niedersächsischer KZ-Gedenkstätten. Herausforderungen der gesellschaftlichen Heterogenität und der Lücke zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/938976